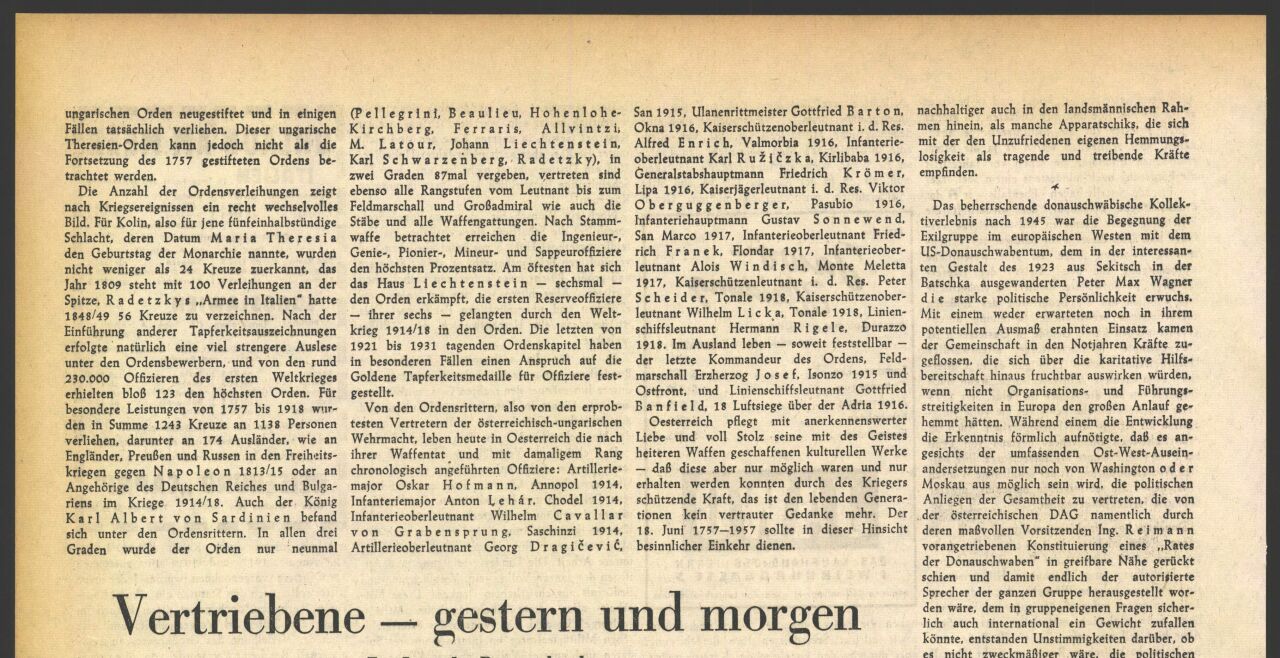
Zu Pfingsten findet in Wien, gleichzeitig mit der 50-Jahr-Feier des Wiener Schwabenvereines, ein großes Treffen der heute in Oesterreich 160.442 lebenden Donauschwaben statt. Im Verlauf dieses „Tages der Donauschwaben" mit starker ausländischer Beteiligung wird auch eine Ausstellung über Adam Müller-Guttenbrunn, dem Künder und Sänger der Donauschwaben, von denen 200.000 in den Vemichtungsstätten Titos auf elende Weise umkamen, veranstaltet werden. Zu Pfingsten werden auch die grundlegenden Arbeiten zur Errichtung eines Donauschwäbischen Kul- turmuseums so weit gediehen sein, daß man an eine Realisierung dieses alten Planes denken kann. Ein Kulturverein „Müller-Guttenbrunn" soll das Schrifttum der Donauschwaben pflegen.
Die geistigen Strömungen und politischen Kräfte der Donauschwaben aufzuzeigen, soweit sie das Innenleben formen und das äußere Geschehen einer Gruppe bestimmen, die noch skizzenhaft unfertig war, als 1944 die Katastrophe über sie hereinbrach, ist in der heutigen atomisierten Situation ein um so größeres Wagnis, als von mancher Seite selbst ihre Existenz als Stammesgruppe in Frage gestellt wird. Obwohl vom Volkskundlichen her die Zusammengehörigkeit der durch den Trianoner Friedensvertrag politisch kaum 25 Jahre hindurch dreigeteilten Gruppe niemals umstritten war, fördert der Mangel einer gemeinsamen politischen Aufgabe sehr entscheidend jenen Auflösungsprozeß, dessen Symptome in der unerhörten Streulage der Gegenwart unverkennbar sind.
Schon der Umstand, daß heute kaum eine donauschwäbische Stelle in der weiten Welt in der Lage ist, verbindliche statistische Anhaltspunkte über die Gruppensituation zu geben, deutet jene eigenartig „unbewußte Atmosphäre an, die das politische Dasein der Donauschwaben kennzeichnet: Ein Drittel dieses sehr nachhaltig durch die übernationale Geistigkeit der alten Donaumonarchie geprägten Volkstums, rund 500 000 Menschen, lebt in Europa, diesseits des Eisernen Vorhanges, davon 95 Prozent in Deutschland und Oesterreich, der Rest im übrigen Westen, vornehmlich in Frankreich. Das zweite Drittel hat sich im Zuge von mehreren Migrationsbewegungen, ab 1890 etwa, in Nord- und Südamerika sowie in Australien, namentlich nach 1945, festgesetzt. Das letzte Drittel ist in den Heimatstaaten Jugoslawien
(50.0) , Ungarn (300.000) und Rumänien
(180.0) verblieben.
Wenn man nach einem bestimmenden Merkmal in der europäischen Exilsituation der Donauschwaben sucht, fällt zunächst der Mangel einer politischen Autorität auf. Der Prozeß des Verschleißes politischer Kräfte setzte bereits mit den weltanschaulichen Auseinandersetzungen zwischen 1935 und 1944 ein, deren Unerbittlichkeit und Rücksichtslosigkeit zwangsläufig einerseits Abnützungserscheinungen, anderseits weitgehenden Vertrauensschwund zur Folge haben mußte.
In dieser Lage wuchsen die potentiellen kirchlichen Kräfte, die trotz schwerster Anfeindungen in der „Kampfzeit integeT geblieben waren, in den Jahren der Ratlosigkeit nach 1945 aus der reinen Seelsorge in allgemeinere volkspolitische Aufgaben hinein, die sie nicht nur mit selbstloser Hingabe, sondern vielfach auch mit mehr politischem Geschick meisterten als die Routiniers. Die Ueberzeu- gungskraft, die von katholischer Seite aus die
Bemühungen des Vukovarer Franziskanerpaters Prof. Dr. Stefan ausstrahlten, die sachliche Art, in der der Hodschager Konsistorialrat Professor Haltmayer die landsmännischen Anliegen vertrat, die besondere Note des Filipowoer Geistlichen Rates Alexander Thiel, dessen sicheres Auftreten nicht nur Achtung, sondern auch Vertrauen auslöste, konnten auch in einet Ex-Lex-Zeit nicht ohne Auswirkungen bleiben, weil hier die Anliegen von totalen Vorbildern getragen wurden. Von evangelischer Seite waren es vor allem der Banater Bischof Hein, der Batschkaer Senior Meder, Rektor Göhring und im ungarndeutschen Rahmen besonders Pfarrer Spiegel-Schmidt, die zugunsten der Gemeinschaft auch ihre internationalen Beziehungen einsetzten, um das Gesamtgeschehen in einer aussichtslos scheinenden Lage zu beeinflussen. Sie wirkten damit für die Gruppe im eigentlichen Sinne des Wortes politisch.
Diese aus dem Wesen kirchlicher Arbeit folgerichtig auf größere und wesenhaftere Zusammenhänge ausgerichteten Bemühungen schienen aber bald beeinträchtigt, als mit der zunehmenden Konsolidierung der politischen Verhältnisse und existentiellen Lage die alten Spannungen von daheim auflebten oder aus unterdrückten politischen Führungsambitionen in die Gruppe mutwillig hineingetragen wurden. Während aus der Begegnung der geistigen Kräfte mit einem verinnerlichten Christentum im Westen ein Umschichtungsprozeß eingeleitet wurde, der eine Neugruppierung zur Folge hatte und, auf lange Sicht gesehen, mindestens so nachhaltig wirken wird, wie die soziologische Umschichtung, warf die aus der Minderheitensituation gewachsene, geistig durch den Liberalismus geprägte politische Gruppierung einen primitiven Gruppenegoismus nach den ehemaligen Herkunftsländern und Siedlungsgebieten als Trumpf aus und gab damit den Startschuß für ein unfruchtbares Gezänk, das nun fast schon ein Jahrzehnt auf der Ebene Banat-Batschka-Syrmien ausgetragen wird und vor allem die jüngeren potentiellen Kräfte, die aus dem Getto in eine umfassendere Menschheit hineingewachsen sind, abstößt. In dieser geistigen Atmosphäre hat der Banater Oberstudienrat Anton Valentin seine These von einer Art „Kulturgefälle postuliert, das zwischen dem Banat einerseits und den übrigen donauschwäbischen Siedlungsgebieten anderseits bestehen soll, und damit das Thema für Diskussionen geliefert, die die Organisationen bis hinunter zu den Bezirks- und Ortsstellen seither befassen. Die Kritik an einem „öden Historizismus , demzufolge man das Leben vergewaltigt, ist allerdings seither nicht mehr verstummt.
Während in diesem hoffnungslosen Getto so etwas wie ein Sturm im Wasserglas eine Art Bewegung und lebendige Spannungen vortäuschte,
ist eine jüngere Generation mit scharf pointierter gesellschaftskritischer Note angetreten, weniger um in die Gruppensituation hineinzuwirken, als in der Absicht, das unerhörte Geschehen einer größeren Oeffentlichkeit gegenüber zu deuten.
Damit aber sind wir bei Johannes Weidenheim angelangt, der, innerlandsmannschaftlich gesehen, nicht nur eine neue literarische Richtung verkörpert, die die Leerlaufperiode der Adam-Müller-Guttenbrunn-Epigonen unwiderruflich zum Abschluß bringt, sondern — ungewollt — auch zum Symbol einer aus dem Minderheitenrahmen herausgewachsenen politischen Dissidenz der jüngeren Generation geworden ist. Die Donauschwaben sind eine Entdeckung der'Wissenschaft. Kein Wunder, daß im Zeitalter der nationalen Wiedetgeburtsbewegun- gen sich konservativ-nationale Vorstellungen vom Wesen dieses Volkstums in der größeren Oeffentlichkeit festigten, deren Klischeehaftigkeit offenbar wurde, als sich die professorale Romantik an dem wie vom Fieber geschüttelten Leben verflüchtigt hatte. Das „Wagnis Weidenheim“ war zunächst ein leidenschaftlicher Protest gegen das Klischee, gegen die Scheinromantik im Getto, gegen Staffagepolitik, Hochstapelei, geistige Großmannssucht, neureiche Arroganz und politische Reaktion. Es war aber mehr noch, ein ergreifendes Bekenntnis zur Menschlichkeit. So revolutionär in der donauschwäbischen literarischen Tradition, die bis in die kleinsten Details der Darstellungen der Charaktere und sogar in der Themenwahl auf vorgefaßte Schemen ausgerichtet war, daß auch der politische Widerspruch nicht ausbleiben konnte. Bezeichnend genug, daß den großen politischen Schlag gegen Weidenheim der Siebenbürger Sachse Hans Hartl (München) geführt hat, der in der bundesdeutschen Vertriebenenpresse (Vertriebenen-An- zeiger, Kulturpolitische Korrespondenz, Sieben- bürgische Zeitung) einen bestimmenden Einfluß insofern ausübt, als er ein Rechtfertigungskonzept vertritt, das die Vertriebenen weitgehend mit dem Odium belastet, als ob gerade sie Ursache hätten, den Nationalsozialismus zu verharmlosen und zu verteidigen. Einen schlechteren politischen Dienst kann man gerade den Vertriebenen, die — abgesehen von den paar Nutznießern des Regimes — im wahrsten Sinne des Wortes Opfer des Nazismus sind, wohl kaum erweisen. Weidenheim aber geht seinen Weg unbeirrbar weiter. Seine Romane („Treffpunkt jenseits der Schuld , „Der verlorene Vater , „Das türkische Vaterunser“. „Sommerfest in Maresi u. a.) gehören zum festen Bestand der deutschen Gegenwartsliteratur. Und weil es der Geist ist, der Spannungen auslöst und Bewegungen entfacht, wirkt er bereits heute nachhaltiger auch in den landsmännischen Rahmen hinein, als manche Apparatschiks, die sich mit der den Unzufriedenen eigenen Hemmungslosigkeit als tragende und treibende Kräfte empfinden.
-s
Das beherrschende donauschwäbische Kollek- tiverlebnis nach 1945 war die Begegnung der Exilgruppe im europäischen Westen mit dem US-Donauschwabentum, dem in der interessanten Gestalt des 1923 aus Sekitsch in der Batschka ausgewanderten Peter Max Wagner d i e starke politische Persönlichkeit erwuchs. Mit einem weder erwarteten noch in ihrem potentiellen Ausmaß erahnten Einsatz kamen der Gemeinschaft in den Notjahren Kräfte zugeflossen, die sich über die karitative Hilfsbereitschaft hinaus fruchtbar auswirken würden, wenn nicht Organisations- und Führungsstreitigkeiten in Europa den großen Anlauf gehemmt hätten. Während einem die Entwicklung die Erkenntnis förmlich aufnötigte, daß es angesichts der umfassenden Ost-West-Ausein- andersetzungen nur noch von Washington oder Moskau aus möglich sein wird, die politischen Anliegen der Gesamtheit zu vertreten, die von der österreichischen DAG namentlich durch deren maßvollen Vorsitzenden Ing. R e i m a n n vorangetriebenen Konstituierung eines „Rates der Donauschwaben" in greifbare Nähe gerückt schien und damit endlich der autorisierte Sprecher der ganzen Gruppe herausgestellt worden wäre, dem in gruppeneigenen Fragen sicherlich auch international ein Gewicht zufallen könnte, entstanden Unstimmigkeiten darüber, ob es nicht zweckmäßiger wäre, die politischen Gruppenanliegen von Bonn aus zu vertreten. Diese Ueberlegungen, die wohl manches für sich haben, wenn das Donauschwabenproblem als innerdeutsche Angelegenheit aufgefaßt wird, gingen vor allem von Franz Hamm aus, dessen Einfluß auf die landsmannschaftspclitische Linienführung unserer Gruppe in Deutschland ausschlaggebend sein dürfte. Neben ihm sind aber auf bundesdeutschem Boden so ausgesprochene Gegenkräfte wirksam wie der Sprecher der Ungarndeutschen Heinrich R eiti n g e r, der jedwede donauschwäbische Zusammenfassung ablehnt, wohl in erster Reihe, um die Unabhängigkeit seiner auf ein Minimum zusammengeschmolzenen Gefolgschaft zu wahren. Sein Gegengewicht auf ungarndeutscher Ebene ist der württembergisch-badische Landtagsabgeordnete Dr. Ludwig Leber (CDU), der die Masse der vertriebenen Ungarndeutschen hinter sich haben dürfte.
Was hinter dem Eisernen Vorhang mit den Donauschwaben vor sich geht, darüber besitzen wir nur ein bruchstückartiges Bild, da die normierte Vertriebenenpolitik, in die Schablone der Ost-West-Propaganda hineingezwängt, ein systematisches Studium der Ereignisse und Vorgänge drüben wesentlich beeinträchtigt. Kaum eine landsmännische Stelle, die das Geschehen verfolgt, die Presseprodukte sammelt und studiert. Die Gruppe als solche hier im Westen hat sich damit weitgehend der Funktion begeben, die ihr schon aus der Tatsache zufiele, daß sie, zweigeteilt, Wesenhafteres aussagen könnte, wenn sie sich jenseits einer Schwarz-Weiß- Malerei um eine Deutung bemühte. Während, vor allem in Deutschland, das politische Konzept der Donauschwaben weitgehend auf eine simple Lastenausgleichsformel reduziert ist, gedeiht, in Rumänien etwa — allerdings unter anderen politischen Vorzeichen —, doch auch ein politisches Donauschwabentum, von dem wir kaum mehr als die Namen einiger Akteure wie Stoffel und G e 11 z kennen.
Es scheint in dieser Situation alles weniger denn Ueberschätzung der eigenen Bedeutung, wenn hier der Verselbständigung in eigenen politischen Gruppenangelegenheiten das Wort geredet wird. Wie wir uns' endlich von der Vorstellung lösen müssen, unsere geistige Aufgabe bestünde darin, gewisse Lücken in der Erforschung deutscher Kulturleistungen im Südosten, etwa von heimatkundlichen Aspekten aus der Schau von Groß-Jetscha, Bukin oder Vinkovci zu schließen, werden wir unserer zeitgeschichtlichen Aufgabe nicht gerecht, wenn wir es versäumen, bei aller Bescheidung unsere politischen Anliegen zu formulieren. Diese aber gehen weit über ein mit viel Pathos und oft wenig Ueberzeugungskraft vorgetragenes Wiedergutmachungsprogramm hinaus. Lediglich jene donauschwäbische Gruppierung, die das Konzept einer selbständigen und unabhängigen Woj- wodina — zusammen mit eingesessenen Serben, Kroaten, Ungarn, Rumänen, Bunjewatzen und Schokatzen — vertritt, hat bisher so etwas wie eine politische Atmosphäre schaffen können. Nicht ganz abwegig, wenn sich daher die Jüngeren mit dem Vorwurf von einer Art „Altersheimpolitik“ kritisch zu Wort melden. Eineinhalb Millionen Menschen kann man nicht in ein kulturpolitisches Museum abschieben, wenn an dem durch tausend Wunden blutenden, durch eine Kette von Irrunsen und Wirrungen geläuterten Volkskörper alles nach Deutung der Er-
elgnisse und nach Gestaltung der Gegenwart drängt. Hier liegen für eine verantwortungsbewußte Führung die eigentlichen politischen Aufgaben, die unmöglich übersehen werden können, wenn man davon erfüllt ist, daß auch unserer Volksgruppe im göttlichen Schöpfungsplan eine, wenn auch bescheidene, immerhin aber eine Rolle zugedacht wurde.



































































































