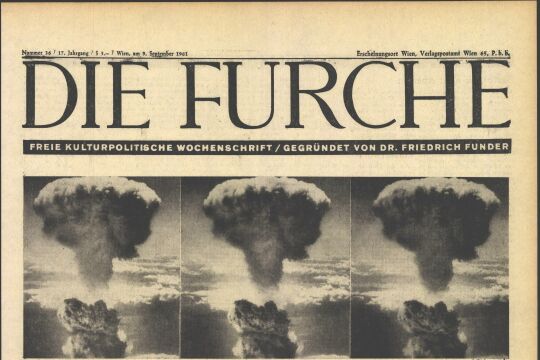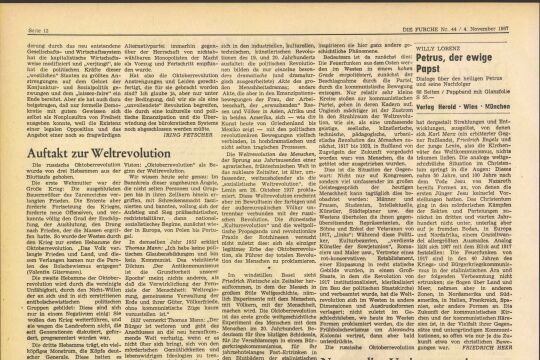Was blieb von der Revolution?
Uberall in der Sowjetunion, in der Nähe des Moskauer Kremls genauso wie in den Außenquartieren der Hauptstadt, in Leningrad wie in Novosibirsk, in Taschkent und in Tiflis, schießen Lenin-Plakate und Spruchbänder mit Lenin-Zitaten aus dem Boden. Der hundertste Geburtstag des „Begründers der proletarischen Partei neuen Typs“, des „Theoretikers und Führers der sozialistischen Revolution“, wirft seine bunten Schatten voraus.
Uberall in der Sowjetunion, in der Nähe des Moskauer Kremls genauso wie in den Außenquartieren der Hauptstadt, in Leningrad wie in Novosibirsk, in Taschkent und in Tiflis, schießen Lenin-Plakate und Spruchbänder mit Lenin-Zitaten aus dem Boden. Der hundertste Geburtstag des „Begründers der proletarischen Partei neuen Typs“, des „Theoretikers und Führers der sozialistischen Revolution“, wirft seine bunten Schatten voraus.
Die ältere Garde, die die Revolution des Jahres 1917 noch bewußt erlebt hat oder wenigstens aus eindrucksvoller Schilderung durch den Vater kennt, sieht in Lenin in erster Linie den erfolgreichen Revolutionär, der in einer sozial und politisch festgefahrenen Situation das Steuer herumwarf. Sie argumentiert zugunsten Lenins aus der damaligen Lage Rußlands heraus, das extrem alle sozialökonomischen Widersprüche „zwischen Arbeit und Kapital, zwischen dem sich entwickelnden Kapitalismus und bedeutenden Überresten der feudalen Leibeigenschaft, zwischen den hochentwickelten Industriebezirken und den zurückgebliebenen Randgebieten“ aufwies. Die jungen Sowjetbürger aber sehen in Lenin vor allem den Gründer des Staates, den er allerdings selbst als „eine Maschine zur Aufrechterhaltung der Herrschaft einer Klasse über eine andere“ bezeichnet hatte. Letzten Endes aber lassen sich die scheinbar divergierenden Aspekte in Wirklichkeit nicht trennen. Der Revolutionär und der Staatsgründer sind ein und dasselbe, hat doch die Revolution dazu beigetragen, einen neuen Staatstypus zu formen und zu schaffen. Die Frage bleibt offen, wie weit sich dieser „neue“ Staat durchzusetzen und wie weit er — aus einer gewissen Eigengesetzlichkeit heraus — zu den Nachteilen der Vergangenheit zurückgeführt hat.
Der neue Apparat
Lenin selbst hatte die Schwierigkeiten erkannt und zugegeben, daß es um den Staatsapparat „derart traurig, um nicht zu sagen abscheulich“ bestellt sei, und daraus die „Aufgabe der Umgestaltung“ des Staatsapparates, „der gar nichts taugt“, abgeleitet.
Taugt denn, um beim Wort Lenins zu bleiben, auch dieser neue, proletarische Staatsapparat nichts? Auf alle Fälle hat das halbe Jahrhundert seit der Oktoberrevolution gezeigt, daß die Grundvoraussetzungen, die aus der Mentalität der Völker, aus den Gegebenheiten des Bodens und aus der geschichtlichen Entwicklung resultieren, in vielen Punkten stärker waren als jede Ideologie. Nur wäre es falsch, daraus ableiten zu wollen, der Sowjetbürger unterhalte zu seinem Staat die gleichen Beziehungen wie vor der Revolution etwa ein russischer Muschik zum zaristischen Reich. Die „Diktatur des Proletariats“, wie sie nach dem Zusammenbruch des Parlamentarismus von Lenin 1917 ausgerufen wurde, ist zwar nicht etwa der ideologische Traum eines jeden Sowjetbürgers, aber der Staat bleibt ihm doch nicht eine weltferne Macht, die er nur in verbietenden Ukasen und strafenden Urteilen zu spüren bekommt, sondern es ist auch jene Organisation, die ihn ausbildet, die ihm das Studium ermöglicht, die ihm soziale Sicherheit gewährt. Natürlich empfindet er auch diesen „seinen“ Staat in Form von freiheitsbeschränkenden Erlassen, von Zwangsmaßnahmen und die Persönlichkeit einengenden Verfügungen. Die Distanz aber ist überwunden. Daß die jüngere Generation da und dort innerlich über diese oder jene Entscheidung unzufrieden ist und sich sogar mit bissigen Worten zu mokieren beginnt, ist ein Zeichen einer gewissen Integration.
Demokratie für den Sowjetbürger
Eines ist im Verhältnis des Sowjetbürgers zu seinem Sowjetstaat nicht zu vergessen: daß hiesige Maßstäbe nicht angelegt werden dürfen. Woher soll der einfache russische Arbeiter, dessen Großvater als Muschik von den Feudalherren unterdrückt worden war, dessen Vater dann in der stalinistischen Periode von Diktatur und Krieg gelebt hat, und der selbst jetzt erst seit ganz wenigen Jahren das Gefühl bekommt, die Nachkriegsnot überwunden zu haben, woher soll dieser Mann wissen, was Demokratie wirklich ist und sein kann? Daß er mitverantwortlich sei für die Geschicke seines Landes und selbst mitregieren könne, sagen westliche Theoretiker. Und die Antwort? Vielfach ein verständnisloses Lächeln. Regieren will dieser Mann ja gar nicht, er ist zufrieden, wenn man ihn leben läßt, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, sogar noch besser zu leben, und wenn er allmählich über gewisse Probleme seines eigenen Lebens selbst entscheiden kann.
Falsche Maßstäbe des Westens
Die Sowjetunion, so schätzt man, zählt etwa 240 Millionen Einwohner. 1914 waren es noch 175 Millionen, und diese Steigerung von über vierzig Prozent ist noch imposanter, wenn man bedenkt, daß etwa 22 Millionen während des zweiten Weltkrieges unter den deutschen Bomben oder als Folge der katastrophalen Hungersnot ihr Leben -ver-loren und schätzungsweise an die achtzehn Millionen während den verschiedenen Revolutionen von 1914 bis 1917, während des anschließenden Bürgerkrieges und im Laufe der stalinistischen Säuberungen ihr Leben einbüßten. Wenn man sich schließlich vergegenwärtigt, in welchem Stadium sich die Wirtschaft unter der Zarenherrschaft befand, wie sehr ihre Entwicklung unter Stalins Gewaltherrschaft nachher wieder gelitten hat, und daß die Industrie — fast ausschließlich im Westen beheimatet — während des deutschen Einmarsches weitgehend zerstört wurde, so wirkt der ökonomische Fortschritt, der in den letzten Jahren festzustellen ist, nicht gering.
Natürlich wird man entgegenhalten, daß ein solcher Fortschritt vielleicht für Moskau und Leningrad, allenfalls noch für andere große Städte des westlichen Teiles dieses Riesen-reiches zutreffe, jedoch in den Kleinstädten oder Dörfern Zentralasiens nicht mehr festzustellen sei. Dies stimmt weitgehend, nur ist es falsch, von dort aus den Vergleich mit europäischen Verhältnissen zu ziehen.
Hierin liegt wohl die große Schwierigkeit des außenstehenden Beobachters, der Rußland — und zwar immer nur seinen westlichen Teil — mit der Sowjetunion identifiziert und deshalb unsere ungültigen Maßstäbe anwendet. Gerade von dieser unermeßlichen Weite aber ist Lenin selbst ausgegangen, als er sagte: „Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes.“ Natürlich ist die Elektrifizierung noch nicht perfekt, aber die Grundlage ist gelegt. Ein riesiges Verbundsnetz von Überland-Gleich-und Wechselstromleitungen ermöglicht die Energie-Übertragung der Wärme- und Wasserkraftwerke vom Baltikum bis an den Baikalsee, und die Verästelung in die sibirische Weite und ostwärts bis Wladiwostok ist geplant oder bereits im Bau.
So erlebt dieses Land die zweite Stufe des technisch-wirtschaftlichen Fortschrittes, nachdem der Ausbau des Bahnnetzes die erste Phase angekündigt hatte. Der technische Fortschritt hat schließlich — als die Transsibirische Eisenbahn gebaut wurde, wie später beim Bau der großen Kraftwerke mit der Realisierung des riesigen Stausees am Ob — zur sozialen Entwicklung beigetragen. Genauso wie es falsch ist von den Kommunisten, allen Fortschritt auf die Fahne ihrer Weltanschauung zu schreiben, ist es vom Westen aus verfehlt, immer die Mängel unweigerlich dem Kommunismus zuzuschreiben. Objektiv gesehen, rechtfertigen diese aber höchstens die Feststellung, daß es dem Kommunismus nicht gelang, in einem halben Jahrhundert zu realisieren, was der Kapitalismus in etwa zweihundert Jahren erreicht hat. Schaffen diese Unzulänglichkeiten aber im Volk eine spürbare Unruhe?
Um darauf zu antworten, muß man unterscheiden. Je weiter ostwärts man im Sowjetreich blickt, um so mehr schätzt man — wenn Verallgemeinerungen überhaupt erlaubt sind — den erreichten Fortschritt. Das mächtige Textilkombinat in Taschkent mit seinen sechstausend vollautomatischen Webstühlen macht jeden stolz, der direkt oder indirekt damit zu tun hat. Ebenso ergeht es dem Wolgafischer, der nun in Uljanowsk oder in Wolgograd Schuhe und Kleider kaufen kann nach Lust und Laune.
Anders ist es bereits in Moskau oder Leningrad. Dort beginnt vor allem die junge Generation wählerisch zu werden. Sie hat es satt, immer die Ausreden mit dem Hinweis auf den „Vaterländischen Krieg“ zu hören. Wenn die wirtschaftlich-soziale Not vor mehr als fünfzig Jahren eine Unzufriedenheit auslöste, die schließlich in die Revolution mündete, so beginnt sich heute in den westlichen Großstädten eine Unzufriedenheit des Wohlstandes bemerkbar zu machen. Sie wird zweifellos keine Erschütterung auslösen wie damals, sie kann aber auf lange Sicht gesehen den Staat und dessen Ideologie zwingen, umzudenken. Daraus aber gar abzuleiten, man dürfe eine Rückkehr zum „Kapitalismus“ erwarten, wäre töricht und gefährlich. Schon Marx und Engels hatten betont: „Unsere Theorie ist kein Dogma, sondern eine Anleitung zum Handeln!“ Und Lenin hat dieses Wort bewußt mehrmals aufgenommen.
Die bessere Variante
Niemand wird bestreiten, daß es den heutigen Menschen in der Sowjetunion besser geht als jenen, die zur Zeit der Zaren unter dem Feudalkapitalismus dahinlebten. Die Behauptung, diese Besserstellung wäre auch ohne Kommunismus gekommen, ist müßig.
Wichtiger ist die Frage, was der Preis war, den die Völker der Sowjetunion zu bezahlen hatten. Galt es etwa gar, dafür die Freiheit zu opfern? Wenn dem so wäre, müßten die heutigen Sowjetführer eingestehen, daß es ihnen nicht gelungen ist, die Ideen Lenins zu verwirklichen.
Freiheit ist eben etwas Abstraktes, und ihre Konkretisierung muß naturnotwendig zu dieser oder jener Einschränkung führen. Lenin ging in seinen Gedanken von der Unterdrückung der Bauern durch die Grundherren und von der Knechtung der Arbeiter durch die ausbeutenden Industriemagnaten aus. Er ging aber, und darin wird der Unterschied der Auffassungen und der Terminologie noch deutlicher, auch im Begriff Demokratie von der damaligen russischen Situation aus. „Demokratie für eine verschwindende Minderheit“, so sagte er in einer 1917 in Helsingfors geschriebenen Studie, „Demokratie für die Reichen — das ist der Demokratismus der kapitalistischen Gesellschaft.“ Für das zaristische Rußland stimmte diese Formulierung voll und ganz, und selbst einige westliche Demokratien waren Ende des letzten und anfangs dieses Jahrhunderts noch nicht allzu weit von dieser Darstellung entfernt. Für Lenin besteht, und darin hat er objektiv recht, die Demokratie in der Herrschaft der Mehrheit.
Die Einschränkung der Freiheit wie sie als Folge der Revolution zu verzeichnen ist, war eine ideologische. Die siegreichen Revolutionäre wollten alles vermeiden, was die eben errungene Veränderung hätte gefährden können. Am deutlichsten erkennbar wird diese Behauptung in der Art, wie man sich der Pressefreiheit gegenüber verhält. Schon 1905 hatte Lenin verkündet: „Die Freiheit des Wortes und der Presse soll vollständig sein!“ In der gleichen Schrift aber betonte er: „Die Zeitungen müssen Organe der verschiedenen Parteiorganisationen werden. Die Literaten müssen auf jeden Fall den Parteiorganisationen angehören. Die Verlagsunternehmungen und Lager, die Läden und Lesezimmer, die Büchereien und verschiedenen Buchhandlungen — alles muß der Partei unterstehen ...“ Genau dies ist heute in der Sowjetunion der Fall, ein nach unserer Auffassung unhaltbarer Zustand.
Was aber ist gesellschaftspolitisch besser: eine restlos der Partei untergeordnete Presse, verbunden mit einer auf breiter Basis garantierten Ausbildung des Volkes — oder aber eine nach westlich-kapitalistischer Auffassung freie Presse in einem Staat wie dem zaristischen, der die höheren Schulen nur einer kleinen Oberschicht offenhielt? Wer der ersten, jetzt in der Sowjetunion praktizierten Lösung den Vorzug gibt, darf sich nicht wundern, daß die breite Masse des Sowjetvolkes diesen Einschränkungen der Pressefreiheit gegenüber kaum reagiert. Wirklich zu denken beginnen nun jedoch gewisse intellektuelle Kreise. Sie diskutieren über die „verschiedenen Wege des Kommunismus“ und nicht selten kann man in freimütigen Gesprächen die Meinung hören, Duböeks politische Linie sei — genau wie jene Titos — die richtige und vollauf sozialistische Linie. Nur fügen auch diese Intellektuellen immer wieder das Bedenken an, ob nicht doch das tschechoslowakische Experiment — nicht aus ideologischer, sondern aus strategisch-politischer Überlegung — eine Gefährdung für den Weltfrieden hätte werden können. Der Wunsch nach Friede — in den breiten Massen unartikuliert, aber deutlich erkennbar — ist auch das Leitmotiv der eigenwillig denkenden Intellektuellen. Ihm sind selbst sie bereit, gewisse Freiheiten zu opfern.
Lenin, der anpassungfähig war, wo ihm die Anpassung im Interesse des Volkes notwendig erschien, könnte sich vielleicht sogar mit einer Formulierung wie der folgenden einverstanden erklären: „Die Zukunft des Sozialismus hängt heute davon ab, ob es gelingen wird, ihn anziehend zu machen, ob sich die moralische Anziehungskraft der Idee des Sozialismus und der Arbeitsintensivierung als Gegengewicht gegen das egoistische Prinzip des Privatbesitzes und der Kapitalvergrößerung behaupten kann als ein entscheidender Faktor bei der ethischen Bewertung des Kapitalismus und des Sozialismus, ob die Menschen im Zusammenhang mit Sozialismus nicht in erster Linie an eine Beschränkung der geistigen Freiheit oder, schlimmer noch, an faschismusähnliche Kultregime denken werden.“ Der so sprach ist Andrej D. Sacha-row, geboren 1921. Nach Kriegsende hatte er am Lebedew-Institut für Physik gearbeitet und mit 32 Jahren war ihm die höchste sowjetische wissenschaftliche Auszeichnung zuteilgeworden, indem man ihn zum Mitglied der Akademie der Wissenschaft erkoren hatte. „Jeder ehrliche und denkende Mensch“, so schloß er seine Ausführungen, „der nicht durch spießbürgerliche Gleichgültigkeit vergiftet ist, strebt zu einer Entwicklung nach der ,besseren' Variante hin. Aber nur eine offene Diskussion in breiter Öffentlichkeit ohne den Druck der Angst und der Voreingenommenheit wird den meisten Menschen helfen, die richtige und die beste Handlungsmethode zu finden.“