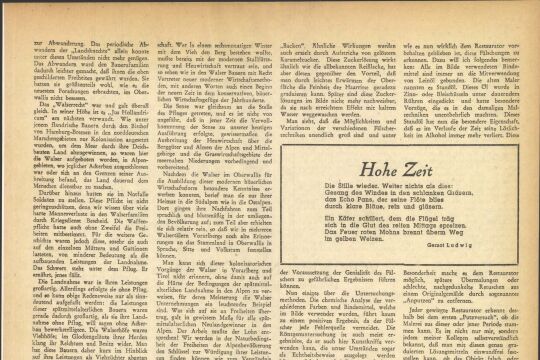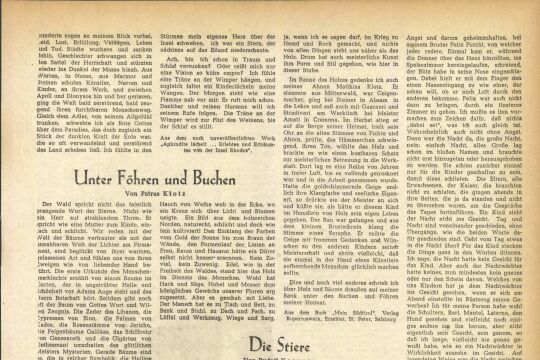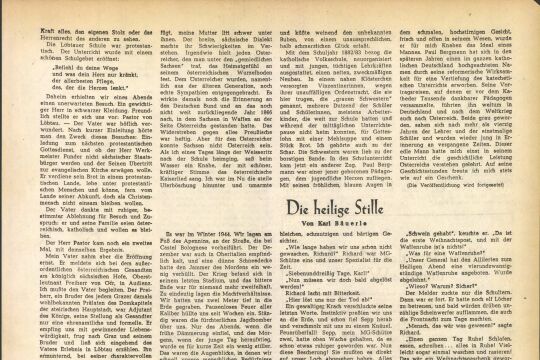Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Wer flieht, wird erschossen
An einem Novembervormittag des Jahres 1938 war Vaters Schwester, eine fast 80jährige Postbeamtin i. R., zu meinen Eltern nach Währing gekommen, wo auch meine Frau und ich wohnten. Sie warnte, voll Sorge um das Schicksal ihrer Neffen, meinen jüngeren Bruder Fritz und mich: Sie habe gehört, daß „man in Wien umhergehe und die jüdischen Männer gefangennehme, wobei auch nach Waffen gesucht werde”.
Nun hatte mein ältester Bruder Karl, der im Alter von 22 Jahren als Oberleutnant im ersten Weltkrieg fiel, noch einen alten Revolver zurückgelassen, der sich bei den Eltern befand. Man hatte ihn schon fast vergessen gehabt und übergab ihn nun den Nachbarsleuten zur einstweiligen Aufbewahrung. Nachmittags, nach 4 Uhr, kamen tatsächlich sechs oder sieben junge Leute in Zivil zu uns, die meinen Bruder, einen Bauingenieur, und mich aufforderten, mit ihnen zu gehen. Wir würden in einer halben Stunde wieder zurück sein, hieß es. Mein jüngster Bruder war nicht mehr zu Hause. Er war genau zehn Tage vorher mit einem „illegalen” Transport nach Palästina ausgewandert.
Letzter Blick zum Wohnhaus
Es war schon bitter kalt, als man uns abholte. Mein Bruder Fritz hatte in der Eile keine Dokumente mitgenommen, als wir die Wohnung der Eltern verließen. Im Heim deutscher Mediziner in der Gentzgasse im 18. Bezirk, wohin wir eskortiert wurden, waren schon viele Schicksalsgenossen versammelt. Von einer Rückkehr oder „Amtshandlung” war keine Rede mehr. Man wurde angebrüllt und angepöbelt, aber sonst ging es noch halbwegs erträglich zu. Es wurde uns sogar gestattet, um Nahrungsmittel zu schicken. So warteten wir Stunde um Stunde, und man wußte nicht, was geschehen werde. Endlich — es war schon um Mitternacht — wunden wir in großen Autocars abtransportiert. Als sien Lieben wohnten, warf ich noch einen sekundenlangen Bück zum Wohnhaus hin. Und ein „Gottbefohlen!” ging unhörbar hin, mußte ich doch auch meine Frau, die schwer fiebernd mit Angina zu Bette lag, zurücklassen.
Nun ging es zur Polizeireitschule in die Pramergasse im 9. Bezirk. Wohl an die 2000 bis 3000 Juden waren dort versammelt. Es war jetzt offenkundig, daß wir Gefangene waren, doch wußte keiner, was nun geschehen werde.
Dichter Staub war überall in der Reitschule, aufgewühlt von den vielen Menschen. Sie standen umher oder lagen auf dem Sand und atmeten die schwere Stickluft ein. Ich war glücklich, daß ich meinen Bruder Fritz bei mir wußte. Hie und da sah man ein Gesicht, das man von früher kannte. Die Nacht verging, und kaum einer schlief. Zu essen gab es nur trockenes Brot, auch Wasser konnte man haben.
Auch der nächste Tag neigte sich dem Ende zu. Und noch immer stand man umher oder lag auf dem Sande. Niemand kümmerte sich um uns. Es gab nur eine einzige Bedürfnisanstalt für tausende Menschen, und es war eine schreckliche Qual, sich stundenlang anzustellen, bevor man drankommen konnte. Und so kam wieder die Nacht. Verzweiflung keimte langsam auf. Kein Schlaf war zu finden.
Da rührte es sich draußen überm Hof. Man rief uns hinüber. Kolonnen bildeten sich, abmarschbereit. Zu welchem Ziel? Die strenge Stimme eines Polizeibeamten tönte auf: „Wer flieht, wird erschossen!”
Nur nicht nach Dachau!
Und nun mußte man mit Schnelligkeit in den „Grünen Heinrich” hinein, in den Polizeiwagen, und durfte nicht umherblicken. Noch vor einigen Wochen stand ich bei der Schule in der Karajängasse in der Brigittenau, wo mein jüngster Bruder Alfred gefangen war, und sah dieses klägliche Schauspiel. Bruder Fritz war noch bei mir. Wir hielten uns nahe aneinander. Der ..Grüne Heinrich” fuhr sehr schnell. Wir suchten durch die geschlitzte Wand den Weg zu erspähen, den das Auto nahm. Zur Not konnten wir die Straßen erkennen, es ging zum Gürtel. Es wird doch nicht der Westbahnhof das Ziel sein? O Gott, nur nicht nach Dachau ins Konzentrationslager! Fritz und ich blickten einander an. Da wendet jäh wieder das Auto und hält kurz nachher an. Man wurde hinaus und in ein offenes Tor hineingetrieben.
Trotz der Schnelligkeit, mit der alles vor sich ging, wurden wir gewahr, daß wir nicht beim Westbahnhof abgesetzt wurden. Es schien ein Schulgebäude zu sein, in das wir kamen. Durch einen Stiegengang wurden wir zum Turnsaal hinuntergejagt. Wir durften nicht miteinander sprechen. Ein einziger Wehr- machtssoldat bewachte uns. Nun mußten wir niederknien. Der Soldat sagte uns, daß in kurzer Zeit kein einziger von uns am Leben sein werde. Wir würden alle erschossen werden. Mein Bruder flüsterte mir noch zu, daß dies alles Komödie sei. Ich sah zum Fenster hin, es war sehr hoch, ein Turnsaalfenster. Die Sterne sah ich hoch am Himmel. Man hörte Schüsse fallen irgendwo im Haus. Ein zweiter Wächter kam herein. Es folgte ein Gespräch der beiden, das sich auf die Erschießung eines Häftlings bezog. Wir wußten nicht, was vorgegangen war. Einige von uns Knieenden fielen um. Angst und Seelennot bemächtigten sich der Menschen. Keiner durfte dem anderen helfen. Einige fingen zu phantasieren an. Ein Menschenleben zählte jetzt nicht mehr. Dann wurde es völlig Nacht. Wir durften uns niederlegen, und nun kamen auch menschlich klingende Worte vom Mund des einen Soldaten. Das tröstete uns ein wenig, daß es in der toll gewordenen Welt noch einen Menschen gab.
In der Rossauerlände
Die Zeit verging. Man wartete. Worauf? Befreiung? Gab es die überhaupt noch? Später wurden wir durch Gänge geführt, immer das Gesicht zur Wand gekehrt. So hatte man das Gefühl, jeden Augenblick könne man durch einen Schuß niedergestreckt werden. Ein oder zwei Tage nachher brachte uns der „Grüne Heinrich” zur Roßauer Lände in die Polizeizentralstation. Jetzt durfte man eine Wurst erstehen. Bisher gab es ja nur Brot und Wasser. Dann wieder stundenlanges Stehen mit zur Wand gekehrtem Gesicht. Zotige Fragen wurden von KÄ3S5S nach „rasseschänderischem” Verkehr mit „arischen” Mädchen. Fritz stand hinter mir, und ich versuchte zuweilen, mit meinen Fingern seine Hand zu berühren, um mich zu vergewissern, daß er noch da war. Endlich führte man uns zu einem Gang, wo schon viele angestellt waren. Ich ließ Fritz vor mich hintreten, so daß ich ihn wenigstens sehen konnte. Und nun öffnete sich eine Tür. Fritz kam daran, einzutreten.
Nach wenigen Sekunden kam ich an die Reihe. Kaum hatte ich einen Fuß in das Zimmer gesetzt, ergriff mich ein riesiger Mensch und schleuderte mich brutal in die Mitte des Raumes. Fritz sah ich nicht mehr. Ich wurde gefragt, wann und wohin ich ausreisen werde. Zum Glück hatte ich ein Schriftstück aus London bei mir, von einer jüdischen Flüchtlingsstelle ausgegeben, aus dem hervorging, daß für meine Frau und mich ein Dienstposten im Haushalt gesichert sei. Dann kam ich bed einer anderen Tür wieder hinaus. Fritz konnte ich nirgends erspähen. Er hatte ja keine Papiere mitgenommen und konnte so keine Ausreisemöglichkeit nachweisen.
„Turnübungen”…
Nun kamen wir in einen Hof. Ein Wächter war bei uns. Ich sah zu den beleuchteten, eisenvergitterten Fenstern hinauf. Nirgends war Fritz zu sehen. Der Wärter ließ es an Anspielungen nicht fehlen, daß wir nun ins Konzentrationslager kämen. Dann ging es im Auto wieder zur früheren Stätte zurück. Es war eine geistliche Schule, in der Kenyon- gasse, nicht weit vom Westbahnhof. Nacht für Nacht hörte man von den anderen Schulzimmern das Gebrüll der eigens aus dem Deutschen Reich herbeorderten SS-Verfügungstruppen. Dumpfes Stampfen und Dröhnen kam aus den benachbarten Zimmern, und man wußte, daß sich diese „Turnübungen”, dieses Auf- und Niederwippen, nun bald im eigenen Zimmer wiederholen werde. Und so war es auch. Viele konnten einfach nicht mehr mit und fielen um, von Herzkrämpfen befallen. Sie wurden mit Fußtritten und Faustschlägen traktiert. In einer Art Sanitätsstation durften ihnen jüdische Ärzte dann Hilfe bringen.
Jede Nacht wiederholte sich diese grausame Prozedur. Die Wiener Wachebeamten alten Schlages waren ehrlichen Mitleides voll und trösteten uns, so gut es eben ging. Aber helfen konnten sie nicht, durften sie nicht.
Nach acht Taigen Gefangenschaft durfte man seinen Leuten den Aufenthaltsort bekanntgeben. Liebesgabenpakete durften empfangen werden,, und am selben Tag f elt map die Freiheit. Inzwischen waren die Tempel Wiens niedergebrannt worden und die Friedhofszere- monienhallen angezündet.
Die sogenannte „Reichsknistall- nacht” vom November 1938, so furchtbar sie und die folgenden Tage auch waren, war jedoch nur ein verhältnismäßig „harmloser” Beginn der Verfolgungen gewesen, denen später Millionen unschuldiger Juden zum Opfer fielen.
Auch meine beiden vorerwähnten Brüder befanden sich unter ihnen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!