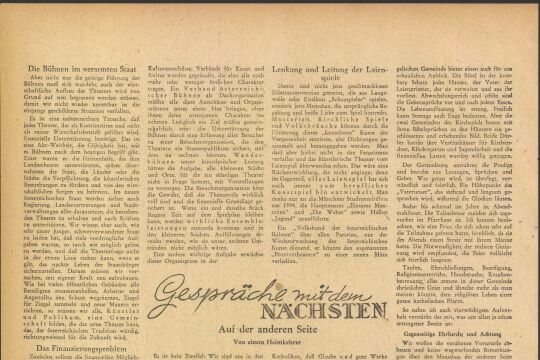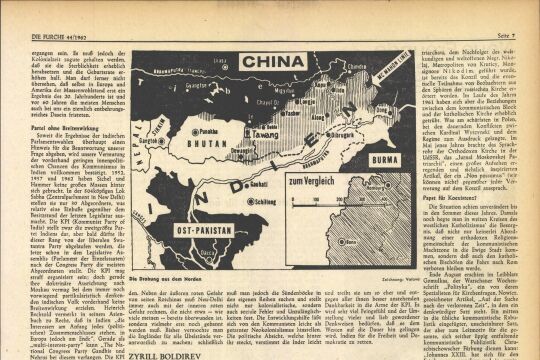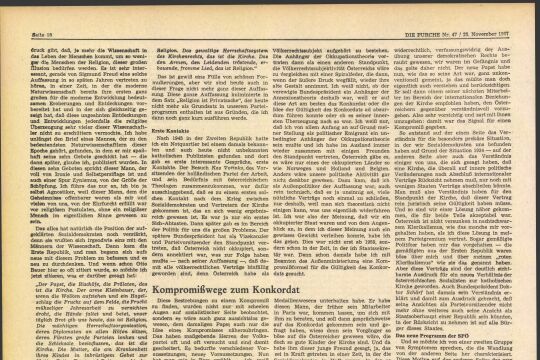Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wie der Kriegsgefangene in USA die Kirche sah
Einige schon in der „Furche“ erschienene Briefe zu diesem Thema werden in bemerkenswerter Weise durch die nachstehenden Ausführungen ergänzt.
Der Kriegsgefangene fühlt sich als ein Mensch zweiter Ordnung. Nur der kirchliche Raum — buchstäblich und im weiteren Sinn — kann ihm dieses Gefühl nehmen: er steht auf einer Ebene mit der anderen Welt, von der er durch Stacheldraht getrennt ist. Wie es wenigstens in einem Durchgangslager in Pennsylvanien war: wir erfuhren Strenge, wir waren nach Kriegsende lange ohne Nachricht und von der Außenwelt völlig geschieden. An den sommerlichen Abenden, nach der Arbeit im Holz, stellten die Kriegsgefangenen untereinander ihre unaufhörlichen Fragen: nach dem Brot, nach der Familie, nach der Zukunft. Und manche hatten noch den anderen Hunger und fragten nach Christus. Unter uns war kein katholischer Priester. Als es gestattet wurde, kam einer aus der benachbarten Stadt. Es' war unsere erste Begegnung mit jener anderen Welt, der freien Welt, von der wir' ausgeschlossen waren (viel mehr noch dies als „eingesperrt“); Posten, Unteroffiziere, Lagerkommandant waren streng auf Abstand bedacht. Der Geistliche, dem die heilige Messe im Lager gestattet worden war„ hatte uns gegrüßt: „Gott segne euch!“ War es der Gruß des Bürgers der Vereinigten Staaten an die Kriegsgefangenen der feindlichen Wehrmacht? Oder war es vielmehr der Gruß der Una sancta, in der die vertrauten Beziehungen nicht durch Krieg, Feindschaft, Stacheldraht getrübt werden können? Auf einem Schiffstransport nach Amerika wurde der kriegsgefangene katholische Priester vom Unterdeck gerufen; bei der heiligen Messe im Gesellschaftsraum diente einer der Offiziere. Im Baumwollerntelager in Louisiana stand bei der Sonntagsmesse hinten der zweite Lageroffizier; zur Kommunion kam er nach vorn. Der Priester, Pater Sigismund aus Würzburg, war Gefangener wie wir. Die Macht des Staates hat sieh nichts vergeben dabei, vor- und nachher waren wir nichts als Kriegsgefangene. In der einen Stunde nur übten wir aus das Bürgerrecht des anderen Reiches.
In den Lagern war manchmal der Ton zu hören: nun sind wir in jenem Westen, wo so viel vom Christentum gesprochen wird, es gibt überall Kirchen und Gottesdienst, wir aber sind in harter und langer Gefangenschaft, wer kümmert sich um uns? Die katholische Kirche in den Vereinigten Staaten hat den Kriegsgefangenen gegenüber getan, was ihr möglich war. Wo im Lager unter den Gefangenen kein Priester war, sind die amerikanischen Geistlichen mit aller Liebe der seelsorglichen Betreuung nachgekommen, waren es nun Militärgeistliche oder solche der nächsten Pfarre oder Ordensleute. Es ist der katholische Diözesanbischof ins Lager gekommen, um die heilige Firmung zu spenden. Die National Catholic Weifare Conference widmete das „Katholische Gesang- und Gebetbuch für die kriegsgefan-genen deutschen Soldaten“, widmete das Neue Testament in der Ubersetzung von Rösch, widmete eine Sammlung der Reden des Heiligen Vaters für den Frieden, woraus so mancher zum erstenmal erfuhr, daß Rom zu den schonungslosen Kriegsmethoden durchaus nicht geschwiegen hat. Diese Druckschriften waren auch äußerlich hervorragend, hierin also nicht Almosen, sondern Geschenk, und wurden in vielen Tausenden von Exemplaren verteilt. Da ist noch zu erwähnen „My Sunday Missal“ in englischer Sprache, das sehr beliebte „Soldaten-Meßbuch“ — ursorünglich für die deutschsprechenden Soldaten in der amerikanischen Armee — und das vollständige Missale romanum.
Und nun würde aus jedem Lager ein anderer berichten, daß dies und jenes noch in der Aufzählung fehlte, vor allem die katholischen Zeitungen und Zeitschrift e'n, die am Sonntag beim Gottesdienst verteilt wurden. Hier war uns ein Bück in das Leben der katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten gegönnt. Das gab es also noch; ein katholisches Familienblatt, von der Gesellschaft des Göttlichen Wortes herausgegeben, so reich und lebendig wie ehemals die „Stadt Gottes“ lange vor dem Kriege. Dann gab es katholische Wochenschriften, wie den „Wanderer“ oder die „Nordamerika“, um nur deutschsprachige zu nennen. „Um der Gerechtigkeit willen schreibt nach Washington“ überschrieb damals eine von diesen Zeitungen eine Aufforderung an ihre Leser, an den Präsidenten zu schreiben oder an einen anderen der höchsten Männer des Staates: es möge endlich die Sendung von Paketen in die ehemaligen Feindstaaten gestattet werden. Diese Aufforderung erschien Woche für Woche in großer Aufmachung, in dringendem Ton mit dem Hinweis, daß der Erfolg nicht ausbleiben könne, wenn nur ein bedeutender Teil der Katholiken nach Washington schreibe, oft und täglich schreibe; es nötige dazu die höchste und letzte Verantwortung vor dem Richter der Welt. Dann folgten noch einige Vorschläge zum Text des Briefes, höflich im Ton, energisch im Inhalt. Ein anderes Mal war in einem Leitartikel die sonderbare Frage aufgeworfen: Wenn man durch Schweigen mitschuldig wird, wenn man sich wundert, daß am Ende dieses Krieges so mancher „nichts gewußt“ haben will — wer könnte dann, wenn es darauf ankäme, behaupten, er habe von dem furchtbaren Bombenkrieg — nichts gewußt? Man muß sich das Wagnis, so vor aller Öffentlichkeit zu schreiben, in einem beliebigen anderen Staat vorstellen. Gewiß besteht in den Vereinigten Staaten die wirkliche Pressefreiheit. Sie wurde von den Katholiken jedesfalls mit glühendem Eifer dazu benützt, im großen Lärm der öffentlichen Auseinandersetzungen die Stimme der Gerechtigkeit laut werden zu lassen. Und es wird bis zum Ende der Tage wahr bleiben, daß die katholische Kirche auch im Siegerstaat tat, was an ihr lag, damit der Vorwurf sie nicht treffe: ich war hungrig und ihr habt mich nicht gespeist! Hier ist auzufügen, daß auch die anderen christlichen Konfessionen in Amerika dem geschlagenen Feind gegenüber die christliche Liebe verlangten.
Die Vereinigten Staaten sind kein katholisches Land, man kann kaum von einem christlichen Land sprechen: von 135 Millionen Einwohnern schätzt man 55 — kaum die Hälfte — aktive Kirchenmitglieder, darunter 23,4 Millionen Katholiken. Die Kirche ist auf sich gestellt. Sie hat ihre meisten Anhänger nicht unter den Millionären,“ sondern tinter den kleinen Leiften, nicht die wenigsten unter den Negern. Ist nicht vielerorts das Gleichnis vom Gastmahl wahr geworden, bei dem die Armen von der Straße zu Tische sitzen, weil den zuerst Geladenen alles andere wichtiger war?
Aber die Kirche lebt. Zuweilen wird sie auch in der amerikanischen Öffentlichkeit respektiert: als im Februar dieses Jahres die
Kardinalsernennungen erfolgten, waren die Zeitungen und Magazine voll von Bildern und Berichten, von dem Empfang abgesehen, den man Kardinal Spellmann in der Metro-politanopera bereitete. Die Berichte waren nicht frei vom Drang nach dem Sensationellen. Die Frage, wie einem Kardinal die cappa magna angemessen wird oder in welcher Reihenfolge die Kardinäle einzogen, wurde ausführlich besprochen; und unter dem ganzseitigen Bild, das die weitverbreitete Bilderzeitschrift „Life“ von Pius XII. als „Bild der Woche“ brachte, war von den Gewändern und dem Thron des Papstes mehr die Rede als von seiner Persönlichkeit.
Die Welt sieht die Kirche eben von außen. Von innen sahen sie nur die stillen Beter in den Gotteshäusern, die Ordensleute, die Gläubigen und die Bekennenden, denen an allem Äußeren am Ende wenig liegt. In ihnen lebt die Kirch-. Ihrer sind in Amerika nicht wenige. Denn es war dies Leben der Kirche auch hinter dem Stacheldraht zu spüren. Und was war nun alles Harte, alles Ausgeschlossensein und aller Abstand von jener anderen, der freien Welt — \vas war dies alles dagegen, daß vor dem notdürftig errichteten Altar nun eben der katholische Priester erschien im vertrauten Gewand und daß er, ob Amerikaner oder selbst Gefangener, mit ausgebreiteten Armen sprach: „Betet, Brüder“?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!