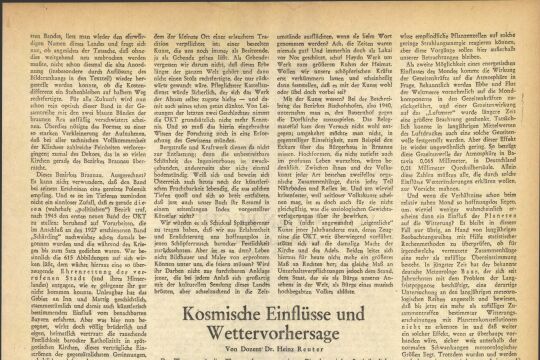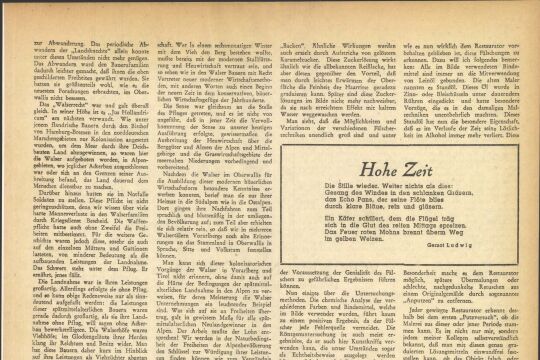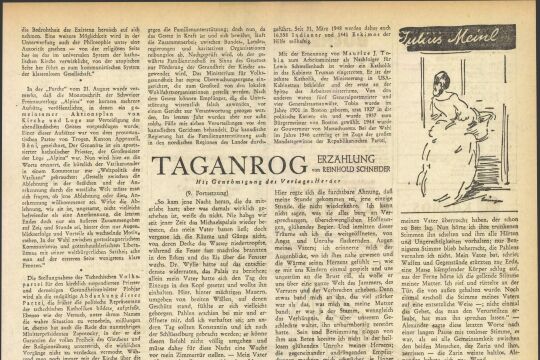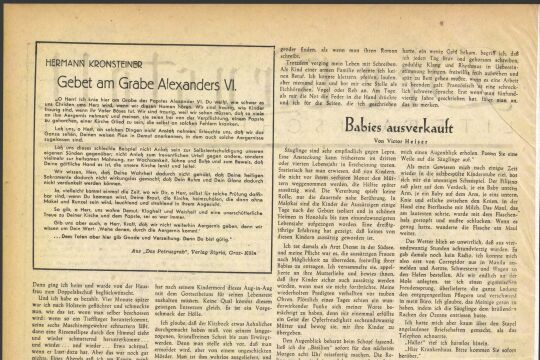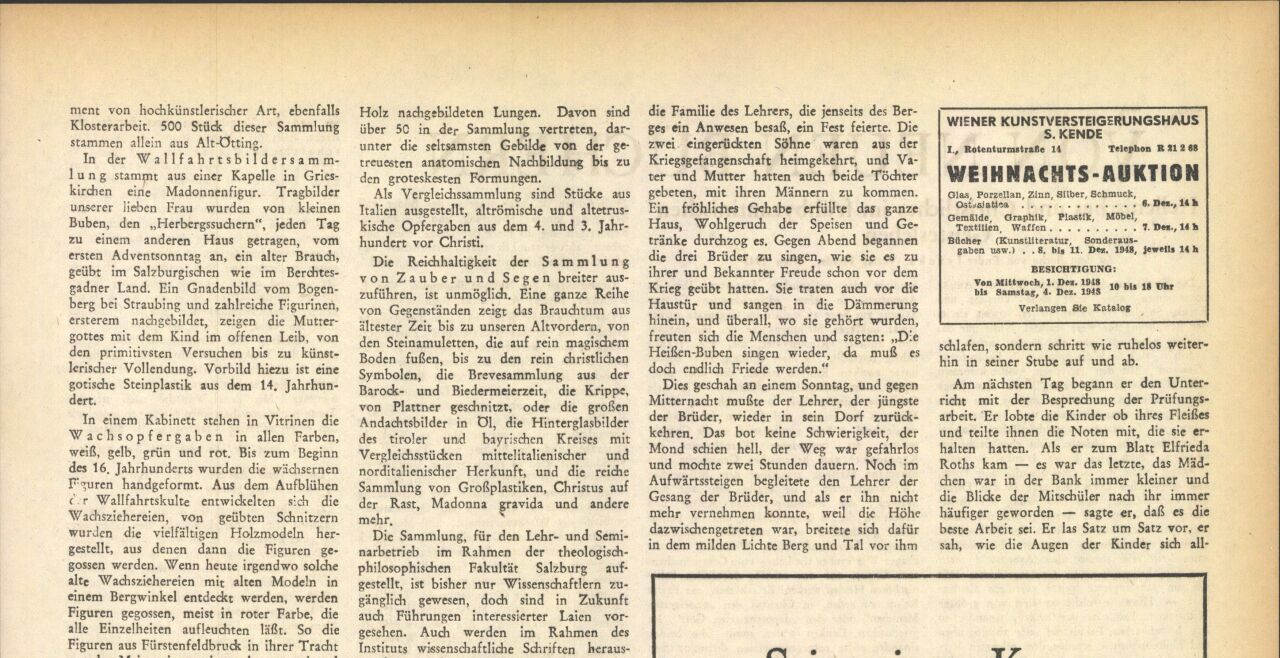
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wir werden wieder eine Heimat haben
Es geschah einmal, daß einem Lehrer, der vor kurzem erst die Bildungsanstalt verlassen hatte, die Führung einer Klasse von zehn- und elfjährigen Knaben und Mädchen anvertraut wurde. Als er zum erstenmal vor sie hintrat — es war schon in der zweiten Hälfte des Schuljahres —, erschien ihm die Klasse als einheitlicher Körper, er atmet und lebt, und es gibt keine Stelle, die da fremd und tot wäre. In der zweiten und dritten Woche jedoch begann er die feinen Risse zu erkennen, die wie alles Lebende auch dieses Wesen durchzogen: es waren Unterschiede gesellschaftlicher Art, die da und dort eine Grenze zogen, Schüler von höherem geistigem Rang schlossen sich manchmal zu einer Gruppe zusammen, der tiefste Spalt jedoch schien dem Lehrer zwischen den Kindern der ortsansässigen Bevölkerung und einem Flüchtlingsmädchen zu klaffen, das aus einem Gemeinschaftslager siebenbürgischer Familien zur Schule kam. Nicht, daß er jeden Augenblick und in auffälliger Form sich gezeigt hätte, aber es gab eine Äußerung, die gegenseitige Mißachtung verriet, eine Gebärde, die nicht vereinzelt, sondern als Ausdruck einer Sinnesart gewertet werden mußte, ein Wort, das beinahe schon ein Schimpf war.
Der Lehrer, der von Natur aus feinfühlig und gütig war, bemühte sich, den Spalt zu überbrücken, er versuchte es mit offenem Zuspruch und heimlicher Einflußnahme, er gab selber Beispiel und tat so alles, was ihm möglich war. Fragte er sich dann nach einer gewissen Zeit und in einer der Stunden, die dem Nachbederiken der Schularbeit gewidmet waren, wie weit er mit seinem Bemühen gekommen sei, dann glaubte er zufrieden sein zu dürfen. Ein letzter Rest des Zwiespalts freilich, das verbarg er sich nicht, ein haardünner Riß, wenn so gesagt werden darf, blieb auch weiterhin.
In guten Stunden kehrte er sich nicht mehr daran, wollte die endgültige Schließung der Zeit überlassen, in schlechten Stunden aber grübelte er doch darüber und begann, da er bei sich selbst keine und bei der Klasse kaum noch eine Schuld zu finden vermochte, sie bei dem Flüchtlingsmädchen zu suchen. Sie hieß Elfrieda Roth und war klein und dunkel und ein äußerst verschlossenes Kind. Es kam fast niemals vor, daß sie aufzeigte, mochte auch die übrige Klasse in einem Sturm des Eifers sein; wurde sie gerufen, erhob sie sich linkisch und wußte oftmals keine Antwort; in den Pausen blieb sie an ihrem Platze sitzen und beteiligte sich nicht an den Spielen der Mitschüler.
„Elfriede”, hatte der Lehrer anfänglich gesagt, „auch du mußt den Anschluß suchen.” Er hatte ihr noch öfter freundlich zugesprochen, aber es war dadurch nichts anders geworden. Das Mädchen hatte ihn kaum angesehen und war dann wohl noch tiefer in sich hineingekrochen. So begann sich allmählich eine Entwicklung anzubahnen, die der Lehrer in seiner Unerfahrenheit vielleicht nicht erkannte, die er möglicherweise aber auch ob seiner verletzten Eitelkeit — und war es nur Berufseitelkeit! — nicht unterband. Die Klasse wandte sich von neuem gegen den Flüchtling, nun aber um seinet-, des Lehrers, willen, und sie schloß ibn selber mit ein. Der Lehrer kam dadurch in einen immer größeren Gegensatz zu dem Mädchen, ja er begann ihr schließlich ernsthaft zu grollen. Den äußeren Ausdruck fand dies, als er es einmal heftig anrief — „für dich werden auch keine Extrawürste gebraten, Roth!” — und zum zweiten anläßlich eines Diebstahls in der Klasse. Er untersuchte zwar jeden Schüler, aber er verweilte bei dem Flüchtlingsmädchen länger und verdächtigte — im stillen zwar, aber doch — allein dieses. Beides hieß aber wohl, daß auch er von dem Kinde sich abgewandt hatte und es nun völlig allein stand.
Bald nach jenen Vorfällen und jenem Abschluß einer Entwicklung gab der Lehrer eine Prüfungsarbeit, in der die Schüler ihre Kenntnis eines Teiles der Sprachlehre, der Zeitformen nämlich, erweisen sollten. Sie mußten Sätze schreiben, die besagten, was sie einmal besessen hätten, was eben jetzt in ihrem Besitz sei und was sie einmal haben würden. Die Kinder waren gut vorbereitet und arbeiteten eifrig, einzig Elfrieda Roth machte wieder eine Ausnahme. Sie schrieb einen Satz und saß dann still, und als sie neuerlich zur Feder griff, war eine lange Zeit vergangen. Sie weinte auch. Der Lehrer, der vor der Klasse stand und auf Ordnung achtete, bemerkte es, aber er mengte sich nicht ein, mochte das Mädchen sehen, wo es blieb. Nach Schluß der Stunde sammelte er die Blätter ein und nahm sie zur gelegentlichen Überprüfung mit auf sein Zimmer.
Es trug sich nun in jenen Tagen zu, daß die Familie des Lehrers, die jenseits des Berges ein Anwesen besaß, ein Fest feierte. Die zwei eingerückten Söhne waren aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt, und Vater und Mutter hatten auch beide Töchter gebeten, mit ihren Männern zu kommen. Ein fröhliches Gehabe erfüllte das ganze Haus, Wohlgeruch der Speisen und Getränke durchzog es. Gegen Abend begannen die drei Brüder zu singen, wie sie es zu ihrer und Bekannter Freude schon vor dem Krieg geübt hatten. Sie traten auch vor die Haustür und sangen in die Dämmerung hinein, und überall, wo sie gehört wurden, freuten sich die Menschen und sagten: „Die Heißen-Buben singen wieder, da muß es doch endlich Friede werden.”
Dies geschah an einem Sonntag, und gegen Mitternacht mußte der Lehrer, der jüngste der Brüder, wieder in sein Dorf zurückkehren. Das bot keine Schwierigkeit, der Mond schien hell, der Weg war gefahrlos und mochte zwei Stunden dauern. Noch im Aufwärtssteigen begleitete den Lehrer der Gesang der Brüder, und als er ihn nicht mehr vernehmen konnte, weil die Höhe dazwischengetreten war, breitete sich dafür in dem milden Lichte Berg und Tal vor ihm aus, Wald, Wiese und Feld, der ferne See, die ganze Heimat. Da übermannte ihn ein heißes Glücksgefühl, er breitete die Arme aus und sang für ich allein das Lob der Schöpfung.
In seiner Stube mochte er noch nicht schlafengehen. Er tat dieses und dann jenes und griff schließlich um die Blätter, die die Kinder beschrieben hatten. Ei, eine Puppe hatten sie einmal besessen oder einen Bo- jazer, nannten jetzt einen Schlitten ihr eigen, Schier, neue Schuhe, und würden einmal schöne Kleider, ein Haus, ein Pferd besitzen. Elfriede Roth aber hatte anderes geschrieben:
„Wir werden wieder einmal eine Heimat haben. Der Vater hat einrücken müssen, dann haben wir ihn nicht mehr gesehen. Meine kleine Schwester Barbile ist auf der Flucht erfroren. Meinen Bruder Norbert und die ältere Schwester Gitta haben die fremden Soldaten zur Arbeit geholt, sie sind nicht mehr heimgekommen. Jetzt sind Mutter und ich ganz allein, und Mutter weint immer. Wir werden nie mehr alle beisammen sein.”
Der Lehrer las die Arbeit ein- und ein zweitesmal, er benotete sie nicht und legte sie zur Seite. Er hätte ein „Ungenügend” daraufschreiben müssen, aber nicht nur, daß er dies verabsäumte, er war auch bei der Durchsicht der folgenden Arbeiten unaufmerksam. Als er endlich fertig war, wies der Zeiger auf drei Uhr morgens, selbst zu dieser späten Stunde jedoch ging er nicht schlafen, sondern schritt wie ruhelos weiterhin in seiner Stube auf und ab.
Am nächsten Tag begann er den Unterricht mit der Besprechung der Prüfungsarbeit. Er lobte die Kinder ob ihres Fleißes und teilte ihnen die Noten mit, die sie erhalten hatten. Als er zum Blatt Elfrieda Roths kam — es war das letzte, das Mädchen war in der Bank immer kleiner und die Blicke der Mitschüler nach ihr immer häufiger geworden — sagte er, daß es die beste Arbeit sei. Er las Satz um Satz vor, er sah, wie die Augen der Kinder sich allmählich auf die Pulte, auf den Boden senkten, und erklärte dann, daß die Arbeit eigentlich keine Spracharbeit, sondern ein Aufsatz sei; als solcher schildere er allein in sechs Sätzen das grausame Schicksal einer Familie in einer gnadenlosen Zeit, er nenne mit einem Satz die ganze Unwiederbring- liclikeit des Verlustes, den die Mitschülerin erlitten habe, mit einem anderen alle ihre Hoffnung, auf Grund derer sie und ihre Mutter noch leben könnten. So sei die Niederschrift in aller Bitterkeit ein Meisterstück, sollten auch erster und letzter Satz ihre Plätze tauschen. Der Lehrer schwieg einen Augenblick, er sprach dann in die atemlose Stille hinein, daß Elfriede aber mit dem Aufsatz keine gute Note verdienen habe wollen, sondern daß er eine Bitte wäre, gut zu ihr zu sein. Sie könne es nicht anders sagen, wolle es nur dadurch ausdrücken, daß sie ihnen mitteile, um wieviel härter ihr Los als das aller ihrer Mitschüler und auch des Lehrers sei.
Der Lehrer schwieg. Elfrieda hatte das Gesicht auf die Bank gelegt, und ein schlitterndes Weinen durchlief ihren Körper. Der Lehrer ließ sie gewähren, ja, er mußte sich selber zum Fenster wenden und hinaussehen, eine ungebührliche lange Zeit. Aber es fiel kein Bleistift in seinem Rücken und scharrte kein Fuß, es war, als wäre die Klasse eingeschlafen oder horchte einem fernen Gesang.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!