
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wo stand denn da die Mauer?
Vor fünf Jahren fiel die Berliner Mauer, die nach Erich Honecker hundert Jahre stehen sollte. Wächst Berlin heute tatsächlich zusammen?
Vor fünf Jahren fiel die Berliner Mauer, die nach Erich Honecker hundert Jahre stehen sollte. Wächst Berlin heute tatsächlich zusammen?
Am 10. November 198? waren Gedanken übei ein Zusammenwachsen der beiden Stadthälften in den Köpfen der Berliner noch unvorstellbar An jenem Tag galt es, erst mit einem viel naheliegenderen Phänomen fertig zu werden: dem völligen Zusammenbruch des Straßenverkehrs in den Innenstadtbezirken West-Berlins. In den letzten drei Stunden voi Mitternacht des 9. November 1989 waren die sechs Straßen-Grenzüber- gänge zwischen beiden Stadthälften von den Grenztruppen nach und nach geöffnet worden. Das massive Drängen der auf östlicher Seite zu Zehntausenden ungeduldig wartenden Berliner hatte Erfolg.
Die Begeisterung aus den Jahren 1989 und 1990 ist heutzutage nur noch selten zu spüren. Realistische Nüchternheit bei den Einwohnern und kaum vorstellbare Finanznöte im Haushalt des Bundeslandes Berlin beherrschen alles Tun in der Stadt. Bei realistischer Betrachtung lassen sich eine Unmenge positiver Veränderungen aufzählen, die im Alltag inzwischen zur Selbstver-ständlichkeit geworden sind. Zwei Beispiele: Bewundernswert und bisher viel zu wenig öffentlich gelobt worden sind die technischen und organisatorischen Meisterleistungen der Deutschen Bundespost Telekom. Binnen nur zweier Jahre wurden die innerstädtischen (ehemals praktisch ausländischen) Telefonleitungen vereinheitlicht, in den Stadthälften doppelt vorhandene Anschlußnummern umgestellt, die Leitungsqualität der östlichen Telefonkabel auf internationalen Standard — das heißt Beseitigung der knackenden Nebengeräusche - gebracht und schließlich bis heute 300.000 neue Telefonanschlüsse in Ost-Berlin installiert. Jetzt warten noch 85.000 Ost-Berliner auf einen Telefonanschluß.
Auch bei der städtischen Stromversorgung mußten „zwei Welten“ vereinigt werden. Seit der elfmonatigen Blockade 1948/49 durch die sowjetischen Militärs hat West-Berlin seinen Strom allein erzeugen müssen, während die Ost-Berliner Kraftwerke an das osteuropäische Strom- Verbundnetz angeschlossen waren und auch heute noch sind. In Osteuropa wurde es allerdings schon immer mit der Frequenzregelung auf 50 Hertz und mit der Synchronzeitregelung nicht besonders genau genommen. Dies hatte zur Folge, daß elektrisch betriebene Uhren in westlichen Stadtbezirken Berlins manchmal einige Minuten vorgingen, weil ihr Strom nunmehr aus dem Kraftwerk eines östlichen Stadtbezirks mit 50,03 Hertz eingespeist wurde. Innerhalb von zwölf Monaten sammelte sich diese Ungenauigkeit auf immerhin fünf Stunden an, sofern man nicht zwischendurch öfters korrigierte. Mittlerweile haben die Staaten des früheren Ostblocks die Frequenzregelung besser im‘Griff, weil sie sich als zuverlässige und vor allem preiswerte Stromlieferanten für das gesamte westeuropäische Verbundnetz empfehlen wollen. Seit Mai 1994 laufen elektrische Uhren in Berlin wieder genauer, jetzt gehen sie jedoch nach, wenn auch nur vier Minuten pro Monat.
ABBAU DER „SOZIALMAUER“
Am 1. Jänner 1995 steht die Stadt vor einer abermaligen großen Vereinigung, diesmal auf sozialpolitischem Gebiet: Für die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Berlin - mit 1,2 Millionen Mitgliedern Deutschlands größte öffentlich- rechtliche Krankenkasse, die überwiegend pflichtversicherte Arbeiter und Angestellte in ihren Reihen hat — entfallen die unterschiedlichen Rechtsgrundlagen für Ost- und West-Berliner Mitglieder. Die Gründlichkeit deutscher Gesetzgebung hatte übergangsweise genau definiert, daß ein in einem westlichen Stadtbezirk wohnender Berli-ner ab dem Tag der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 zu einem sozialversicherungsrechtlichen Ost- Berliner wird, sofern er ein Arbeitsverhältnis bei einem Ost-Berliner Arbeitgeber beginnt. Umgekehrt mußte die AOK-Berlin jeden Ost- Berliner als West-Berliner Mitglied behandeln, der seine Arbeit in einem westlichen Stadtteil bei einem West- Berliner Arbeitgeber ausübte. Grund für diese Trennung waren die unterschiedlichen Einkommensverhält- nisse, die zu unterschiedlichen Krankenversicherungsbeiträgen und zu unterschiedlichen Versicherungsleistungen führten. So dürfen Ost-Berliner AOK-Mitglieder noch bis zum 31. Dezember 1994 nur Ärzte und Krankenhäuser in Ost-Berlin aufsuchen. Bei einem Verkehrsunfall muß die Feuerwehr die Verletzten glück-licherweise nicht nach Ost- und West-Berlin sortieren, in Notfällen werden Ost-Berliner auch in einem West-Berliner Krankenhaus auf Kosten der Krankenkasse behandelt. In wenigen Wochen entfallen diese Regelungen; man spricht dann vom Wegfall der „Sozialmauer“.
Nach wie vor unterschiedlich seit der Vereinigung erfolgt die Bezahlung aller Arbeitnehmer sowohl in der privaten Wirtschaft als auch im öffentlichen Dienst. Steht zum Beispiel der Schreibtisch eines städtischen Bediensteten in einem der östlichen Stadtbezirke, wird das Gehalt nach anfänglich 60 Prozent mittlerweile zu 82 Prozent der maßgeblichen „West“-Tarife an Ost-Berliner gezahlt. Da solche Regelungen unter den Mitarbeitern in einem kommunalen Betrieb das Zusammen wachsen eher behindern als fördern, hat sich Berlins Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) mit seinem Kabinett dazu entschlossen, den unterschiedlichen Einkommensentwicklungen bei den städtischen Mitarbeitern schon bald, ab April 1995, ein Ende zu setzen.
Niemals zuvor in der Weltgeschichte gab es eine vergleichbare Aufgabenstellung, eine Stadt nach 28 Jahren Teilung und getrenntem Nebeneinander in zwei sich feindlich gegenüberstehenden Gesellschaftssystemen unvorbereitet wieder zu vereinen. Wenn heute Besucher in die Stadt kommen und von den Berlinern wissen wollen, wo denn einmal die Mauer stand, haben manche - meist jüngere — Einwohner inzwischen schon Schwierigkeiten, den exakten Grenzverlauf zu beschreiben.
Erhalten geblieben ist die Mauer aber immer noch in vielen Köpfen der Berliner auf beiden Seiten der früheren Grenze. Das führt teilweise so weit, daß manche Berliner in einem Anflug von Ironie — hinter der sich bekanntlich immer ein Stückchen Wahrheit verbirgt - die Mauer zurückwünschen. In letzter Konsequenz will das natürlich niemand ernsthaft. Aber solche immer wieder einmal aufkeimenden Gedanken sind Ausdruck des Haderns mit den vielen Veränderungen und oft auch materiellen Nachteilen im Alltag'. Die West-Berliner können sich kaum vorstellen, was es für Ost- Berliner bedeutet haben muß, sich innerhalb von nur elf Monaten von November 1989 bis Oktober 1990 quasi auf ein vollkommen neues Leben wie in einem ausländischen Land einzurichten.
DIE HEIMAT VERLOREN
Nichts Vertrautes aus 40 Jahren DDR blieb ihnen erhalten; alles war absolut neu für sie. Angefangen von der neuen amtsdeutschen Sprache auf amtlichen Formularen und sonstigen sprachlichen Unterschieden für zahllose Alltagsbegriffe über das fremdartige Rechts- und Verwaltungssystem bis zu der Notwendigkeit, in jeder Lebenslage zukünftig alleine Entscheidungen treffen zu müssen. Ihnen ist praktisch die Heimat verloren gegangen, obwohl niemand umgezogen ist. Dieser Seelenzustand ist unter anderem eine Erklärung dafür, daß die Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) als Nachfolgerin der kommunistischen SED bei der Bundestagswahl am 16. Oktober in den elf Ost-Berliner Stadtbezirken mit 34,7 Prozent die meisten Stimmen erhielt. In den zwölf West-Berliner Bezirken kam sie auf 2,6 Prozent. Die PDS hat Wähler in Ost-Berlin mehr auf ihre Seelenlage anzusprechen verstanden.
Den Ost-Berlinern hingegen kann man kaum vermitteln, welche politischen Leidensphasen die West-Berliner seit 1948 trotz ständiger Schutzgarantien der westlichen Alliierten durchgemacht haben und welchen Schikanen sie durch die DDR ausgesetzt waren. Die West-Berliner nehmen für sich in Anspruch, durch ihren Freiheitswillen, ihr dazu entwickeltes Beharrungsvermögen und ihren symbolischen Kampf im Kalten Krieg gegen das DDR-Unrechtregime auch einen Beitrag zu dessen Zerfall geleistet zu haben. Schließlich waren sie es, die auf einer nur 479 Quadratkilometer großen Insel mit einem begrenzten Bewegungsspielraum als Vorposten der freien westlichen Welt ausharrten und die damit verbundenen Nachteile in Kauf nahmen. Sie waren zwar auf vielfältige westdeutsche Unterstützung angewiesen, haben aber als Gegenleistung durch schlichte geographische Existenz mitten in der DDR die Endgültigkeit der deutschen Teilung politisch offengehalten. Die Öffnung der DDR-Grenze vor fünf Jahren ist im dichtbesiedelten Berlin und nicht im Thüringer Wald erfolgt; die Grenzöfftiung ist durch die Tatsache, daß dieses West-Berlin überhaupt existierte, zumindest begünstigt worden.
Für West-Berliner ist nach allem, was ihnen in 40 Jahren durch die DDR zugefügt wurde, die Schamfrist, der PDS jetzt ohne Mißtrauen zu begegnen, einfach zu kurz. Das muß und wird keine lebenslängliche Ausgrenzung bedeuten. Aber eine Beteiligung an politischer Machtausübung etwa schon ab Herbst 1995 nach den nächsten Wahlen zum Abgeordnetenhaus der Stadt durch die PDS ist für West-Berliner undenkbar.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

















































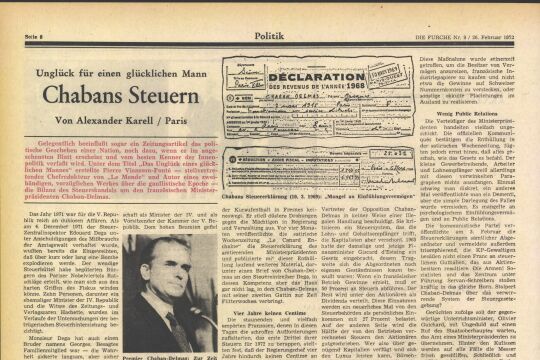


































.png)







