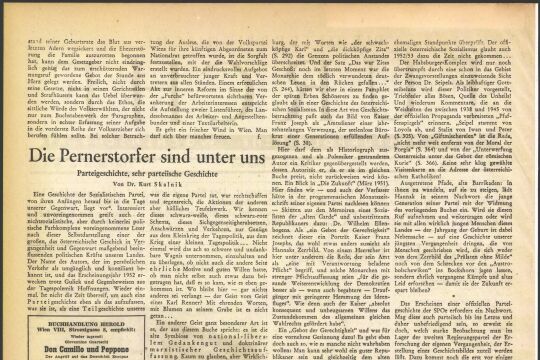Es sind lange Osterferien, zu denen Bundeskanzler Raab dieses Jahr rüstet. Sehr lange Osterferien. Mehr noch: es ist der Abschied. Der Abschied vom Ballhausplatz, der Abschied von acht Jahren an der Spitze der österreichischen Bundesregierung — acht Jahre, die vielleicht einmal in der Erinnerung der Österreicher dieselbe Bedeutung bekommen werden wie die bekannten „sieben fetten Jahre” des Alten Testaments. Die Verdienste des scheidenden Kanzlers werden in diesen Wochen uns gewiß noch oft genug und ausführlich in Erinnerung gerufen werden. Markieren wir hier nur die wichtigsten Stationen.
Als Julius Raab am Ballhausplatz seinen Einzug hielt waren noch nicht drei Jahre vergangen, seitdem die Sturmtrupps kommunistischer Putschisten das Haus berannt hatten und der heftigste Vorstoß der extremen Linken nach 1945 am geschlossenen Abwehrwillen der breiten Massen dės österreichischen Volkes gescheitert war. Noch standen die Posten der Sowjetarmee an der Enns, und durch die Straßen Wiens fuhren die inzwischen legendär gewordenen Gestalten der „Vier im Jeep”. Die düsteren Jahre auf dem langen Weg zwischen Befreiung und Freiheit waren aber bereits Vergangenheit. Das Fundament des neuen Österreichs stand nicht zuletzt dank Raabs Vorgänger, dessen Einsatz in den kritischesten Stunden nur grober Undank vergessen kann. Der Baumeister Raab verstand es, auf dem zementierten Unterbau das neue Haus zu bauen, wohnlich für alle und der Bewahrung vor unachtsamen Händen wie der Verteidigung gegen offene und geheime Feinde wert.
Vom „Gewerberetter” zum Staatsvertragskanzler.
Die Außenpolitik wurde damals zur allgemeinen Verwunderung bald die Lieblingsbeschäftigung des neuen Kanzlers, den man bisher vornehmlich an wirtschaftlichen Fragen interessiert gesehen hatte und den seine alten Freunde aus der Zwischenkriegszeit als „Gewerberetter” rühmten. Gar bald erkannte Julius Raab mit seinem in den besten Zeiten untrüglichen politischen Instinkt, daß in Moskau etwas zu holen wäre, daß vielleicht nur eine kurze Stunde der Weltpolitik die Signale für den Abschluß eines Staatsvertrages für Österreich unter in on moron auf ariin tanden. Der österreichische Regierungschef nutzt? ohne große Bedenken und ohne ©in ideologisches Wenn und Aber für unser Land die Stunde Er riß den sein anfängliches Zaudern später gern vergessenden und vergessen machenden Koalitionspartner mit. Ihn kümmerte es genau sowenig, wenn das sozialistische Zentralorgan vom „russophilen Herrn Raab” schrieb, wie wenn gewissen „Abendländern” zum Tag des Staatsvertrages nichts anderes einfiel als der Unkenruf „Dreimal Österreich und Nimmermehr”. Der zeitlebens nach einem christlich-bürgerlichen Modell eher der Zwischenkriegsjahre orientierte Regierungschef und Parteiführer, den — nur eine kleine, aber bezeichnende Äußerlichkeit — seine Freunde erst knapp vor der Übernahme des hohen Amtes überreden konnten, den etwas altväterlichen „Vatermörderkragen” abzulegen, wurde, ähnlich wie in Finnland seinerzeit Paasikivi, der Mann, den die Russen als ,,ganz anderen” respektierten und dessen Wort sie, war erst einmal das Eis des gewohnten Mißtrauens geschmolzen, Glauben schenkten. Der Staatsvertrag wurde in der Folgezeit zur Magna Charta der Existenz Österreichs, wie die zunächst als Kaufpreis angenommene Neutralität allen wachen Geistern sich in immer stärkerem Maß als die Chance offenbarte, das Gesetz, unter dem dieses Land im Herzen Europas nun einmal angetreten ist, in der veränderten Welt erneut zu bekunden. Solche Überlegungen mögen für Julius Raab schon zuviel Theorie sein. Er liebte einfachere Faustregeln. Die Mahnung, „nicht den Bären in den Schwanz zu zwicken”, enthüllt in ihrer, wenn man will, hausbackenen Sprache alle Elemente einer realistischen Ostpolitik Österreichs. In Gegenwart und Zukunft.
Wir sprachen von Raab als einem eher nach gewissen der Zwischenkriegszeit entstammenden Leitbildern orientierten Politiker. Nirgends zeigte sich dies deutlicher als an der „Heimatfront”. In ihrer Stärke, -iber auch in ihrer inmitten einer veränderten gesellschaftlichen Umwelt immer deutlicher zutage tretenden Begrenzung, Zu allen Zeiten seines politischen Wirkens fühlte sich Raab vornehmlich als Anwalt des „bodenständigen Bürgertums”, des ..christlichen Volkes” und „der guten Sache” — alles Wertkategorien, die einmal Fleisch und
Blut waren, die aber in der Gegenwart nicht immer mit den soziologischen Realitäten in Deckung zu bringen waren. Die Intellektuellen hatten bei Raab nie einen allzu großen Stein im Brett, und für die Wortführer der in der Volkspartei stehenden Arbeiter und Angestellten war es mitunter recht bitter, wenn sie Zusehen mußten, wie es Raab vorzog, über ihre Köpfe hinweg lieber direkt den Draht zu den Sozialisten spielen zu lassen. So konnte in manchen Kreisen der verhängnisvolle Kurzschluß eintreten, die Arbeitnehmerschaft werde in der Regierung durch die SPÖ vertreten . ..
Licht und Schatten des „Raabismus”
Und doch war es niemand anderer als jenes „Bürgertum”, das Raab die tiefste Enttäuschung bereiten sollte. Als er am Abend der Bundespräsiden- tenwah’l 1959 erkennen mußte, daß jene „bürgerliche Karte” nicht mehr stach — merkwürdigerweise haben so viele gescheite Leute dies in der Zwischenzeit wieder vergessen —, stiegen echte Zweifel in dem Mann hoch, der sich nicht nur in seinem Stolz getroffen fühlte, sondern auch an seinem guten Stern zu zweifeln begann. Die schweren Attacken gegen die Gesundheit Julius Raabs waren nur die unmittelbaren Folgeerscheinungen. Was lag näher, als daß nun auch jene unter dem Namen „ Raabismus” bekanntgewordene sehr persönliche Herrschaft in Partei und Regierung ihr zweites Gesicht immer stärker zu zeigen begann. Entschlußlosigkeit stellte sich dort ein, wo man gewohnt war, sowieso alle Entscheidungen von oben mit mehr oder weniger sanfter Hand abgenommen zu bekommen. Unernst breitete sich aus, verbunden mit der Flucht in allerlei Ersatzbefriedigungen in der Welt des Konsums und des Kommerzes. Ein kluger politischer Beobachter hat einmal festgehalten, daß Adolf Schärf und Julius Raab die beiden Grundkomponenten österreichischen Wesens und österreichischer Politik die „iosephraische” und die „franziszäische” in unseren Tagen erneut und leibhaftig verkörpern. Daran ist viel Wahres. Während der „rote Hofrat” im Präsidentenpalais in letzter Deszendenz geistig aus dem Kreis der josephinischen Reformer stammt, fand unsere Gegenwart ihren „guten Kaiser Franz” eben in Julius Raab. Er führt’ die Menschen aus den Wirren der
Nachkriegszeit mit fester Hand hinüber in das „Neon-Biedermeier” der sechziger Jahre. Es kümmerte wenig, daß das politische Engagement breiter Kreise zu verkümmern drohte, daß der Graben zwischen den in Verantwortung stehenden Männern und der nachrückenden Generation breiter wurde. Eine geistige Verkarstung war unverkennbar und in ihrem Gefolge ein Überwuchern der wirtschaftlichen Egoismen.
Und doch war der Mensch Julius Raab vielleicht nie zuvor so ansprechend wie in diesen letzten Jahren, als der Chor der Liebediener immer leiser wurde und — erinnern wir uns nur an den Chruschtschow-Besuch — ätzende Kritik nicht zuletzt von jenen geübt wurde, die sich vor gar nicht langer Zeit im Streuen der Weihrauchkörner gegenseitig überboten haben. Grund genug, nicht zuletzt für unser Blatt, dafür einzulreten, daß der politische Anstand und das in der Politik so wenig geltende Wort Dankbarkeit nicht in Vergessenheit geriet.
Nun setzt Julius Raab selbst den Schlußpunkt. Sein Schatten wird noch lange über dem Ballhausplatz liegen, seine Person aber zeit seines Lebens eine „eiserne Reserve” in der österreichischen Politik bilden.
Die letzten Tage des scheidenden Bundeskanzlers und seines Kabinetts sind zugleich die ersten der Regierung Gorbach, die sich auf die Übernahme der Geschäfte vorbereitet. Für die sozialistische Hälfte der Kabinettsmitglieder ist es zunächst eine reine Routinefrage, wer den Sitzungen im Ministerrat nunmehr präsidiert, nachdem ihnen die Person des künftigen Kanzlers nicht zuletzt seit der Regierungsbildung 1959 keine unbekannte mehr ist. Die Probleme, denen sich Alfons Gorbach gegenübersieht, sind wahrhaft nicht klein. Es gilt zunächst, von einem persönlichen Regiment zu neuen Formen der Zusammenarbeit innerhalb der Partei und in der Regierung überzuleiten. Und dies ist vor allem bei einer Partei wie der Volkspartei keine Kleinigkeit. Bedeutete bei dem Lager, das sich heute in der Volkspartei repräsentiert, die Klammer einer starken Persönlichkeit an der Spitze doch immer sehr viel, wenn nicht alles. Nach dem Ausfall eben dieser Persönlichkeit ging es nie ohne ernste Krisen ab. Das war schon so, als Lueger die Augen für immer schloß. Seipels Agonie war zwei Jahrzehnte später auch die Agonie seiner Partei. Und als Dollfuß, um den sich die aktivsten Kräfte der damaligen jungen Generation noch einmal geschart hatten, die Mörderkugel traf, war praktisch alles entschieden. Und nach 1945 trat sehr bald Julius Raab aus der Kulisse. Er gab einer Ära mit Recht seinen Namen. Alfons Gorbach dürfte nicht den Ehrgeiz haben, einer neuen Ära seinen Namen aufzuprägen. Das ist auch schwer möglich. Epochen schließen nicht nahtlos aneinander. Seine Aufgabe dürfte — manches deutet darauf hin — der neu „ darin sehen, einerseits das Erbe seines Vorgängers gut zu verwalten, auf der anderen Seite aber einem neuen Stil des Regierens und der Menschenführung zum Durchbruch zu verhelfen. Gar viele Rücksichten gilt es zu nehmen, zahlreiche Interessen, die jetzt stärker denn je zuvor nach vorne drängen, wollen befriedigt werden. Und dabei heißt es an eignem Profil zu gewinnen: das ist die Problematik, der Gorbach sich gegenübersieht.
Neuer Kanzler — neue Minister
Der designierte Regierungschef mag sich von ähnlichen Überlegungen haben leiten lassen, als er vier „neue” Männer einlud, in sein Kabinett einzutreten. Finanzminister H e i I i n g- setzer war das schwächste Glied der Kette. Mit seinem Ausscheiden mußte gerechnet werden, wiewohl der hoch- qualifizierte Beamte, der bisher sich hauptsächlich mit der Hinterlassenschaft seines auf Publicity besser zu verstehenden Vorgängers herumschlug, eigentlich nie richtig die
Chance zu einer eigenen Entfaltung bekommen hatte. Um den Ministerstuhl in der Himmelpfortgasse ist Dr. Josef Klaus in keiner Weise zu beneiden. Dort das stille, vom Fest spielglanz umleuchtete Salzburg, hier die undankbarste Aufgabe, die Österreich zu allen Zeiten, vornehmlich aber in dieser, zu vergeben hat. Nicht jeder hätte in dieser Situation ein solches Ja gesprochen. Im Innenministerium ist Länderablöse. Der Vorarlberger Grubhofer, der zu allen Zeiten Grundsätze über die Popularitätshascherei des Tages zu stellen wußte und dessen politische Laufbahn noch lange nicht beendet ist, übergibt sein Amt dem Oberösterreicher Dr. Kranzlmayr. Staatsanwalt ist dessen Beruf. Wachsamer und beredter Anwalt der Republik Österreich zu sein, heißt seine neue Aufgabe in der Herrengasse. Sein bisheriger politischer Lebensweg läßt diese Erwartungen nicht zu hoch gespannt erscheinen. Mit Universitätsprofessor Gschnitzer verliert die österreichische Außenpolitik ohne Zweifel eine scharfprofilierte Persönlichkeit. Die „Lehenstreue” der Tiroler Volkspartei zu ihrem „Professor” ist dabei ein in der Politik seltenes Zeugnis von Anständigkeit. Die katholischen Akademiker der „Kriegs generation” begrüßen in Gschnitzers Nachfolger Ludwig Steiner einen der ihren — einen Mann, der diesem Land, dessen Außenpolitik er mitverantworten muß, schon diente, als dieser Dienst Einsatz des Lebens bedeutete und nicht Ämter und Würden verhieß.
Verantwortung für das Bundesheer
Die Ablösung von Bundesminister Graf kam der „Sprengung eines Monuments” gleich. Es ist ein offenes Geheimnis, daß Ferdinand Graf bereit war, den sechzehn Jahren seiner Mitgliedschaft in der Regierung noch weitere hinzuzufügen. Nun scheint der alte Kämpe in einer spontanen . Rjä- aktion entschlossen zu sein, einen völligen Abschied von der Politik zu nehmen. Aus dem Stuhl eines Präsidenten des Aufsichtsrates der Creditanstalt führt jedenfalls kein Weg zurück. Als Alfons Gorbach sich zu einer Änderung an der Spitze des Ministeriums für Landesverteidigung entschloß, ging er in der Nachfolgefrage den Weg des innerparteilichen und innerbündischen geringsten Widerstandes. Graf ist Kärntner und Bauern- bündler. Was können die Kärntner und Bauernbündler sagen, wenn nach Graf wieder einer der ihren folgt. Auf dieser Fährte stieß er auf Dr. Karl Schleinzer Zwar hatte sich der 37jährige Obmann des Kärntner Bauernbundes bis vor einer Woche mit Wehrfragen so gut wie überhaupt nicht beschäftigt — aber was tat’s 1 Wird es gut gehen? Es ist ein offenes Geheimnis, daß Dr. Schleinzer aus jenen politischen Schichten hervorgegangen ist, die nicht unbedingt den Kern der Volkspartei bilden. Wir weisen jede „Sippenhaftung” jedoch von uns, kennen wir doch eine Reihe von Menschen, die sich ihren Weg zu Österreich persönlich erarbeitet haben. Nicht was war, was ist, gilt. Hier heißt es aber Farbe bekennen. An konkreten Entscheidungen wird es keinen Mangel haben. Wenn Dr. Schleinzer wissen will, welcher Geist nie und nimmer in das Bundesheer einziehen darf, dann braucht er nur gewisse Publikationen der Kameradschaftsbünde zu lesen und deren Redner sich anzuhören. Ein nur dem österreichischen Vaterland und der Verteidigung seiner Neutralität verpflichtetes Bundesheer: das ist es, was wir brauchen. Für eine Traditionstruppe des Wehrkreises XVII und XVIII der Deutschen Wehrmacht könnte dem österreichischen Volk eines Tages das Geld zu teuer sein. Die Stabilität seiner Ministerschaft wird nicht zuletzt von der Meisterung dieses Problems abhängen.
Das Kabinett Gorbach formiert sich. Es birgt Chancen und - auch Gefahren. Die ersteren mit wecken zu helfen, den letzteren zu wehren, muß Aufgabe aller Kräfte sein, die die Zukunft dieses Staates über die Interessen des Tages und seiner Parteiungen stellen.