Verdis "Don Carlos" in der französischen Originalfassung an der Wiener Staatsoper.
Als 1996 in Paris eine vielbeachtete, medial ausgeschlachtete Produktion von Verdis "Don Carlos" über die Bühne ging, blieb das Ergebnis ein unbefriedigendes: man hatte zwar die französische Version des Werkes angekündigt, dabei allerdings nicht auf Passagen verzichtet, die es nie in den französischen Versionen des Werkes gegeben hatte - die Chance, Verdis Grand Opéra nach Friedrich von Schiller so zu präsentieren, wie sie wirklich vom Komponisten erdacht war, hatte man damals versäumt. Weitere Jahre mussten vergehen, bis jetzt endlich an der Wiener Staatsoper die "Uraufführung der Originalfassung" des "Don Carlos" (so der Besetzungszettel) gezeigt wurde. Zurück zum Original war dabei die Devise: nicht bloß zur Fassung, in der das Werk bei der Uraufführung 1867 gezeigt wurde, sondern zurück zu jener Version, wie sie Verdi 1866/67 konzipiert hatte.
Der Rückgriff auf das Urmaterial (wir wollen der Wiener Oper ungeprüft, aber doch auch mit ein wenig Skepsis Glauben schenken, dass keine andere Bühne jemals diese umfangreiche Fassung mit rund fünf Stunden Aufführungsdauer gespielt hat) ist die herausragendste und bemerkenswerteste Leistung dieser "Don Carlos"-Neuproduktion, weit weniger dagegen die Tatsache, dass Regisseur Peter Konwitschny erstmals an der Staatsoper inszeniert hat. Seine Sicht des "Don Carlos" ist nämlich keineswegs neu: Bereits im Verdi-Jahr 2001 hatte er das Werk in Hamburg realisiert, und auf dieser älteren Arbeit beruhte nun auch seiner Wiener Einstudierung. Das heißt die dezent historisierend gewandeten Figuren sind im kahlen, das ganze Stück gleichbleibenden Bühnenbild von Johannes Leiacker vom Regisseur professionell geführt; zu den Szenen sind ihm teilweise interessante, durchaus ungewöhnliche, aber überzeugende Ansätze eingefallen. Die Gestaltung der eigentlichen Handlung hätte in keiner Weise den Unmut des Publikums hervorgerufen, der entzündete sich vielmehr an der von Konwitschny plakativ zum Intermezzo "Ebolis Traum" umgedeuteten Ballettmusik (die Protagonisten spielen Szenen einer Ehe in Form einer Stummfilm-Groteske) und am diskutablen Autodafé-Bild, das als Totaltheater und Parodie auf ein Live-Medienspektakel auch in den Foyers und im Zuschauerraum stattfindet - und in dem die Musik schlichtweg auf der Strecke bleibt. Unter dem allgemeinen Trubel litt die Präzision des Zusammenklangs, wirkten Solisten und Chor häufig desorientiert.
Dabei wurde sonst anständig, wenn auch nicht herausragend musiziert: Ramón Vargas war ein Carlos mit betörendem Tenortimbre, aber auch Problemen in den Höhen, Bo Skovhus ein sehr gekünstelt mit den Vokallinien umgehender, die Schönheit seines Timbres verschleiernder Posa, Iano Tamar eine Elisabeth mit gedeckt lyrischem Ton, deren Stimme in den nicht immer sauber intonierten Höhen wenig aufblühte, Nadja Michael eine impulsive Eboli mit dramatischem Impetus, der ihr auch über Ungleichmäßigkeiten in der Tonproduktion hinweghalf, Alastair Miles ein solider, stimmliche Größe vermissen lassender Philipp, Dan Paul Dumitrescu ein ausgezeichneter, schöntönender Mönch und Simon Yang ein bedrohlicher Groß-Inquisitor. Sieht man vom Autodafé-Bild ab, präsentierte sich der Chor in homogen stimmstarker Form und zeigte großes Differenzierungsvermögen. Genau darauf war auch Bertrand de Billy am Dirigentenpult im Graben sehr bemüht, dem Orchester entlockte er vielfältige Farben und Nuancen, so dass auch in den bekannten Teilen häufig ein ganz anderes, weicheres und lyrischeres Klangbild entstand, dies aber zuweilen erheblich auf Kosten der Stringenz, Innenspannung und zupackenden Intensität. Buhs trafen dieses Mal nicht nur das Produktionsteam, sondern auch den Dirigenten und die meisten der Protagonisten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!



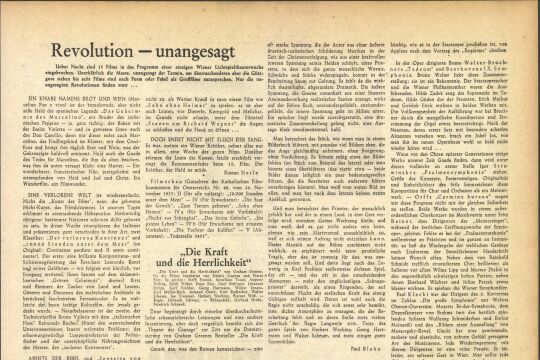




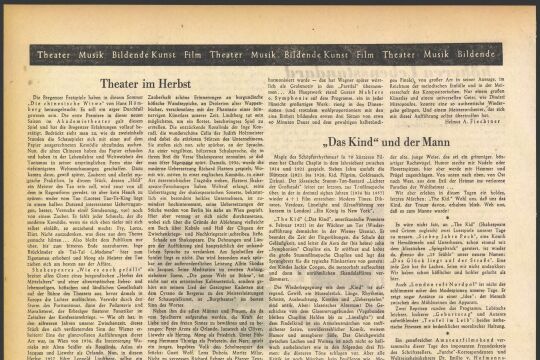






































































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)
















_edit.jpg)



