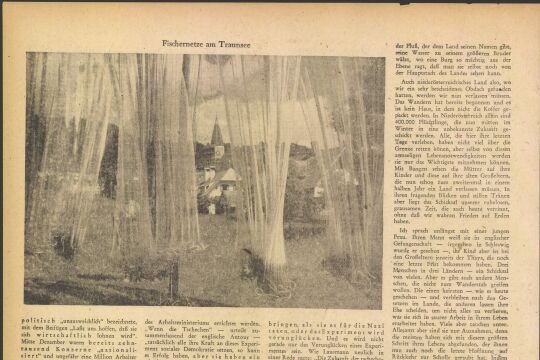Zwei Bettler in Salzburg
Über die Armut ist ein Tabu verhängt - Woher kommt gerade jetzt diese prügelnde Aversion nicht gegen "die da oben", sondern die da unten?
Über die Armut ist ein Tabu verhängt - Woher kommt gerade jetzt diese prügelnde Aversion nicht gegen "die da oben", sondern die da unten?
Das Neutor ist ein leicht ansteigender Durchbruch durch den Mönchsberg, der die Altstadt von Salzburg mit dem vor dem Berg liegenden Stadtteil Riedenburg verbindet. Von einem der vielen baulustigen Erzbischöfe in Auftrag gegeben, hat er einst den innerstädtischen Verkehr so erleichtert wie er ihn heute, da sich von früh bis abends Tausende Fahrzeuge durch ihn zwängen, zu behindern scheint. Zu meiner Kindheit gab es nur den einen, prächtig in den Fels geschlagene Tunnel, über dessen Eingang die Erbauer zuversichtlich den Satz meißeln ließen: TE SAXA LOQUNTUR - Die Steine erzählen dir.
Neben dem alten, herrschaftlich hohen Tunnel ist vor bald dreißig Jahren ein enger, niederer Gang durch den Fels getrieben worden, der den Fußgängern und den Radfahrern vorbehalten ist. Es ist das ein unansehnlicher Ort, und mancherlei Versuche, ihn schöner zu gestalten, haben zu nichts Schönerem geführt. Das ganze Jahr über pfeift der Wind durch diese Röhre, die die Touristen darmgleich aus dem Bauch der Stadt in die Vorstadt auswirft, wo dampfend schon die Busse auf sie warten, mit laufendem Motor, weil im Sommer die Klimaanlage, im Winter die Heizung in Betrieb sein muß. Hier ist der Arbeitsplatz von zwei Bettlern, die sich ihre Arbeit tage- oder stundenweise so organisiert haben, daß immer nur einer von ihnen anzutreffen ist. In der Hierarchie sind sie, wie auch die Unterstandslosen, die nur fallweise im Neutor betteln, die mißachtetsten ihres Standes, der Abschaum von Salzburg.
Der eine sitzt mit einem Doppler Roten in dem Rinnsal, das sich von der öffentlichen Toilette am oberen Ende des Tunnels dünn und übelriechend stadtwärts schlängelt; sein Blick ist den sich Nähernden trotzig entgegengerichtet, als wollte er sie, die vorübergehen, hochmütig zwingen, ihn zu beachten; der andere, mit geschlossenen Augen am Boden kauernd, ist in einem kaum vernehmbaren Murmeln befangen und von einer unablässigen Bewegung des Oberkörpers ergriffen, in der er sich, wie ein verlassenes Kind, hin und her wiegt. Der eine hat vor sich eine Schachtel, in der sich wenig, der andere einen Hut, in dem sich etwas mehr Geld befindet, und keiner von beiden richtet je das Wort an die Passanten.
Wie Monumente ihrer selbst sitzen sie jahraus, jahrein unverändert an ihrem Platz, und es müssen schon Hunderttausende gewesen sein, die an ihnen vorbei gegangen sind. Wenn das Elend ringsum wächst, werden die Elenden unbeliebt, denn die Armut, auch wenn sie die der anderen ist, hat etwas Verrohendes. Und doch geht heute, von den Touristen abgesehen, die im Gleichmarsch in die Stadt getrieben und erschöpft aus ihr hinausgeführt werden, kaum jemand mehr achtlos an den beiden vorüber; es ist, als würde ein gesellschaftlicher Konflikt gerade vor diesen beiden ausgetragen, die in Dreck und Urin, umgeben von Hundekot und Zigarettenkippen, stumm ihr Almosen fordern, vor ihnen und mit ihnen als Zeugen.
Mögen es früher Mitleid, Mißtrauen oder Gleichgültigkeit gewesen sein, die man den Bettlern der Stadt entgegenbrachte, so ist es heute der blanke Haß, der ihnen entgegenschlägt. Dieser Haß auf jemanden, der so ersichtlich an der untersten Stufe angekommen ist und sich, um seine armselige Existenz zu bestreiten, in Dreck und Zugluft setzt, ist ein merkwürdiger, wiewohl weit verbreiteter Affekt. Man hat ihn mit christlicher Psychologie so zu erklären versucht, daß wir den Elenden, dem zu helfen unsere Menschenpflicht wäre, eben deswegen hassen, weil uns sein Anblick an unser Versäumnis, unser Versagen erinnert. Aber das ist eine unzulängliche Erklärung.
Denn warum wächst überall in der industriellen Welt der Haß auf die Schwächsten, auf Bettler, Obdachlose, Flüchtlinge, Behinderte gerade jetzt? Immerhin zwei Mal in den letzten Jahren sind in Salzburg just Obdachlose zum Opfer schwerer Gewalttaten geworden; nicht weit von dem Ort, wo die beiden Bettler sitzen, wurde auf einer Bank am Mönchsberg ein Sandler erschlagen, und in der Altstadt erlitt eine Unterstandslose kürzlich schwere Verletzungen, als sie nächtens in ihrem Schlafwinkel in einer der bekannten Geschäftsstraßen aufgespürt und überfallen wurde. Woher kommt sie, und warum gerade jetzt, diese prügelnde Aversion nicht gegen "die da oben", sondern die da unten?
Es ist nicht das schlechte Gewissen, das sich in Prügelei entlädt, sondern die Angst. Der Obdachlose, der Bettler, der Fremde haben schon erlitten, was vielen droht, sie sind bereits dort, wo keiner von uns hinwill. Nicht weil sie obdachlos, arm, fremd sind, werden sie gehaßt, sondern weil sie schon sind, was viele zu werden fürchten müssen. Ihr Anblick erschreckt, weil sich in ihm jene fürchterliche Wendung abzeichnet, die auch das Leben der vielen, die sich noch in leidlicher Sicherheit hoffen, alsbald nehmen könnte. Der Tritt, mit dem junge Leute den Hut, die Schachtel des Bettlers aus ihrem Weg befördern, gilt dem Schicksal, das ihnen selbst beschieden sein könnte und dem sie am sichersten zu entrinnen meinen, wenn sie selber jene treten, über die es schon verhängt ist. Der Bettler wird nicht gehaßt, weil wir in ihm den Bruder nicht mehr zu erkennen vermögen, sondern gerade weil wir in ihm den Bruder erahnen, an dessen Stelle auch wir uns befinden könnten.
So ziehen die Salzburger mit verächtlichen Bemerkungen, mitunter laut schimpfend, an den Bettlern vorbei, deren schlichte Existenz in ihnen einen Haß weckt, dessen Grund sie gar nicht ermessen. Aber nicht nur diese Passanten gibt es, sondern es wächst auch die Zahl jener anderen, die sich nicht allein mildtätig nach alter Weise erweisen, sondern vor den Bettlern innehalten, umständlich nach der Geldtasche zu kramen beginnen und das Almosen gewissermaßen in einem öffentlichen Akt überreichen.
Es ist nicht die karitative Eitelkeit, die sie dazu veranlaßt, und was sich da inszeniert, ist nicht das gute Gewissen, das sich vorteilhaft in Szene gesetzt wissen möchte. Nein, wo die Feindseligkeit so groß geworden ist, dort ist vielmehr selbst der uralten Sitte des Almosengebens etwas Anrüchiges zugewachsen. Da die Armut schon fast als Verbrechen wider die Religion des Geldes geächtet ist, macht sich verdächtig, wer sich vor den Armen nicht hütet. Über die Armut ist ein Tabu verhängt, und die Macht von Tabus ist nicht zu brechen, indem man bloß verschämt gegen sie verstößt.
Vielleicht ohne es zu beabsichtigen, suchen jene, die ihr Almosen da nicht heimlich, sondern geradezu demonstrativ geben, ein Tabu zu brechen: das Tabu, daß es Armut in Österreich gibt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!