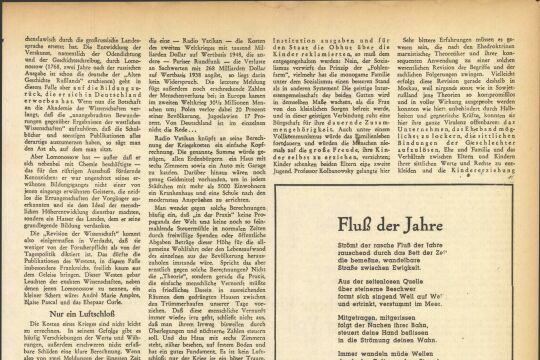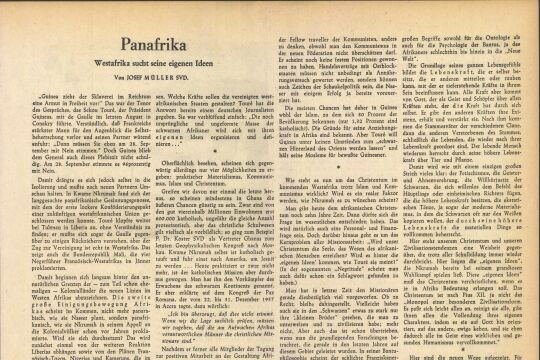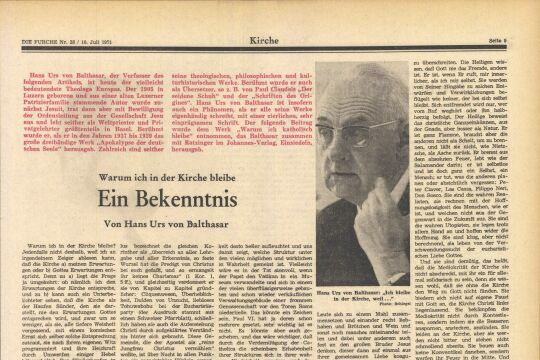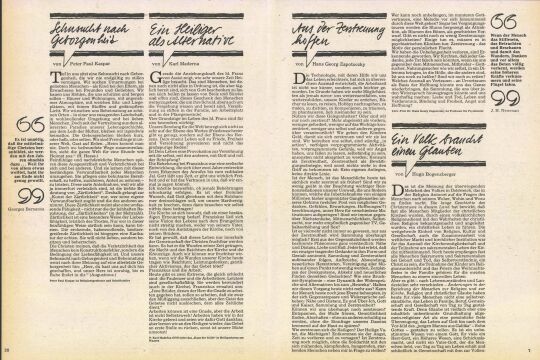Ahnengeister oder Heiliger Geist?
Atheismus kennt der Afrikaner nicht, Toleranz auch nicht: Ein Jesuit erlebt den Zusammenstoß und die Versöhnung von Christentum und lokaler Kultur.
Atheismus kennt der Afrikaner nicht, Toleranz auch nicht: Ein Jesuit erlebt den Zusammenstoß und die Versöhnung von Christentum und lokaler Kultur.
In unserer Gemeinde in Chitungwiza, dem "Soweto" von Simbabwe, spielte sich kürzlich ein kleines Drama ab: ein zwölfjähriges Mädchen wurde von einem der Ordner aus der Kirche gewiesen, weil sie Hosen trug. "Mädchen tragen keine Hosen in unserer Kultur," ereiferte sich eine erregte Frau bei der Pfarrgemeindeversammlung. In der Tat, vor ein paar Jahren hätte eine hosentragende Frau einen Volksauflauf verursacht: junge Frauen in Miniröcken sind in Harare von Randalierern tätlich angegriffen worden, auch im Namen der "Kultur". Aber was ist afrikanische Kultur?
Wenn ein Vater für seine akademisch gebildete Tochter einen "Brautpreis" von 100.000 Simbabwe-$ vom Schwiegersohn verlangt, ist das die angestammte Tradition, oder ihr Mißbrauch? Wenn ein Vater von fünf Kindern eine zweite Frau heiratet, ist das altehrwürdige Sitte einer Mehrfrauenfamilie, oder hält er sich eine Konkubine, zum Schaden der Erstfamilie?
Afrika und Christentum sollten sich im Dialog treffen. Tatsächlich ist ihre Begegnung mehr ein gewaltsamer Zusammenstoß. Zumal noch ein dritter darin verwickelt ist und die Sache zu einer Massenkarambolage macht: die westliche technische Zivilisation mit ihrer brutalen Medienüberlegenheit meist amerikanischer Herkunft. Übrigens: Hosentragende junge Damen sind jetzt, ein paar Wochen später, kein Thema mehr: "Seid doch froh, daß sie überhaupt kommen," habe ich den Eltern gesagt. "Unsere Kultur ist dynamisch," sagen die Aufgeklärten.
Die afrikanische Religion hat kein heiliges Buch, keine Bibel, kein Dogma oder Lehramt. Von Rom traumatisierte Österreicher mögen das ganz sympathisch finden, doch hat es immerhin den Nachteil, daß man nur sehr schwer dingfest machen kann, was denn afrikanische Religion eigentlich aussagt. Und ein reines, vom Westen unberührtes Afrika gibt es außerdem nicht mehr.
In unserer Pastoralzeitschrift findet zur Zeit eine Debatte zwischen einheimischen Theologen über Gott und die Geister der Verstorbenen statt. Daß es einen Hochgott und Schöpfer gibt, ist dem Afrikaner selbstverständlich. Atheismus ist eine Erfindung des Westens. Viel näher scheinen den Menschen die Geister ihrer Ahnen zu sein. Gibt es einen Zugang zu Mwari oder Unkulunkulu (Gottesbezeichnung in den Landessprachen Schona und Ndebele)? Ja, sagen die einen, die Ahnen sind Gott näher als wir, und sie vermitteln diesen Zugang. Nein, sagen die anderen, Vermittler hat man im alten Afrika nicht gekannt. Das sagt man erst jetzt, beeinflußt von christlichem Denken: man überträgt Denkmuster vom Vermittler Christus auf afrikanische Vorstellungen; ursprünglich war das nicht so. Aber was ist "ursprünglich"?
In Afrika reden wir sehr viel über "Inkulturation", vor allem seit der Afrikanischen Bischofssynode von 1994. Die große Klage bei der Synode war: "Morgens bei der Messe, abends beim Medizinmann". Im Mittelpunkt afrikanischer Religion steht der Kampf gegen Krankheit und Tod. Und da ist man nicht wählerisch: wenn das moderne Krankenhaus hilft, schön und gut. Wenn nicht, geht man zum Medizinmann, zum "Propheten" der einheimischen Sekte oder auch zum Pfarrer der Missionskirche.
Hauptsache man überlebt. Jesus, der heilende Wundertäter, ist enorm attraktiv, womit Sekten, Zeltmissionen und Erweckungskreuzzüge die Massen anziehen. Jesus der Gekreuzigte wird viel weniger verstanden.
Der Mensch in Afrika kommt aus einer Kultur und Lebensform, die ganz und gar von der (Familien-)Gemeinschaft bestimmt ist. Ich bin, was ich für andere bin: Tante, Onkel, älterer oder jüngerer Bruder, Schwester, Nichte, Neffe, Schwiegersohn, Schwiegermutter: die Beziehung, die von diesen Bezeichnungen ausgedrückt wird, ist wichtiger als die Individualität, die vom Namen ausgedrückt wird. Diese überschaubare Dorfgesellschaft läßt keine Außenseiter zu. Es gibt keine Pluralität von Weltanschauungen und Konfessionen, weswegen Toleranz unbekannt ist. Das ist mit ein Grund, warum sich Demokratie in Afrika so schwer tut.
Freilich ist die traditionelle Lebensform schon längst in Frage gestellt und dabei, von einer eng überwachten und scharf kontrollierten Dorfgesellschaft übergangslos in eine traditionslose, überindividualisierte Stadtgesellschaft zu verwandeln. Die Jugend entrinnt der engen Dorfgesellschaft und sucht die Freiheit und Bindungslosigkeit der Stadt, selbst zum Preis von Proletarisierung und wirtschaftlicher Verelendung.
In Afrika gilt: ein Mensch ohne Nachkommen hat nicht gelebt. Er/sie ist eine Nicht-Person. Nach altem Brauch wird in Simbabwe einem Mann oder einer Frau, die jung und ohne Nachkommen gestorben sind, beim Begräbnis eine tote Ratte zwischen die Beine gelegt. "Hier ist dein Kind," heißt es mit beißendem Hohn. Ein Mann oder eine Frau ohne Kinder haben kein Leben als Ahne oder Ahnin. Kinderlosigkeit bedeutet nicht nur geringes Ansehen, wirtschaftliche Unsicherheit, da keine Kinder für die eigene Altersversorgung da sind, es ist auch eine spirituelle und religiöse Katastrophe.
Die Kinderlosen haben eigentlich kein Fortleben nach dem Tode. Denn sie leben ja erst durch die Kinder fort, die den Eltern den Status von Ahnen zuerkennen, indem sie für sie die verschiedenen notwendigen Zeremonien und Feiern nach dem Tode ausrichten. So bewundernswert afrikanische Familienkultur ist, so muß man aber auch fragen: Ist die Frau nicht vor allem Mittel zum Zweck der Nachkommenschaft? Ist das Kind nicht - vor allem in der Situation hoher Kindersterblichkeit - jederzeit ersetzbar durch ein anderes?
Massive Propaganda seitens westlicher Familienplaner sieht afrikanische Bereitschaft zu Fruchtbarkeit als den Feind an, den es zu vernichten gilt. Wer gibt dem Westen das Recht zu dieser massiven Einmischung? Daß die Afrikanische Synode 1994 Kirche für Afrika als "Familie" definiert, ist zugleich Anerkennung der afrikanischen Familienkultur und Warnung vor zerstörerischen Kräften.
Die afrikanische Familienkultur allein hat nicht die Kraft, sich gegen die Bedrohung zu wehren. Zusammen mit nicht mehr annehmbaren Zügen, wie der Herrscherrolle des Mannes und der Mittel-zum-Zweck-Funktion der Frau als Gebärerin, besonders in einer polygamen Familie, könnte sie von einer neuen Generation einfach weggefegt werden. Sie muß "verheiratet" werden mit der christlichen Sicht von der Würde der Person, gerade auch der Frau.
In der Gesellschaft von Simbabwe ist die Frau notwendig als Gebärerin der Kinder des Mannes und der Erhaltung seiner Stammeslinie. Das ist ihre Stärke und ihre Schwäche. Wenn sie dem Mann die gewünschten Kinder beschert, erwirbt sie sich Anerkennung und Autorität, zumindest ihren eigenen Kindern gegenüber. Wenn sie in dieser Hinsicht versagt, ist sie aber überflüssig und ersetzbar. Das Los der kinderlosen, unfruchtbaren Frau ist hart. Da Fruchtbarkeit der höchste Wert ist, dem Liebe und Partnerschaft untergeordnet sind, ist Polygamie die Konsequenz.
Die moderne gebildete Frau lehnt Polygamie jedweder Form ab. Es ist im Prinzip richtig, daß die Kirche auch bei großem Widerstand auf der Einehe besteht, als Bundesgenossin der Frauen. Versuche, die Polygamie zu "taufen", so verständlich solche Versuche im ländlichen Afrika auch sein mögen, sind verkehrt: es ist ein klassisches Beispiel von verfehlter "Inkulturation".
Die Frauen scheinen es der Kirche zu danken. Für sie bedeutet Christsein eine Aufwertung. Für den Mann ist es schwerer: ihm wird ein völliges Umdenken abverlangt, und von ihm wird ein völlig neues Verhältnis zur Frau erwartet und eine ganz neue Art von Ehe.
Simbabwe hat die höchste Zahl von Aidskranken in Afrika: 25 Prozent der Bevölkerung und 30 Prozent aller Schwangeren sind von HIV infiziert. In dieser katastrophalen Situation, die zu einem Bevölkerungsschwund führen könnte, ist der Übergang von sexueller Freizügigkeit zu einer konsequenten Ehemoral eine Frage des schieren Überlebens. Die traditionelle Wehrlosigkeit der Frau wirkt sich katastrophal aus: der Mann mag bei der Arbeit in der Stadt Umgang mit zahlreichen Prostituierten gehabt und sich infiziert haben; wenn er ins heimatliche Dorf kommt, hat die dort verbliebene Ehefrau kein Recht sich ihm zu verweigern. Kondome sind eine Notlösung, die man keiner Frau nehmen darf, sind aber von zweifelhafter Effektivität, und werden von vielen Männern sowieso abgelehnt. In dieser Situation muß die konservative Männergesellschaft massiv - von der Kirche und anderen - herausgefordert werden.
Man könnte sagen, daß afrikanische Kultur und Religion (eine Trennung des sakralen vom säkularen Bereich gibt es nicht) eine Herrschaft der Toten ist. Unter den Lebenden sind es die Alten, die sich der höchsten Autorität und Macht erfreuen. Auch für Christen sind die Toten nicht tot. Die Gemeinschaft der Heiligen, im Credo vom europäischen Christen noch mitrezitiert, aber nicht mehr verstanden, ist der theologische Ort, wo sich Christentum und afrikanische Weltsicht treffen.
Hier ist eine "Taufe" traditioneller Religion versucht worden. Es gibt eine christliche Version der Zeremonien zum "Heimbringen der Toten in ihr Heimatdorf", ein Jahr nach ihrem Tode (von den Bischöfen anerkannt).
Doch ersetzt es wirklich diese alte Sitte, die den Toten zum Ahnen macht? Ein wesentliches Stück fehlt, muß fehlen: der Gang zum Medizinmann, der herausfinden muß, wer den Tod verursacht hat. Hier gibt es im Grunde keinen natürlichen Tod: jeder Tod ist von einem Mißgünstigen durch Hexerei verursacht worden.
So trennen sich doch auch wieder die Wege. Jesus kam um das Reich Gottes zu verkünden. Das Reich Gottes ist nahe, aber es ist noch nicht da und vollendet. Es ist erst im Kommen, es liegt in der Zukunft. Der Glaube eröffnet diese neue Dimension, die es in Afrika kaum gibt. Christen können nur von einem Geist erfüllt sein, vom Heiligen Geist, in dessen Namen sie getauft sind.
Afrika kann noch trauern. Die Toten sind nicht tot. Sie spielen weiterhin eine Rolle. Man fürchtet sie und ehrt sie. Doch die Furcht vor den Toten und die Unterwerfung unter ihre Herrschaft ist christlich in Frage zu stellen. Anderseits wäre es aber eine Tragödie, wenn man, um sich der Furcht vor den Toten zu entledigen, sie selber vergessen und abschreiben wollte, in fataler Nachahmung westlicher Verweigerung des Totengedächtnisses.
Afrikanische Christen lernen allmählich, daß sie es den Toten nicht mehr gestatten dürfen, über sie, die Lebenden, zu herrschen und von ihnen Besitz zu ergreifen, etwa im Phänomen der Besessenheit, in dem das Selbst des Lebenden durch das Selbst des Toten ersetzt wird. Diese Selbstentfremdung ist christlich nicht mehr annehmbar.
Statt dessen erweisen Christen den Toten Ehrfurcht und Liebe, indem sie sie dem lebendigen Gott, der in Christi Tod und Auferstehung seine Macht über den Tod erwiesen hat, anvertrauen und in die Hände geben.
Am Ende dieses mörderischen Jahrhunderts mit seinen Millionen von Ermordeten, Erschlagenen, Vergasten ist diese Solidarität mit den Toten mehr als notwendig. Ebenso wie der Glaube, daß der Tod nicht das letzte Wort hatte über all die Besiegten, Vernichteten, unendlich vielen Verlierer. Dieser Glaube an die "Gemeinschaft der Heiligen", an die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu in uns und unseren Verstorbenen, die Afrika gerade neu entdeckt.
Der Autor, deutscher Jesuit in Harare, leitet das "Social Communications Department" der Kath. Bischofskonferenz von Simbabwe.