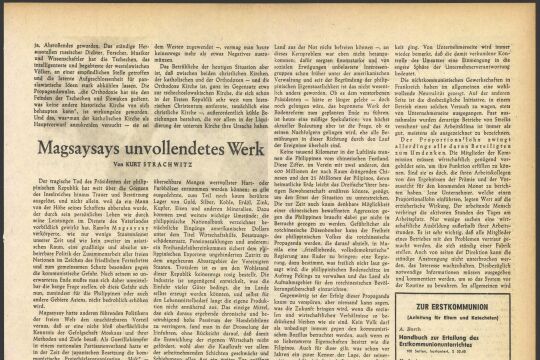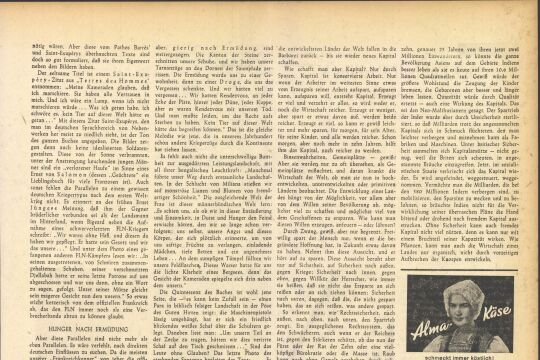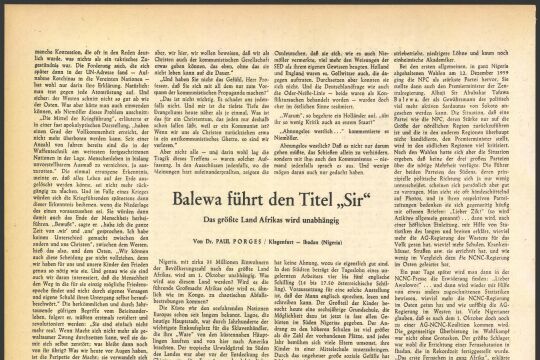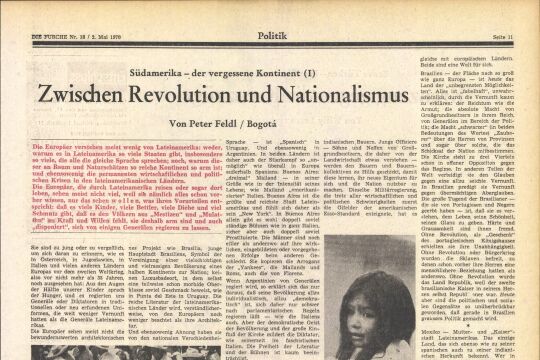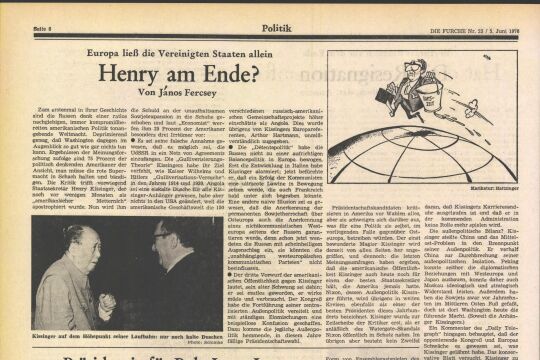Armut hat den Unfrieden gesät
Das Geiseldrama auf Jolo hat die Philippinen in die Schlagzeilen gebracht. Bei Schlagworten bleibt es. Wer fragt nach den Hintergründen für die Radikalisierung?
Das Geiseldrama auf Jolo hat die Philippinen in die Schlagzeilen gebracht. Bei Schlagworten bleibt es. Wer fragt nach den Hintergründen für die Radikalisierung?
Fastet und betet", lautete der Aufruf des Erzbischofs von Manial, Kardinal Jaime Sins, als der Bürgerkrieg auf der Philippineninsel Mindanao erneut aufflammte. Viele Filipinos werden der Forderung des Bischofs nicht haben nachkommen können, weil sie ohnehin nicht genug zu essen haben. Die Armut und die politische Willkür hätten auf Mindanao den Unfrieden gesät, erklärte vergangene Woche das philippinische Pax-Christi-Vorstandsmitglied Cesar Villanueva vor Journalisten in Brüssel.
Die neu erwachte Kraft der Moro Islamic Liberation Front (MILF) macht den 90 Prozent Christen unter den Filipinos Angst. Auch von Christen werden inzwischen Privatarmeen eingerichtet, um die Muslime zu bekämpfen. Mehr als der Bürgerkrieg hat die Region aber die seit Ostern andauernde Geiselnahme von mittlerweile 20 Touristen - am Wochenende wurde ein 29-jähriger Malaysier freigelassen - auf der südphilippinischen Insel Jolo in die Schlagzeilen gebracht. Die Fotos der schwerkranken deutschen Geisel Renate Wallert gehen um die Welt. Journalisten zahlen Rekordsummen für Bildreportagen und Interviews, was die Entführer, Angehörige der muslimischen Terroristengruppe Abu Sayyaf dazu anhält, das Geiseldrama auf unbestimmte Zeit auszudehnen. Trotz der jüngsten politischen Forderungen der Geiselnehmer, ausstehende Lehrergehälter zu zahlen, warnt Villanueva davor, die Abu Sayyaf-Terroristen mit der Islamischen Befreiungsfront gleichzusetzen. Es deutet viel darauf hin, dass es Abu Sayyaf um Geld und weniger um sozialpolitische Veränderungen geht. MILF distanzierte sich auch schon mehrfach von Abu Sayyaf.
Seit 1972 dauert der Sezessionskrieg der islamischen Moros, die für einen eigenen islamischen Staat kämpfen, an. 1996 sorgte ein Friedensabkommen für einen Waffenstillstand. Seit Jänner 1999 kommt es aber wieder zu neuen Auseinandersetzungen, die bislang schon weit über 100.000 Opfer gefordert haben. Die Spirale der Gewalt ist dabei hier wie auch anderswo immer die Gleiche. Wenn Gruppen wie die Moros als Minderheit nicht akzeptiert werden, wenn sie die Staatsmacht sozial, wirtschaftlich oder politisch benachteiligt, und wenn es unter ihnen charismatische Führer gibt, einflussreiche Familien oder Clans, die von dieser Unzufriedenheit profitieren - dann braucht man nicht lange zu warten, bis es zur Explosion kommt.
Die Angst vor neuem Kriegsrecht geht um "Die Philippinen sind heute so gut wie ausverkauft. Wir sind in eine Endphase der Globalisierung geraten. Eine Mehrheit der Menschen lebt wie Sklaven im eigenen Land. Von der zunehmenden Verelendung des Volkes profitieren nur Reiche und die transnationalen Konzerne." Das ist eine knappe Auswahl aus einem Gespräch mit der Leiterin des renomierten YBON-Institutes für Sozial- und Wirtschaftsforschung in Manila, Rosario Bello Guzman. Ihre Aussagen treffen genau die Situation, der man auf den Philippinen täglich begegnet, egal ob man sich auf dem Land oder unter der dicken Smogglocke der Zehn-Millionen-Metropole Manila bewegt.
Neuerdings ist die Zeit des Kriegsrechtes (1972-1980), mit dem das Land von seinem früheren Diktator Ferdinand Marcos unterworfen wurde, immer öfter Gesprächsthema. Die Filipinos haben das Gefühl, die alten Schlüsselfiguren könnten erneut an die Macht drängen. Gewisse Anzeichen sprechen dafür, vor allem als man einen der grausamsten Mörder, Norberto Manero Jr., in den Genuss der Weihnachtsamnestie kommen ließ und den nach dem spektakulären Mord an einem italienischen Missionar zu lebenslanger Haft Verurteilten freisetzte.
Bauern zahlen Preis für Globalisierung Nach der Machtübernahme durch General Fidel Ramos (1992) beruhigte sich die Lage einerseits, andererseits aber begann unter ihm der Ausverkauf der Philippinen an Tempo zuzulegen. Immer mehr Bauern wurden von ihrem Land vertrieben, entweder direkt, oder weil sie dem Druck der Liberalisierung ihrer Produkte weichen mussten. "Unsere Bauern haben den Preis für die Globalisierung bezahlt. 90 Prozent leben unter der Armutsgrenze. In weiten Landstrichen wurde die eigene Reis- und Maisproduktion aufgegeben, weil billige Produkte aus Thailand die Märkte überschwemmten", sagt Frau Guzman. An den durch riesige Fangflotten leergefischten Küsten darben die Fischer mit ihren kleinen Auslegerbooten. "Früher war ich vielleicht zwei, drei Stunden auf See und kam mit einem reichen Fang zurück, von dem wir gut leben konnten. Heute brauche ich oft Tage und Nächte, damit meine Familie sich einmal satt essen kann. Keine Rede von der Belieferung des lokalen Marktes", klagt ein Fischer sein Leid, der immer öfter darüber nachdenkt, wie viele andere in der Stadt sein Glück zu versuchen.
Der Sog, der vom Land in die Stadt zieht, bedeutet allerdings für die meisten, den unumkehrbaren Schritt von der Armut ins Elend zu tun. Theodorus van Loon ist Ständiger Diakon der Diözese Utrecht, der seit 23 Jahren auf den Philippinen lebt und sich sieben Jahre als Fabriksarbeiter verdingte, um den Menschen beizustehen. Jetzt ist er engster Mitarbeiter seines Bischofs. Zur aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt meint er: "Es hat noch nie so viele Arbeitslose gegeben, und niemals - auch nicht unter Marcos - ist es den Arbeitern so schlecht gegangen wie heute. Von dem, was diese Leute verdienen, kann man nicht leben. Zu meiner Zeit als Fabriksarbeiter haben etwa 70 Prozent der Arbeiter den Mindestlohn oder sogar mehr bekommen. Heute sind es etwa 70 Prozent, die weniger als den Mindestlohn verdienen."
Das Stadtbild beweist es: Straßenhändler ohne Zahl, herumlungernde Männer und Frauen, die auf eine Gelegenheitsarbeit warten. Heere von Obdachlosen, die unter den Brücken oder in irgendwelchen dunklen Winkeln dahindämmern. Explodierende Kriminalität und vor allem Prostitution. Auch Kinder müssen sich verkaufen, um überleben zu können. Und dazu noch Massenemigration. Hauptexportartikel der Philippinen 2000: der Mensch.
Seit 1998 gibt es einen neuen Präsidenten, den ehemaligen Seifenopern-Star Erap Joseph Estrada. Seine Popularität hatte ihm den Wahlsieg beschert, denn der Schönling hatte versprochen, ein Präsident für die Armen zu sein. Heute sind seine Beliebtheitswerte im Keller, denn Estrada hat die Verfassung zur Diskussion gestellt, und will, dass ausländische Investoren hundertprozentige Eigentümer ihrer Betriebe sein und auch Land besitzen können. Das war den Einheimischen zuviel und sie begannen, wie einst, protestierend auf die Straße zu drängen.
Paramilitärs gegründet für die Drecksarbeit Die Gewalt eskaliert, und es wird gemunkelt, dass die Armee paramilitärische Gruppen organisiere, um jemanden zu haben, der die Dreckarbeit tut und für Ordnung sorgt. Was das bedeutet, wissen die Menschen , und Angst macht sich breit, denn es ist klar, dass nicht sie, sondern die ausländischen Investoren den Schutz genießen würden.
Wie die Garantie der Regierung für die Profite ausländischer Investoren ausschaut, kann man in Manila sehen. Ein indonesischer Konzern baute eine Hochbahn. Der Fahrpreis wurde mit 27 Pesos festgesetzt. Das kann sich jemand, der mit 200 Pesos oder weniger auskommen muss nicht leisten. Das silberne Bähnchen fährt zwar, aber niemand sitzt drin. Kosten pro Tag acht Millionen Pesos für die indonesische Firma, der man den Gewinn garantiert hatte.
Man hatte den Filipinos immer wieder beteuert, die Lebenssituation aller würde sich langsam aber sicher bessern, denn die ausländischen Investoren schaffen Arbeitsplätze. Es blieb bei den Versprechungen. Die Arbeitsplätze wurden nicht mehr, sondern weniger. Man investiert nicht in Produktionsbetriebe und Arbeitsplätze. Das ins Land fließende Kapital bleibt unter sich und kreist offenkundig gewinnbringend in der reinen Geldwirtschaft, die für das Land nichts abwirft, zumindest nicht für die Mehrheit der Menschen. Produktionsbetriebe gibt es nur in den sogenannten Freien Produktionszonen, in denen ein rechtsfreier Raum entsteht. Diese Zonen befinden sich meist auf Halbinseln, die nur eine gut bewachte Zufahrtsstraße haben. Und dahinter gilt das Gesetz des Stärkeren, und das bedeutet mehr oder weniger Sklaverei, denn die Heere von Arbeitslosen sind bereit, unter allen Konditionen zu arbeiten, was weidlich ausgenützt wird. Die Menschen werden ihrer letzten Würde beraubt.
Spielt der Präsident den Präsidenten nur?
Die Regierung, allen voran Präsident Estrada schauen ungerührt zu, kassieren fette Gehälter und halten auch sonst bereitwillig die Hände auf. "Das Problem ist Estrada selbst", lese ich in der unabhängigen Tageszeitung Inquirer, "er weiß bis heute nicht, ob er ein Präsident ist oder nur einen Präsidenten spielt. Er hat nichts unter Kontrolle, und es interessiert ihn auch nichts, sodass sich immer stärker der Verdacht aufdrängt, dass er nur ein willenloses Werkzeug in der Hand der politischen Kräfte von gestern ist, und das ist die alte Oligarchie. Also alles wie gehabt. Die Frage ist nur, wie lange man die Geduld des Volkes noch strapazieren kann."
Solche Überlegungen kann man immer und überall hören: "Wir rechnen mit einer Radikalisierung des politischen Klimas, und keiner weiß, wohin das noch führen wird." Oder sollte das angepeilt werden, was neoliberale Zyniker mit der Wortschöpfung "Tititainment" bedacht haben, was soviel bedeutet wie versorge die Massen mit dem Allernötigsten, aber unterhalte sie rund um die Uhr. Faktum: In Manila und Umgebung gibt es pro Kopf mehr Fernseh- und Radiostationen als in Amerika.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!