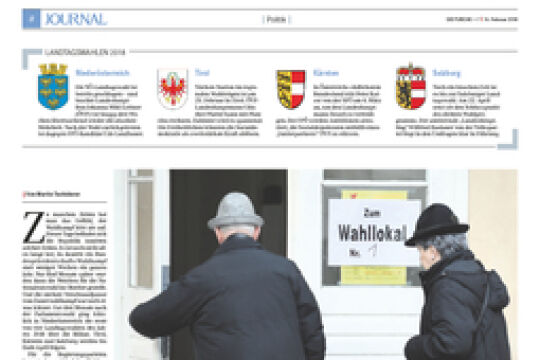Heinz Fischer wurde überzeugend für eine zweite Amtsperiode zum Bundespräsidenten gewählt. Die Thematik einer Wiederwahl des Präsidenten beschäftigt die Parteistrategen. Noch.
Josef Cap, Klubobmann der Sozialdemokraten, ist ein politischer Profi und damit mehr als gelassen: „Natürlich gibt es eine Fülle von Vorschlägen. Aber wir sollten uns das in aller Ruhe ansehen.“
Worauf sich Caps Blick richtet, ist klar: Knapp weniger als die Hälfte der 6,3 Millionen Wahlberechtigten gingen am Sonntag, 25. April, zu den Urnen, um sich an der Wahl des Bundespräsidenten zu beteiligen. Der historische Tiefststand einer Wahlbeteiligung von 49,2 Prozent ließ manche an Österreichs Demokratie und Reife der Wähler zweifeln, Kommentatoren vermuteten das Land gar in Lethargie oder Tiefschlaf. In Tat und Wahrheit liegen die Dinge einfacher, und zwar so, wie es der Klubobmann der Volkspartei, Karlheinz Kopf, ausdrückt: „Es war doch ziemlich offensichtlich, dass der Umstand der Wiederwahl ein Problem schafft. Wie die Erfahrung zeigt, ist es nahezu chancenlos, gegen einen amtierenden Bundespräsidenten anzutreten.“ Jetzt kursieren, darauf bezog sich Cap, zahlreiche Vorschläge, dieses Problem zu lösen, indem man es beseitigt.
Amtsperioden wie in Monarchien
Die nächste mit der heurigen vergleichbaren Situation könnte eintreten, wenn Heinz Fischer seine bis 2016 dauernde zweite Amtsperiode voll ausfüllt, sein dann amtierender Nachfolger ein zweites Mal antritt: 2022 also könnte es, rein rechnerisch betrachtet, wiederum für andere Kandidaten aussichtslos sein, die Wahl um das Amt in der Hofburg zu gewinnen. Der Aussicht darauf wollen einige, allen voran Karlheinz Kopf, einen Riegel vorschieben.
„Wenn wir nicht alle zwölf Jahre so etwas erleben wollen, dann ist es geboten, nach den Landtagswahlen zu überlegen, ob es nicht besser wäre, auf eine zweite Amtsperiode zu verzichten.“ Damit verbunden wäre allerdings eine Verlängerung der ersten auf acht Jahre, und das sei „demokratiepolitisch nicht unkritisch“, wie Kopf anmerkt. Das sieht Cap ähnlich.
Zumindest in Demokratien gäbe es keine monarchistisch anmutenden Amtsperioden von acht Jahren, meint Cap, und verweist auf Frankreich, wo erst im Jahr 2000 die Amtsperiode von sieben auf fünf Jahre verkürzt wurde. Die gegenwärtige Debatte sei ohnedies nur entstanden, weil es die ÖVP abgelehnt habe, einen eigenen Kandidaten zu nominieren. Er sei daher auch skeptisch, jetzt aus den vorliegenden Umständen eine Verfassungsdebatte abzuleiten. Es sollte daher auch bei der Direktwahl des Bundespräsidenten bleiben. So sei er, Cap, zwar für Ideen offen, aber „zwingend gibt es da nichts“.
Ähnlich zurückhaltend reagieren die Grünen, deren Partei- und Klubchefin Eva Glawischnig, ebenfalls von der FURCHE dazu befragt, meinte: „Gegenüber einer Amtsperiode von acht Jahren bin ich sehr skeptisch.“ Zudem würde die Beschränkung auf eine Amtsperiode die Meinungsäußerung der Bürgerinnen und Bürger über diese beschränken. Die Debatte der Wiederwahl kehre stets wieder, je nachdem, welche der beiden Parteien, SPÖ oder ÖVP, nicht obsiegt habe. In Wahrheit ginge es dabei auch um die Kosten eines Wahlkampfes.
In einem spricht sich Glawischnig für eine breit angelegte Verfassungsdebatte aus. Der Druck sei jetzt hoch, die Verfassungsdebatte könnte die nötige Verwaltungsreform stützen. Nach der Landtagswahl in Wien folge eine wahlfreie Zeit bis 2013. Diese sollte genutzt werden, um das Amt des Bundespräsidenten, die Balance zwischen Bund und Ländern sowie den Organen neu zu gestalten.
Die Direktwahl bleibt
Änderungen am Amt sollten nach Ansicht von Bundespräsident Heinz Fischer jedenfalls bald und zügig debattiert werden. Reformen für dieses Amt sollten, wie Fischer in einem Presse-Interview erläuterte, in der ersten Hälfte seiner zweiten Periode, also bis 2013 erledigt werden, um dann nach deren Ende zu gelten. Er ist, wie die meisten Klubchefs im Parlament, für die Volkswahl anstelle etwa einer Wahl durch die Bundesversammlung. Selbst ein von der Hälfte des Volkes mit 80 Prozent gewählter Bundespräsident habe „viel mehr Legitimierung“ als bei einer Wahl durch Wahlmänner.
Wie sehr die Volkswahl beflügeln kann, beweist die Reaktion des mit einem kleinen Achtungserfolg ausgestiegenen deklariert christlichen Kandidaten Rudolf Gehring: Er verlangte auf Basis eines Stimmenanteils von 5,4 Prozent eine Aussprache mit Fischer. Dabei sollten all jene Themen erörtert werden, die im Wahlkampf nicht berücksichtigt worden seien. Für das BZÖ machte es sich dessen Chef Josef Bucher einfacher: Er verlangte, wie schon andere freiheitliche Anhänger autoritärer Strukturen vor ihm, das Amt des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers zusammenzulegen.
Zumindest das wird nicht passieren. Nicht einmal bis 2022.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!