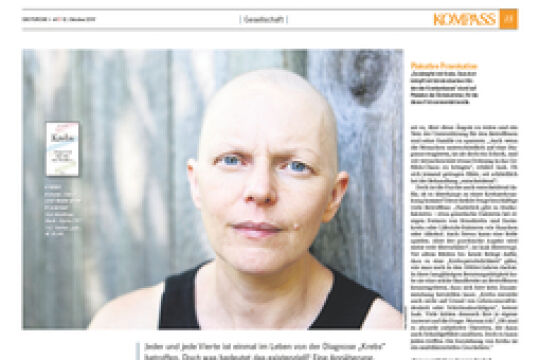Wenn Sie manisch-depressiv sind, hat Ihr Leben keine Kontinuität mehr. Die Person, die Sie zu sein und kennen glaubten, besitzt kein festes Fundament mehr. Sie können sich Ihrer selbst nicht mehr sicher sein." Der in Berlin lebende Schriftsteller Thomas Melle leidet an einer schweren bipolaren Störung: Auf Phasen der Manie, die länger als ein Jahr dauern können und von einer paranoiden Psychose begleitet werden, folgen Phasen schwerster Depression. "Aus dem Nichts wird da einer, den man anders kennt, verrückt, buchstäblich verrückt, und zwar genauer, realer, peinlicher, als es in den Filmen, den Büchern gezeigt wird", schreibt Melle in seinem Buch "Die Welt im Rücken", das im Vorjahr erschienen ist -und dessen gleichnamige Bühnenfassung von Jan Bosse derzeit am Wiener Akademietheater zu sehen ist.
Wenn ich nicht mehr ich bin ...
Drei bis sechs Prozent der Bevölkerung erkranken zumindest einmal in ihrem Leben an einer bipolaren Störung. Daneben gibt es freilich noch jede Menge andere Erkrankungen, die das Wesen eines Menschen verändern können: von der Tumorerkrankung im Stirnhirn bis zur Demenz, von der schon heute 130.000 Menschen in Österreich betroffen sind. Doch was bedeutet eine krankheitsbedingte Persönlichkeitsveränderung für den Betroffenen und sein Umfeld? Und welche ethischen Fragen stellen sich, wenn jemand das beklemmende Gefühl hat, dass "Ich nicht mehr Ich bin"? Darüber wurde unlängst auf der Jahrestagung der "Association of Bioethicists in Central Europe" in Wien diskutiert.
Wobei die Schwierigkeiten schon bei der Definition dessen beginnen, was "Ich" bedeutet, weiß der Münchener Ethiker und Moraltheologe Konrad Hilpert. Denkt man an eine "identity card", so ist Identität etwas Statisches -unverwechselbar festgeschrieben durch Namen, Geburtsdatum, Nationalität und Geschlecht. Doch schon das Foto zeigt, dass wir uns immer auch verändern. Spätestens mit den Entwicklungstheorien von Erik H. Erikson und George H. Mead wurde "Identität" als etwas verstanden, das reifen muss. Diese Prozesse können freilich auch scheitern -besonders in Zeiten der Pluralität, in der jeder aus unterschiedlichsten Wertvorstellungen und Lebensformen seine eigene Identität "basteln" muss. "Identität ist unter den Bedingungen der Moderne und Postmoderne auf jeden Fall anspruchsvoller oder auch strapaziöser geworden, und das Risiko, dass sie nicht gelingt und Personen eine dissoziative Persönlichkeit ausbilden, größer", so Hilpert.
Georg Psota hat als Chefarzt der "Psychosozialen Dienste Wien" häufig mit solchen Fällen zu tun. Er selbst sieht die Persönlichkeit als eine Art "psychischen Körperbau". Die Proportionen könnten sich verändern, aber "man kann aus einem Sprinter keinen Marathonläufer machen", meint der Psychiater. Jemand, der Ordnung brauche, werde selten sehr salopp. "Außer er ist manisch", so Psota.
Insgesamt werden in der Psychiatrie drei Kategorien von Persönlichkeitsstörungen unterschieden: jene mit sonderbarem Verhalten (paranoide, schizoide Persönlichkeitsstörung), jene mit emotionalem, dramatischem Verhalten (antisoziale, narzisstische oder Borderline-Persönlichkeitsstörung) und jene mit Symptomen der Angst und des Abhängigkeitsverhaltens (vermeidend-unsichere, zwanghafte Persönlichkeitsstörung). Die Abgrenzungen - auch zwischen "nicht-gestört" und "gestört" - sind freilich nicht einfach, weiß Psota. Dazu kommt die dunkle Begriffsgeschichte: von der "psychopathischen Persönlichkeit", die quasi zwingend kriminell werden müsse, bis zu Sigmund Freuds "Charakterneurose". Vorurteile gibt es auch bei einzelnen Erkrankungen: "Schizophrenie" etwa hat laut Psota nichts mit einer "gespaltenen Persönlichkeit" zu tun, sondern bezeichnet zeitweilige oder andauernde Veränderungen im Wahrnehmen, Erleben, Denken und Fühlen.
Aus dem Nichts wird da einer, den man anders kennt, verrückt, und zwar genauer, realer, peinlicher, als es in den Filmen gezeigt wird.(Thomas Melle)
Zerstörte Persönlichkeit?
Die Demenz ist ein besonderer Fall -nicht zuletzt, weil sie immer mehr Menschen betrifft. Sie verändert den Menschen, doch zerstört sie seine Persönlichkeit, wie viele fürchten? Georg Psota differenziert. Dramatische Wesensänderungen gäbe es bei der seltenen "Frontotemporalen Demenz" (Morbus Pick), bei der die Zellen im Stirnhirn, dem Sitz der Gefühle, absterben. Mögliche Folgen sind eine dramatische emotionale Verflachung oder auch sexuelle Fixiertheit. Bei der Alzheimererkrankung, die 60 bis 70 Prozent der Demenzen ausmache, sind die Wesensveränderungen hingegen nicht so stark ausgeprägt. Barry Reisberg hat von einer "Retrogenese" gesprochen, bei der die Entwicklungsstadien der Kindheit in umgekehrter Richtung durchlaufen werden: bis hin zu Inkontinenz und Sprachverlust.
"Für mich ist dieser Mensch, auch wenn er eingeschränkte Äußerungsmöglichkeiten hat, noch immer derselbe Mensch", betont Psota. In Zeiten, in denen Autonomie und Kommunikationsfähigkeit als zentrale Kriterien des Personseins gelten, empfinden viele Demenz aber als Schreckensszenario. Dramatisches Beispiel ist Gunter Sachs, der sich 2011 erschossen hat, weil er erkannt habe, dass er "an der ausweglosen Krankheit A." erkrankt sei und die rapide Verschlechterung seines Sprachschatzes zu "gelegentlichen Verzögerungen in Konversationen" führten. Umso herausfordernder ist der Moment der Diagnose, betont der an der Universität Olsztyn lehrende polnische Moraltheologe Marian Machinek. Frühe Diagnosen seien einerseits wichtig, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen, Symptome zu lindern und die Situation einordenbar zu machen. Sie sind für den Betroffenen aber auch erschütternde Erfahrungen, erhöhen das Depressions-und Suizid-Risiko und bedürfen deshalb kommunikativer Kompetenz und Begleitung. "Der Patient hat Anspruch auf wahrhaftige Informationen, doch man muss ihn nicht punktuell und brutal damit konfrontieren," ergänzt Konrad Hilpert.
Für mich ist dieser Mensch, auch wenn er eingeschränkte Äußerungsmöglichkeiten hat, noch immer derselbe Mensch. (Psychiater Georg Psota)
"Bitte nicht totmachen!"
Was heute unerträglich scheint, kann schließlich irgendwann als lebenswert erscheinen. Walter Jens ist ein Beispiel dafür. Der Tübinger Philosoph hatte sich im Falle von Demenz für (verbotene) "aktive Sterbehilfe" ausgesprochen. Als er erkrankte, schien er freilich Gefallen an seinem Leben zu finden. "Nicht totmachen, bitte nicht totmachen!", bat er seine Frau. Umso wichtiger ist für Hilpert, Patientenverfügungen stets situationsabhängig zu interpretieren.
Die größte Herausforderung bleibt freilich, der herrschenden Stigmatisierung kranker und auf andere angewiesener Menschen entgegenzutreten. Für Veronika Prüller-Jagenteufel, Pastoralamtsleiterin der Erzdiözese Wien, ist der wertschätzende Umgang mit Menschen mit Demenz eine zentrale Aufgabe kirchlicher Gemeinschaften -wobei sie drei gemeinsame Grunddimensionen feststellt: die Erfahrung des Fremdseins in der Welt sowie die Notwendigkeit der Gastfreundschaft; die Seelsorge als Ort der Erinnerung ("Gott vergisst mich nicht"); und die Wichtigkeit der Präsenz (Gott als "Ich bin da"). Selbst in den letzten Stadien einer Demenz sei im Zweifel davon auszugehen, dass immer noch Kommunikation und Beziehung stattfinde, ist Prüller-Jagenteufel überzeugt. "Auch wenn Ich nicht mehr Ich bin, dann bin ich hoffentlich immer noch dein Du."
Die Welt im Rücken Von Thomas Melle. Rowohlt 2016.348 Seiten, gebunden, € 20,60
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!