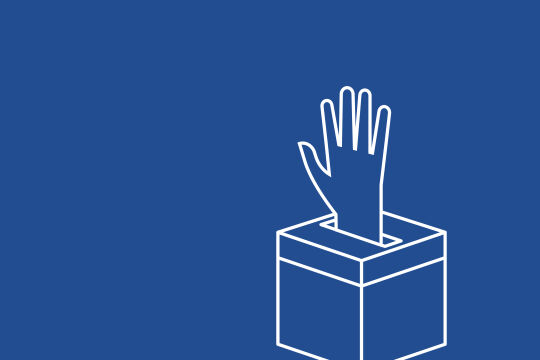Ob durch Wahlen oder Partizipation: Demokratie lebt davon, dass Bürger sie auch emotional erfahren.
Als junger Mensch, der zum ersten Mal an der Wahl des nationalen Parlaments teilnehmen durfte, betrat man das Wahllokal mit erhabenen Gefühlen: Endlich war man vollwertiger Teil der Gesellschaft geworden! Die eigene Meinung hatte genug Gewicht angesetzt, um sie in die große Waagschale der Demokratie zu werfen. Die erniedrigende Zeit des Stimmbruchs war vorbei, jetzt besaß man eine Stimme, die zählte. Das Wissen darum, dass man nur ein winziger Teil in dem großen Ganzen war und die eigene Stimme eine einzelne in einem Chor von Millionen, wurde durch die Tatsache aufgewogen, dass in diesem Chor alle Stimmen gleich laut klangen. Keine zählte mehr als die anderen. Am Tag der Wahl waren alle Bürger gleich, der Schüler dem Lehrer, der Lehrling dem Chef, der Sohn dem Vater ebenbürtig. Weil er diese Ebenbürtigkeit fühlbar machte, hatte der Wahltag etwas Feierliches an sich.
Einige Jahrzehnte und etliche Wahlen später haben sich die feierlichen Gefühle wohl bei den meisten Menschen merklich abgeschwächt, bei vielen gar der Resignation Platz gemacht. Gleich sind wir Wähler vor allem in einem: unserer gefühlten Ohnmacht. "Wenn Wahlen etwas änderten, würde man sie verbieten" - dieser oft zitierte Ausspruch Emma Goldmans ist zwar durch Ereignisse wie den Brexit und Trumps Sieg an den Urnen relativiert worden. Aber die Skepsis gegenüber Wahlen hat sich dadurch nicht verringert, im Gegenteil. Wer heute wählen geht, tut es oft nur, um Schlimmeres zu verhindern, aber nicht aus innerer Zustimmung. Der Eindruck, dass Wahlen die Welt nicht besser, sondern allenfalls schlechter machen, wird noch durch das ermüdende Spektakel des Wahlkampfs verstärkt, das für intelligente und sensible Menschen nur mehr schwer zu ertragen ist. Aus dem "höchsten Feiertag der Demokratie", wie ihn der Bundespräsident genannt hat, ist ein unerfreulicher Pflichttermin geworden.
Skepsis unter Gebildeten
Der Wahlverdruss färbt längst auf die Demokratie insgesamt ab, uralte Vorurteile kommen wieder ans Tageslicht: "Der Mensch ist einfach nicht für die Demokratie geschaffen", war neulich in den für das Studium der bürgerlichen Seele so aufschlussreichen Leserbriefspalten der Presse zu lesen. Solche Skepis hat unter Gebildeten Tradition. Schon Thomas Mann bekannte, die "politische Demokratie niemals lieben (zu) können". Später schwang sich der große Schriftsteller immerhin zum Vernunftrepublikaner auf - eine auch heute geläufige Denkungsart, die in Winston Churchills bekanntem Aperçu ihren Ausdruck findet, "dass Demokratie die schlechteste Form von Regierung ist, mit Ausnahme all jener anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert wurden".
Die Frage ist, ob "Wir, die Bürger(lichen)" uns diese distanziert-unterkühlte Haltung zur Demokratie auf Dauer werden leisten können. Zumindest fragte sich das unlängst, unter der zitierten Überschrift, der deutsche Rechtswissenschaftler Christoph Möllers in der Zeitschrift Merkur. In vielen Staaten sind Kräfte auf dem Vormarsch, die im Namen einer vorgeblichen Volksmehrheit darauf abzielen, die politischen Verhältnisse umzustürzen. Den Vormarsch gäbe es laut Möllers nicht "ohne eine politisch schwach mobilisierte bürgerliche Mitte, die erschrocken zusieht, wie die Welt zerfällt, an der sie hängen sollte, weil sie in ihr ordentlich bis sehr gut, jedenfalls überdurchschnittlich lebt". Hoffentlich sind Möllers Befürchtungen übertrieben, haltlos sind sie gewiss nicht. Der Jurist empfiehlt jedem, "der die Ordnung, so wie sie ist, für schützenswert hält, (...) in politische Parteien einzutreten und einen relevanten Teil seiner Zeit in ihnen zu verbringen", obwohl Parteiarbeit, wie er selbst zugibt, "als kleinkariert und unglamourös gilt -und zwar absolut zu Recht".
Mehr als Likes und Tweets
Nachdem dieser Aufruf doch sehr nach Schwarzbrot und Sauerbier klingt, werden ihm kaum viele Menschen folgen -auch wenn die hunderttausenden Follower der Sebastian Kurz-Bewegung aktuell das Gegenteil suggerieren. Den Like-Button zu drücken oder einen Tweet abzusondern, ist aber nicht dasselbe, wie aktiv am mühsamen Willensbildungsprozess einer Partei teilzunehmen, und es bleibt abzuwarten, ob aus momentaner Zustimmung auch politische Partizipation wird, die über den Wahltag hinausgeht. Wenn hier denn echte Mitbestimmung zur Wahl steht und nicht bloß ein wohlfeiles Identifikationsangebot.
Aber wer sagt überhaupt, dass Wahlen und Demokratie dasselbe sind? Der belgische Autor David Van Reybrouck erinnerte in seinem lesenswerten Büchlein "Gegen Wahlen" daran, dass die Gründerväter der US-amerikanischen Verfassung sich seinerzeit für Wahlen und damit bewusst gegen Demokratie entschieden, weil ihrer Ansicht nach nur so gesichert war, dass die höchsten Ämter des Staates von den fähigsten Bürgern bekleidet würden. Alexander Hamilton und seine Mitstreiter wollten dezidiert keine direkte Herrschaft des Volkes, wohl aber eine Republik, die von dessen gewählten Repräsentanten regiert wird.
Heute fühlt sich ein erheblicher Teil des Volkes von den Repräsentanten, die zur Wahl stehen, nicht mehr repräsentiert - mit fatalen Konsequenzen für das Gemeinwesen. Daher schlägt Van Reybrouck nach Studium der antiken griechischen Polis vor, das Element des Loses in die modernen Verfassungen einzuführen, ähnlich wie es bei Schöffen und Geschworenen praktiziert wird: Demnach kann jeder Bürger durch das Los für eine gewisse Zeit in ein Amt berufen werden, und er kann die Berufung nur aus zwingenden Gründen ablehnen. Während dieses Verfahren für die Wahl der Regierung wenig Sinn machen würde, wie Van Reybrouck einräumt, könnte man es in der Gesetzgebung durchaus mit Gewinn anwenden, etwa als Teil eines Zwei-Kammer-Systems. Dadurch würde die Politik einerseits entprofessionalisiert, andererseits wären die Bürger wieder mehr an ihr beteiligt. Derartige Ansätze zu partizipativer Demokratie werden bereits mit Erfolg erprobt, von Kanada über Irland bis Vorarlberg.
Wo keine Gefühle mehr, da kein Leben: Das gilt erst recht für das Gemeinwesen. Denn Demokratie ist kein blutleeres sozialtechnisches Verfahren, sondern zuallererst ein Lebensgefühl.
Demokratie als ständige Übung
Ob durch Wahlen oder Partizipation -eine Demokratie lebt davon, dass ihre Bürger sie auch emotional erfahren, ihre feierlichen Momente ebenso wie ihre alltäglichen und ärgerlichen. Wo keine Gefühle mehr, da kein Leben: Das gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für Beziehungen zwischen Menschen und erst recht für das Gemeinwesen. Demokratie ist kein blutleeres sozialtechnisches Verfahren, sondern zuallererst ein Lebensgefühl. Ihre Stärkung muss daher viel tiefer ansetzen. In den vergangenen Semesterferien standen wir mit Freunden auf der Skipiste, vor uns verschiedene Abfahrten. Die Kinder stritten lauthals darum, welche wir nehmen sollten. Nach einer Weile rief eine Mutter entnervt: "Schluss mit der Diskussion! Wenn ihr euch nicht einigen könnt, sagen wir halt, wo es lang geht." So geschah es dann auch.
Statt den Kindern die Entscheidung abzunehmen, hätten wir ihnen helfen können, gemeinsam eine Lösung zu finden, zum Beispiel durch Abstimmung oder einen Kompromiss. Dann hätten sie eine demokratische Urerfahrung gemacht: Ich bin Teil einer Gruppe, in der meine Stimme zählt, genauso wie die der anderen Teile. Stattdessen haben wir sie zum Verstummen gebracht und von oben herab ein Machtwort gesprochen. Diese Episode ist nur eines von unzähligen Beispielen, die jeder sicherlich aus eigenen Erfahrungen bestätigen kann, ob in der Familie, in der Schule, in der Firma, im Verein oder in der Gemeinde.
Das Thema Demokratie wird sich daher mit der Nationalratswahl nicht erledigt haben, nicht einmal für die nächsten fünf Jahre. Orte und Gelegenheiten, auch nach dem Wahltag Demokratie zu üben, gäbe es jedenfalls genug.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!