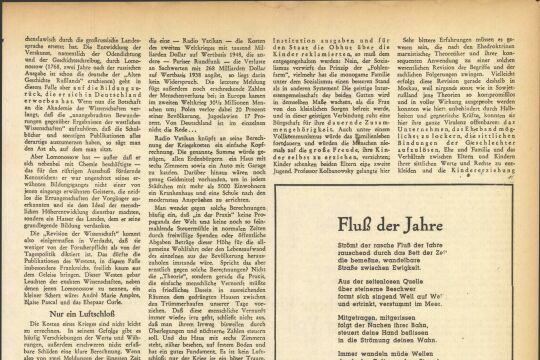Identitätspolitik
DISKURS
Contra Gendern: Zwischen Symbol und Verblendung
Die Kritik am generischen Maskulinum überzeugt nicht. Oft dienen Genderstern und Co ihren Nutzerinnen und Nutzern eher als Ausweis dafür, einer – meist akademischen – Elite anzugehören.
Die Kritik am generischen Maskulinum überzeugt nicht. Oft dienen Genderstern und Co ihren Nutzerinnen und Nutzern eher als Ausweis dafür, einer – meist akademischen – Elite anzugehören.
Wenn es darum geht, Menschen vom Gendern zu überzeugen, wird sehr gerne folgendes Beispiel gewählt: Vater und Sohn fahren im Auto. Sie haben einen schweren Unfall, bei dem der Vater sofort stirbt. Der Junge wird mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Operation wird vorbereitet, alles ist fertig, als der Chefchirurg erscheint, blass wird und sagt: „Ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn!“
Die Frage, die Genderbefürworter ihren Lesern oder Workshopteilnehmern dann stellen, lautet: In welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen der Chirurg und das Kind? Die suggerierte „Auflösung“: Es ist die Mutter, die Chirurgin. Da staunt der Fachmann, und der Laie wundert sich: Wie kann das sein? Die Wahrheit ist, dass es keine ist. Zwar bemühen viele Genderbefürworter (in diesem Fall das Frauenreferat der Stadt Frankfurt am Main) dieses Beispiel, um den männlichen Bias des geschlechtsabstrahierenden, generischen Maskulinums zu bezeugen. Was sie jedoch verkennen, ist, dass der Chefchirurg, der im OP erscheint, eine spezifische Person ist – der Gebrauch einer generischen Form also gar nicht angebracht ist.
Das wahre Problem ist ein soziales
Nicht einmal der schärfste Gendersprachgegner würde sagen, dass er seinen Nachbarn besucht, wenn der Nachbar eine Nachbarin ist. Doch wie kommt es zu solchen argumentativen Darbietungen? Das obige Exzerpt basiert auf einer Studie von Stoeger, Ziegler und David (2004). Dort heißt es: „The specialist comes, looks at the young man on the operating table and proclaims, I cannot operate on him, he is my son.“
Dies zeigt ganz wunderbar, dass das wahre Problem kein sprachliches, sondern ein soziales ist, denn im Englischen sind Nomen genuslos (und bis auf wenige Ausnahmen wie princess oder stewardess auch sexuslos). Die Krux ist, dass unter den specialists Männer überrepräsentiert sind. Mit Sprache hat das nichts zu tun. Ein anderes Pro-Argument, das immer wieder ins Feld geführt wird, ist der populäre Irrtum, dass Sprache unser Denken determiniert. Tut sie aber nicht – wenn dem so wäre, wäre theoretisch möglich, dass Sprecher einer Sprache per se klüger sind als Sprecher einer anderen. Möchte das tatsächlich jemand ernsthaft glauben? Hoffentlich nicht.
Großer Beliebtheit erfreuen sich auch Assoziationsstudien. Hier wird regelmäßig „bewiesen“, dass Probanden Maskulina nicht generisch, sondern spezifisch männlich interpretieren. Dabei wird ausgeblendet, dass Assoziationen kontextabhängig und subjektiv sind.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!