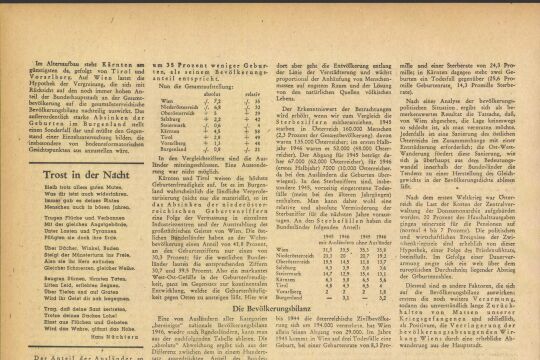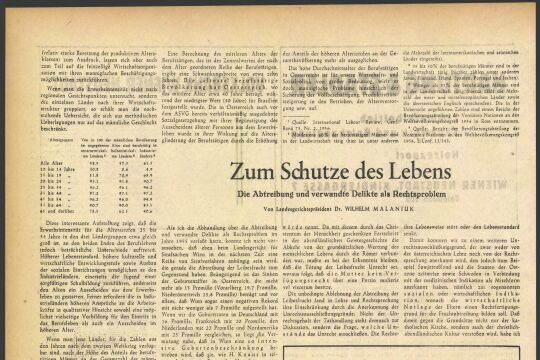Abtreibung: Das ewig ungelöste Dilemma
Endlich eine Statistik? Oder Abtreibungen auf Krankenschein? Nach 40 Jahren wird noch immer um die "Fristenregelung" gerungen. Eine Analyse.
Endlich eine Statistik? Oder Abtreibungen auf Krankenschein? Nach 40 Jahren wird noch immer um die "Fristenregelung" gerungen. Eine Analyse.
Es ist Mittwoch, der 9. Februar 2011. Ingrid Geyer-Fritz, damals 46-jährige Mutter dreier pubertierender Kinder, wartet in der Wiener Privatklinik "Goldenes Kreuz" auf ihren Ultraschall. Hierhergeschickt hat sie ihre Frauenärztin, bei der sie wegen "Wechselbeschwerden" seit Monaten in Behandlung ist und die gemeint hat, dass sie so etwas wie Verhütung nicht mehr brauche. Doch beim letzten Bluttest waren die Hormonwerte außer Rand und Band. "Wahrscheinlich ein Myom", meinte die Medizinerin. Ein Irrtum, wie sich im Spital zeigen sollte: Die vermeintliche Gebärmutterwucherung entpuppt sich als Fötus in der zehnten Schwangerschaftswoche. Geschockt fährt Geyer-Fritz zu ihrer Ärztin, knallt das Ultraschallbild auf den Tisch und fragt: "Was mache ich jetzt?" "Das machen wir schon", lautet die Antwort.
Worte, die Geyer-Fritz als "Todesurteil" für ihr Kind empfindet - wie auch die Bemerkung "vielleicht wird es gar ein Mongolchen!". Am nächsten Vormittag, nach einer durchweinten Nacht und dem Gespräch mit ihrem ebenso ratlosen Mann, betritt das Paar die Privatordination jenes Mediziners, den ihr die Ärztin vermittelt hat. Außer ihnen ist niemand in der Praxis. "Wir haben gehofft, dass uns jemand fragt: Haben Sie sich das auch überlegt?", erzählt die heute 51-Jährige. Aber auch dieser Arzt redet nicht. Über eine Stunde dauert der Eingriff, bezahlt wird bar auf die Hand. Danach fährt Geyer-Fritz nach Hause, steckt ihr Gewand in eine Mülltonne und würde sich "am liebsten dazustecken", wie sie sagt. Es folgten eine Ehekrise und schwere Depressionen.
Streit um die Statistik
Wieviele Frauen in Österreich ähnliche Erfahrungen mit inkompetenten Ärzten, "inoffiziellen" Schwangerschaftsabbrüchen und posttraumatischen Belastungsstörungen haben, weiß man nicht - wie so vieles, was das Thema Abtreibung betrifft. 40 Jahre nach Inkrafttreten der "Fristenregelung" am 1. Jänner 1975 (siehe rechts) verläuft die Debatte noch immer entlang der alten, weltanschaulichen Kampflinien - und weitgehend faktenbefreit. Seit Jahren fordert der Verein "Aktion Leben" etwa Klarheit über die Zahl der Abtreibungen in Österreich. Im Rahmen der parlamentarischen Bürgerinitiative "Fakten helfen!" hat man zuletzt rund 50.000 Unterschriften gesammelt - nicht nur für eine jährliche, anonyme Schwangerschaftsabbruch-Statistik, sondern auch für die wissenschaftliche Erforschung der zugrunde liegenden Motive. SPÖ und Grüne sind jedoch dagegen: Man fürchtet, dass der Druck auf Frauen steigen würde -und unausgesprochen wohl, dass die Zahlen instrumentalisiert werden könnten, um die Fristenregelung an sich zu kippen. Für den Verein "Aktion Leben", der sich von militanten "Lebensschützern" wie der Organisation "Human Life International" distanziert, ist das freilich kein Thema. Es gehe darum, sich "endlich sachlich und unaufgeregt mit dem Thema zu beschäftigen".
Ein Wunsch, den Christian Fiala eigentlich teilen müsste. Trotzdem ist der Betreiber des Ambulatoriums "Gynmed" mit Sitz in Wien und Salzburg, der die Zahl der Abbrüche in Österreich auf etwa 30.000 schätzt, ein vehementer Gegner von Statistiken. Seine Behauptung: Erst wenn Abbrüche von der Krankenkasse finanziert würden, könne es valide Daten geben.
Nicht nur Fiala, auch die Grünen und der (offiziell parteiunabhängige) "Österreichische Frauenring" haben zuletzt Abbrüche auf Krankenschein sowie Angebote an allen öffentlichen Spitälern gefordert. Während es in Vorarlberg und Tirol jeweils nur einen niedergelassenen Arzt gibt, der Abbrüche vornimmt, erhalten Frauen in Wien sogar einen einmaligen Zuschuss, sofern ihr Einkommen unter 870 Euro liegt. (Wie häufig er pro Jahr ausbezahlt wird, will die zuständige Magistratsabteilung 40 nicht verraten.) Voraussetzung einer öffentlichen Finanzierung wäre freilich die Herausnahme von Abtreibungen aus dem Strafgesetz. Für "Aktion Leben" eine "Bagatellisierung" des Problems: Schließlich sei die Fristenregelung ein mühsam errungener "Kompromiss zwischen der Entscheidungsfreiheit von Frauen und der Tatsache, dass es immer um das Leben eines Kindes geht".
Heftig umstritten ist seit Jahren auch, was mit der "embryopathischen Indikation" geschehen soll, die bei Verdacht auf eine "ernste Gefahr" einer schweren geistigen oder körperlichen Schädigung des Kindes theoretisch eine Abtreibung bis zur Geburt straffrei lässt. In Deutschland wurde diese Indikation 1995 wegen der offensichtlichen Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen abgeschafft. Dennoch ist ein Spätabbruch jenseits der zwölften Woche weiter möglich, sofern die Gefahr einer "schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren" besteht ("medizinische Indikation"). Für viele ein Etikettenschwindel, zumal die Zahl der Spätabtreibungen dadurch nicht gesenkt werden konnte. Dennoch fordert etwa Behindertenanwalt Erwin Buchinger auch in Österreich eine Abschaffung dieses Paragraphen: Er sei "ein Schlag ins Gesicht von Behinderten".
Mehr Aufklärung und Beratung
Einvernehmlich gefordert wird indes eine bessere Aufklärung an den Schulen. Der neue Grundsatzerlass zur Sexualpädagogik gibt bereits den Rahmen vor, doch fehlen die Mittel, um sich externe Workshops, die den Fokus auch auf die Dialog- und Beziehungsfähigkeit legen, leisten zu können (vgl. nächstwöchige FURCHE). Auch für die Bewerbung von Beratungsangeboten gibt es zu wenig Geld, kritisiert "Aktion Leben". Zuletzt seien etwa die Mittel für die U-Bahn-Plakate drastisch gekürzt worden. Eine verpflichtende psychosoziale Beratung vor einem Abbruch (wie in Deutschland) wünscht man sich dennoch nicht. "Beratung kann nur freiwillig gelingen", ist man überzeugt. Die meisten Frauen in Konfliktsituationen hätten jedenfalls mit einem Bündel an Problemen zu kämpfen: von der drohenden Alleinerzieherinnenschaft bis hin zu finanziellen Ängsten. Umso wichtiger sei etwa ein Hilfsfonds für Schwangere in Not, wie es ihn in Deutschland gibt.
Doch auch Frauen nach einem Abbruch brauchen Hilfe. Das "Post-Abortion-Syndrom", das häufig als Kampfvokabel von "radikalen Gruppen" verwendet wird, ist zwar als psychische Störung nicht anerkannt; dennoch stelle eine Abtreibung ein "schwerwiegendes Lebensereignis" dar, weiß die Psychologin und Sozialarbeiterin Christine Loidl, die für "Aktion Leben" beratend tätig ist. "Wie gut man das integrieren kann, hängt von der psychischen Vorgeschichte ab - und davon, wieviel Hilfe man bekommt." Ingrid Geyer-Fritz hat ihre überstürzte Abtreibung nur durch eine zweieinhalbjährige Therapie verarbeiten können - und trotzdem kommt zu Allerheiligen, zu Weihnachten oder am 9. Februar die Trauer hoch. "Man darf niemanden verurteilen", sagt sie, "aber ich würde mir wünschen, dass jede Frau darüber aufgeklärt wird, dass das Leben womöglich nicht mehr dasselbe ist wie davor."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!