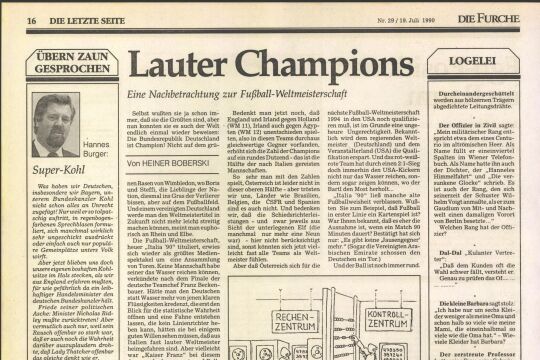Rituale schaffen Gemeinschaft. Sie funktionieren aber auch als Gewaltvermeidungsstrategien. Dafür bietet gerade der Fußball und seine (friedlichen) Fangemeinschaften ein schönes Beispiel.
Rituale: Da denkt der zivilisierte Westeuropäer gleich an Wilde und Primitive. An Regentanz, blutende Kühe und fremde Völker in spiritueller Ekstase. Aber für jede Gesellschaft sind Rituale unverzichtbar, haben Forscher jüngst auf einer Konferenz in Berlin bekräftigt. Sie gehören zu den Grundbedingungen des Menschseins. Um sie zu erleben muss man nicht unbedingt in die vermeintlichen Sozialtiefen von Fußballplätzen hinabsteigen.
Taufe oder Weihnachten zu feiern sind kirchlich geprägte Riten. Übergangsrituale, die die Grenze zwischen zwei Lebensabschnitten markieren, haben tiefe psychische Wirkung. Egal, ob es sich um den Polterabend oder eine Trauerfeier handelt. Der Indologe Axel Michaels von der Universität Heidelberg macht ein Ritual am Besonderen fest, an der festlichen Kleidung, an formellen Abläufen, an einer Ritualgrammatik. Rituale schaffen Gemeinschaft. Sie funktionieren, weil sie nicht jedes Mal neu ausverhandelt werden müssen, und schaffen eine sinnlich erfahrbare Verbindlichkeit für abstrakte Realitäten – wie Glaubens-, Kultur- oder Moralsysteme –, mit denen sie im Kontext stehen. Wie anders, als mit einem Blick in die Geschichte, wäre sonst die Antipathie heimischer Fußballfans gegenüber Deutschland zu erklären? Jeder adoleszente Österreicher kennt Krankl und Cordoba.
Quintessenz Fußballheld
Maradona und Messi verkörpern für Argentinier die Quintessenz ihres Landes. Sie lernten das Spiel auf rumpeligen Stadtplätzen, mit Witz und kindlicher Fantasie. „Oder Pelé“, sagt Otmar Weiß, Soziologe und Sportwissenschaftler an der Uni Wien. „Er ist für Brasilien immer noch das kulturelle Ideal schlechthin. Sportler repräsentieren kollektive Identitäten über ihren Körper. Sie selbst brauchen gar nichts reden.“ Das wichtigste Ritual beim Fußball sei aber der Krieg ohne Waffen. Fans sind Schlachtenbummler, bemalen sich, tragen Fahnen. Dienen die Gesänge zur Demonstration von Stärke und Einschüchterung des Gegners, wird der Leiberltausch nach Schlusspfiff auch als Friedensangebot gedeutet.
Der Fundus an persönlichen Ritualen von Sportlern, die oft in Ticks ausarten, ist reichhaltig. Kolo Touré, ein Spieler der Elfenbeinküste in den Diensten von Arsenal London, läuft immer als Letzter auf das Spielfeld. Als sich beim Champions League Achtelfinale 2009 ein Mitspieler kurz vor der Halbzeit verletzt hatte, und noch behandelt werden musste, verließ auch Touré die Kabine nicht. Sein Team musste mit einem Mann weniger anfangen. Vom Tennisspieler Goran Ivanisevic heißt es, er habe sich vor seinem Wimbledon-Sieg 2001 jeden Morgen, 15 Tage lang, die Teletubbies im Frühstücksfernsehen angeschaut.
„Es braucht Rituale, um das Unbegehbare begehbar zu machen“, sagt Leopold Neuhold, Theologe an der Uni Graz. „Im Fußball ist eine Offenheit für Religion da, weil Krieg und Religion eng beieinander liegen. Es geht um eine Kontingenzbewältigung.“ Soll heißen um die Minimierung des Risikos, in der Auseinandersetzung mit dem Gegner enttäuscht zu werden. Und der Fußball ist voller Ungewissheiten. Welcher Moment entscheidet? Wer hat Glück und wer hat Pech, beziehungsweise wem ist der Fußballgott hold? Also heißt es singen, dem Ball mit kollektiven Handbewegungen den Weg weisen. Den Zufall zu akzeptieren fällt eben schwer. Wer das entscheidende Tor erzielt, wird als Erlöser der Massen gefeiert. In der Urform des Fußballs, bei den Azteken in Mexiko, ging dieses „einer für alle“ so weit, dass dem Kapitän der siegreichen Mannschaft die große Ehre zuteil wurde, sich für die Götter den Kopf abschlagen zu lassen.
Heute werden die Spieler selbst zu Göttern hochstilisiert. Ein gut geöltes Geschäftsritual von FIFA und Medien, an dem keine Kritik geduldet wird. In den FIFA-10-Geboten heißt es in Regel neun: „Denunziere jene, die versuchen unseren Sport in Misskredit zu bringen.“ Das Steigern der Umsätze mittels religiöser Elemente hält Neuhold für problematisch: „Sport darf nicht zur Religion werden, sonst wird es gefährlich. Selbst in der Deutung muss Fußball immer ein Spiel bleiben. Selbstdistanz und Ironie sind wichtig.“ Jetzt werden die Stars erst einmal Kultur zu spüren bekommen. Das dumpfe Brummen tausender Vuvuzelas, dieser beliebten Plastik-Tröten, verwandelt ganze Stadien in gefühlte Bienenstöcke. Afrika fiebert dieser WM entgegen. Das Selbstwertgefühl eines ganzen Kontinents verknüpft sich damit. Wem das zu viel ist, kann es mit Martin Walser halten: „Sinnloser als Fußball ist nur noch eines: Nachdenken über Fußball.“ Dabei sollte man nicht vergessen, dass ein paar Milliarden Menschen anderer Meinung sind. Inklusive Nelson Mandela.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!