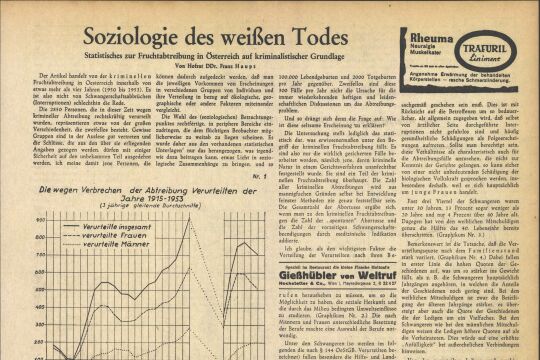Birgitt Haller über mangelnden Gewaltschutz: "Das ist unerträglich!"
Birgitt Haller, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Konfliktforschung in Wien und Expertin zum Thema Gewalt in der Familie, über die mangelnde Bewusstseinsbildung bei Richterinnen und Richtern, zu wenige Anti-Gewalt-Trainings für Täter und fehlendes Wissen über die Situation betroffener Kinder.
Birgitt Haller, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Konfliktforschung in Wien und Expertin zum Thema Gewalt in der Familie, über die mangelnde Bewusstseinsbildung bei Richterinnen und Richtern, zu wenige Anti-Gewalt-Trainings für Täter und fehlendes Wissen über die Situation betroffener Kinder.
DIE FURCHE: Frau Haller, hinsichtlich der Häufigkeit familiärer Gewalt gibt es viele Mutmaßungen. Nimmt Gewalt in der Familie nun zu - oder eher die Sensibilität für dieses Thema?
Birgitt Haller: Offenkundig ist, dass es bei der Polizei eine Veränderung im Einschreitungsverhalten gibt. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Wegweisungen und Betretungsverbote sukzessive gestiegen. Besonders signifikant ist die Steigerung vom Jahr 2004 auf 2005: von rund 4700 auf 5600 Wegweisungen. Gleichzeitig ist die Zahl der so genannten "Streitschlichtungen" tendenziell gesunken. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Exekutive in den neun Jahren seit Einführung des Gewaltschutzgesetzes gelernt hat, besser zu prüfen, was Gewalt in der Familie bedeutet, und adäquater einzuschreiten - nämlich mit Betretungsverboten und nicht mit dem Ausweichen auf Streitschlichtungen.
DIE FURCHE: Inwiefern sind Streitschlichtungen problematisch?
Haller: Die Botschaft bei Streitschlichtungen lautet: "Da können wir nichts tun!" Die Message beim Betretungsverbot ist hingegen: "Gewalttäter, du hast Grenzen überschritten, wir setzen dir jetzt von staatlicher Seite welche und weisen dich weg!" Allein die Bezeichnung "Streitschlichtung" legt ja nahe, dass sich hier zwei nur streiten - fast nach dem Motto "Pack schlägt sich, Pack verträgt sich". Dieser Zugang bedeutet aber auch, dass man Opfer und Täter nicht unterscheidet. Was fehlt, ist die deutliche Reaktion: "Mann, du bist gewalttätig!" In immerhin 95 Prozent der Fälle, die bei den Interventionsstellen gemeldet werden, sind ja Frauen die Gewaltopfer. Es handelt sich also grundsätzlich um eine Gewaltausübung von Männern gegenüber Frauen.
Die Furche: Laut Gewaltschutzgesetz gilt eine Wegweisung zehn Tage lang - mit Option auf Verlängerung auf 20 Tage . Um Sie auf drei Monate auszudehnen, bedarf es einer "einstweiligen Verfügung". Halten Sie diese Fristen für ausreichend?
Haller: Am Anfang der Geltung des Gewaltschutzgesetzes hat die erste Frist für eine Wegweisung überhaupt nur eine Woche betragen. Erst nach einem Aufschrei der Interventionsstellen wurde sie auf zehn Tage - mit Verlängerung auf 20 Tage bei Antrag auf einstweilige Verfügung - ausgedehnt. Es war offenkundig, dass diese kurze Zeit für Frauen, die einen längeren Anreiseweg zu den Interventionsstellen haben, nicht reicht. Diese Stellen sind ja grundsätzlich in den Landeshauptstädten angesiedelt - mit wenigen Außenstellen in großen Bundesländern. Man muss auch bedenken, dass ein Gewaltopfer unter Schock steht und Zeit braucht, um sich zu "fangen" und zu organisieren. Der andere Punkt ist, dass es bei Gericht grundsätzlich ausreicht, durch Befragung des Opfers die Entscheidungsgrundlagen zu erheben. Es ist ja im Prinzip nicht vorgesehen, sowohl den Antragsteller wie auch den Antragsgegner zu hören, wie es bei einem förmlichen Gerichtsverfahren wäre, sondern es reicht ein verkürztes Verfahren. Deshalb sollten auch die zweiten zehn Tage für einen Richter oder eine Richterin ausreichen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Dass es aber in der Praxis immer wieder Probleme gibt, ist offenkundig.
DIE FURCHE: Welche zum Beispiel?
Haller: Es gab etwa vor einem Jahr ein Verfahren gegen die Republik Österreich, weil die Staatsanwälte untätig waren und damit die Ermordung einer Ehefrau mitverschuldet hatten. Dass sich die Justiz beim Gewaltschutz nicht so eindeutig verhält wie die Polizei, zeichnet sich von vornherein ab. Ich habe 2002 in einer Studie zum Gewaltschutzgesetz bei zwei Staatsanwaltschaften in Wien und Salzburg die Justizakten zu familiärer Gewalt untersucht. Und es war offenkundig, dass bei jeder zweiten Anzeige wegen Körperverletzung und bei mehr als 60 Prozent der Anzeigen wegen einer gefährlichen Drohung kein Verfahren eingeleitet wurde. Das ist zum Teil nachvollziehbar, etwa wenn das Opfer die Aussage verweigert oder wenn es bei einer gefährlichen Drohung keine Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt. Aber es war doch auffällig, dass immer wieder Verfahren eingestellt wurden mit dem Argument "mangelnde Strafwürdigkeit der Tat". Stattdessen wurden gefährliche Drohungen als "milieubedingte Unmutsäußerungen" bezeichnet: Das spiegelt Haltungen in der Richterschaft wider, die Gewalt in der Familie - anders als die Polizei - nicht so ernst nimmt und auch nicht so gut geschult ist, bis hin zu männlicher Kameraderie.
Die Furche: Inwiefern ist es problematisch, dass es Richterinnen und Richtern frei steht, auch Opfer und Täter gleichzeitig anzuhören?
Haller: Das ist unerträglich! Bei familiärer Gewalt ist es ein wichtiger Grundsatz, dass das Opfer nicht gemeinsam mit dem Täter vor dem Richter stehen sollte, denn es steht ja unter Stress und hat Angst.
Die Furche: Derzeit muss ein Opfer von "gefährlicher Drohung" im Familienkreis von sich aus den Staatsanwalt ermächtigen, die Tat zu verfolgen. Wie bewerten Sie diese Regelung?
Haller: Das heißt, dass das Opfer bis zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung sagen kann: Ich ziehe diese Ermächtigung zurück, ich will nicht, dass der Täter verfolgt wird - und damit hat die Justiz keine Handhabe mehr, das Delikt weiter zu verfolgen. Die Justizministerin hat mehrfach angekündigt, diese Gestaltung als Ermächtigungsdelikt aufzuheben, was auch eine jahrelange Forderung der Interventionsstellen ist. Es ist ja widersinnig, von einer Frau, die in Angst vor ihrem Mann lebt, zu erwarten, dass sie dem Staat die Erlaubnis zu seiner Verfolgung gibt.
DIE FURCHE:Es müsste also ein Offizialdelikt mit automatischer Verfolgung des Staates werden?
Haller: Ja. Ob es dazu kommt, hängt davon ab, ob der Staat weiterhin familiäre Gewalt tendenziell als etwas Besonderes, Privates behandeln will oder ob er familiäre Gewalt wie Gewalt in jedem anderen Kontext behandelt. Aber wenn Gewalt Gewalt ist, dann muss sie von staatlicher Seite verfolgt werden. Alles andere wäre inkonsequent.
DIE FURCHE: Seit 1. Juli ist das neue Anti-Stalking-Gesetz in Kraft. Sind Sie damit zufrieden?
Haller: Ich bin sehr froh, dass es dieses Gesetz gibt. Aber mein Haupteinwand dagegen ist, dass Maßnahmen gegen Stalking nur über Gericht erreicht werden können - ähnlich wie bei der einstweiligen Verfügung: Eine weiter gehende Forderung wäre gewesen, dass Maßnahmen gegen Stalking - ähnlich wie das Betretungsverbot -unmittelbar von der Polizei gesetzt werden können. Doch das wurde nicht erfüllt. Insgesamt ist es noch zu früh, um feststellen zu können, wie sich das Gesetz bewährt. Dass eine dringende Notwendigkeit dafür bestanden hat, ist aber ganz eindeutig.
DIE FURCHE: Für wie notwendig erachten Sie den Ausbau der "Täterarbeit" ?
Haller: Auch hier orte ich gewisse Vorbehalte von Seiten der Justiz, gewalttätige Männer einem Anti-Gewalt-Training zuzuweisen. Da greift ein Glied ins andere: Wenn man tendenziell familiäre Gewalt nicht weiter verfolgt, weil sie eben nicht strafwürdig sei, dann sieht man auch nicht die Notwendigkeit, auch präventiv zu stützen. In Wien gibt es wenigstens ein solches Anti-Gewalt-Programm von Seiten der Männerberatung. In den anderen Bundesländern gibt es keine solchen Angebot. Außerdem werden in Wien die Trainings-Programme nur auf Deutsch durchgeführt. Die Erhöhung der Sensibilität dieser Männer setzt aber eine bestimmte sprachliche Kompetenz voraus, deshalb müsste es spezifische Sprachgruppenangebote geben - was natürlich einen bedeutend höheren Ressourceneinsatz nach sich ziehen müsste.
DIE FURCHE: Was weiß man über die Situation von Kindern aus solchen Gewalt-Familien?
Haller: Generell gibt es in Österreich zu diesem Thema wenig Statistiken und wenig Wissen. Es hat früher eine Aufschlüsselung der einstweiligen Verfügungen nach Kontexten gegeben, aber diese Statistiken werden seit einigen Jahren nicht mehr fortgeführt. Insbesondere im Bereich der Kinder, also bei der Jugendwohlfahrt, gibt es wohl ein Bewusstsein darüber, dass häusliche Gewalt ein wesentliches Thema ist, aber es gibt ebenfalls zu wenig Wissen. Allein wenn die Jugendwohlfahrt darauf hinweisen würde, dass die Hälfte der Kapazitäten der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter durch die Befassung mit familiärer Gewalt und ihren Folgen gebunden sind, wäre das schon eine ganz wichtige Information.