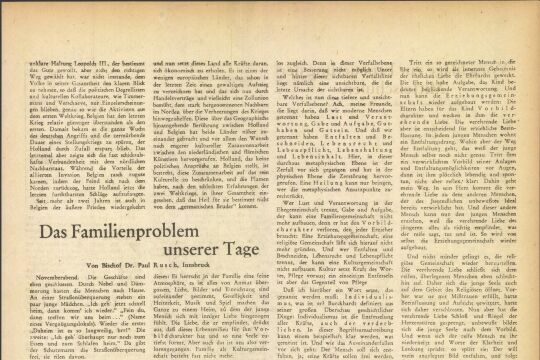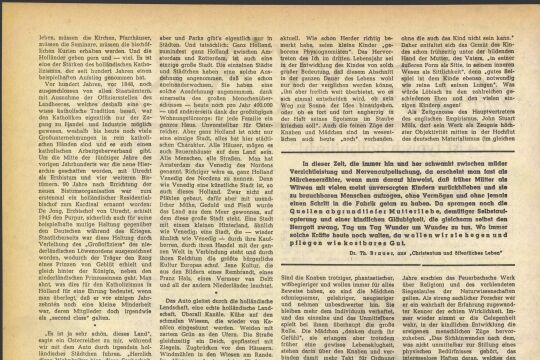"Werdet wie die Kinder!" oder "Werdet endlich erwachsen!" Was nun? Diesem Zwiespalt um Kindheit und Erwachseinsein liegt eine säkularisierte Utopie zugrunde. Eine philosophische Annäherung.
Was spricht für die Teilnahme an einer Gruppe, in der man mit dem Ziel der Persönlichkeitsentwicklung das Kind in sich wieder zu finden sucht? Auf den ersten Blick und auf der Ebene der persönlichen Autobiografie vieler recht wenig: Weiß man, ob die Wiederbegegnung mit jenem altklugen und manchmal ein wenig verschlagenen Kind, das man vielleicht einmal war, einen heute weiterbringen würde - genauso wenig, wie die mit den Mobbing praktizierenden Altersgenossen aus dem Kindergarten und jenen katholischen Internaten, die ja mittlerweile schon ein klassischer Ort der österreichischen Nachkriegsliteratur sind. "Die Hölle kommt nicht, die Hölle war - denn die Hölle ist die Kindheit", lässt Thomas Bernhard seinen Reger in den "Alten Meister" räsonieren; ein repräsentatives Beispiel für jene, deren Lust auf die Konfrontation mit ihrem "inneren Kind" sich wohl in Grenzen hält.
Doch warum sollen wir den selbsternannten "Übertreibungskünstler" gerade hier ernst nehmen? Der Chor der Gegenstimmen, die uns Kindlichkeit und Kindheit preisen, ist unüberhörbar und Regers Urteil ist nur schwer mit Matthäus 18, 3 kompatibel. So sie nicht würden wie die Kinder, erklärt Jesus Christus seinen Jüngern, bliebe ihnen das Himmelreich verschlossen.
"Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder …"
Was hat er damit gemeint in einer agrarischen Gesellschaft, in der der kindliche Schafhirt eine selbstverständliche Figur war? Wie lesen wir das heute - haben wir etwa diese Kinder mit denen aus den "Biblischen Bildern" des Biedermeier-Künstler Ludwig Richter identifiziert: neugierig, sanft und vertrauensvoll, Rousseau'sche Geschöpfe, die dem als gut gedachten Naturzustand näher sind als wir Erwachsene? Oder läuft das Herrenwort parallel zu Matthäus 6, wo uns Jesus die Vögel im Himmel als Vorbild gesetzt hat: "Sie säen nicht, sie ernten nicht; sie sammeln nicht in den Scheunen; und euer himmlischer Vater nähret sie doch." Ist "Kind" hier nicht eine von mehreren Metaphern, mit denen sich Jesus gegen die berechnende Rationalität des Erwerbslebens wendet und ihr eine "naturhafte" Spiritualität entgegensetzt? Doch wie verhält sich das zum Thessaloniker-Brief des Apostel Paulus, wo jener dezidiert anmerkt, das jemand, der nicht arbeiten wolle, auch nicht essen solle - dem Basissatz jener protestantischen Ethik, in der Max Weber den "Geist" des Kapitalismus antizipiert sah?
Keine Antwort ist auf diese Frage, denn "die" Kindheit gibt es ebenso wenig wie "die" Mutterliebe oder "das" Alter. Das alles sind mit jeweils akzeptierten Zuschreibungsprozessen verbundene, scheinbar naturhafte, doch tatsächlich variable Konstruktionen. Mutterliebe, so das berühmte Buch der Elizabeth Badinter, ist ein Produkt der Aufklärung und der Romantik, Kinder, so der Historiker der Kindheit, Philippe Ariès, wurden vor jener Veränderung als "kleine Erwachsene" behandelt und wir alle werden gerade Zeugen eines essenziellen Wandels des Alters.
Die Konstruktion "Kind" und "Erwachsene"
Solche Veränderungen, wie sie mit diesen drei Beispielen angerissen wurden, laufen keineswegs harmonisch ab. Die Frage, was "Kind" heute bedeutet, führt uns in ein diskursives Schlachtfeld, in dem die Projektionen einander aufzuheben scheinen. Was dem einen ein spontanes, ehrliches, kreatives und aufgewecktes Wesen ist, ausgestattet mit einer naturhaften Spontaneität besonderer Art, die den Regelbruch legitimiert, sieht der andere als therapiebedürftigen hyperaktiven Störenfried, der das ohnedies fragile Bildungssystem gefährdet. Die einen beklagen, dass konsum- und karrieregeile Eltern den Nachwuchs vor der Playstation zwischenlagern, die anderen berechnen den volkswirtschaftlichen Schaden, der dadurch entsteht, dass qualifizierte Frauen als Mütter unter der Spielbedingung absenter Väter der gesellschaftlichen Wertschöpfung entzogen werden. Im Wechsel zwischen diesen zwei zeitgeistig letztlich ökonomisch orientierten Positionen hat das Kind seinen Subjektstatus verloren und wurde zum Objekt konkurrierender Gesellschaftskonzeptionen, die darauf zielen, jene "Hölle", die der Reger des Thomas Bernhard erlitten hat, ebenso zu verunmöglichen wie das "böse" Kind, das in den Talkshows eifrig diskutiert wird: Soll man Kindheit von der Krippe bis zur Ganztagsschule sozusagen verstaatlichen, häusliche Defizite als soziales Problem begreifen und ausgleichen, oder gilt die - zeitaufwändige - primäre Erziehungspflicht der Eltern, die als dialogbereite, liebevolle Partner, die gleichzeitig Grenzen setzen, gedacht werden?
Aber hat nicht Sigmund Freud, der uns das Kind als triebgesteuertes, keineswegs "unschuldiges" und damit zivilisierungsbedürftiges Mängelwesen vorführt, gleichzeitig angemerkt, dass es der Sohn ist, der den Vater schafft - eine Feststellung, die zahlreiche Deutungen zulässt. Was ehedem als "Kindlichkeit" galt, hat sowohl in der "flexiblen" wie auch in der "Erlebnisgesellschaft" still und leise einen überraschenden Eigenwert gewonnen. Max Webers eiserner Käfig der Rationalität, den er in der militärisch-bürokratisierten und damit "unkindlichen" Wilhelminischen Gesellschaft festmachte, ist elastisch geworden und hat zahlreiche Eigenschaften integriert, die früher als "kindlich", im schlimmsten Fall sogar als "kindisch" galten - gesellschaftliches Vertrauen, ein Derivat des kindlichen "Urvertrauens", gilt mittlerweile als zentrales Mittel der Herstellung sozialer Kohärenz; die ungeregelte Kombinationslust des spielenden Kindes feiern wir als "Kreativität" und der ehedem perhorreszierte "Hyperaktive" hat sich im günstigen Fall in den bewunderten "Multitasker" verwandelt; im - wie sich gerade herausstellt - schlimmen Fall finden wir das spontan Grenzen ignorierende Kind nach Zugabe einer gehörigen, die Konkurrenzlust anheizenden Portion Testosteron als verantwortungslosen Spekulanten. Die kindliche Neugier und Unterhaltungslust, eine deutliche Absage an den strengen Ernst des ehedem "erwachsenen" Alltags, sind mittlerweile ein generationen- und milieuübergreifendes Phänomen geworden, das den globalen "Cultural Industries" gewaltige Renditen beschert. Kurz: Gemessen an den gesellschaftlichen Werten der frühen Industrialisierung hat sich unsere Gesellschaft - um auch das böse Wort nicht auszusparen - infantilisiert.
Utopisches Potenzial
Doch da bleibt ein aufzulösender Rest: Die metaphorische Verwendung von "Kind" durch Jesus Christus hatte und hat auch in ihrer säkularisierten Variante ein utopisches Potenzial. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil einer uns anthropologisch eingeschriebenen, unleugbaren "Sehnsucht nach dem ganz Anderen", ein notgedrungen unbeholfener Versuch, diesem "ganz Anderen", einen benennbaren Ort zu geben. Es scheint - vor der Regerschen "Hölle" - allen sozialen Widrigkeiten zum Trotz ein "Paradies" der leistungsfreien Geborgenheit gegeben zu haben, dessen kostbare Spuren uns das Kind, das fremde wie das innere, widerspiegeln.
Die Wurzel der Geschichte, so Ernst Bloch am Ende seines "Prinzip Hoffnung", sei zwar der arbeitende Mensch, keine kindliche Figur also, doch wenn er sich "erfasst" hätte und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet habe, dann entstünde "in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat". So kann man die Metapher "Kind" wohl auch entschlüsseln: als eine seit Jahrtausenden gesellschaftlich akzeptierte milde Ausdrucksform einer beharrlichen Subversion.
* Der Autor ist Professor für Philosophie an der Universität Wien
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!