Ein Buch will Schluss machen mit negativen Bildern der Generation 20 bis 35. Nötige Imagekorrektur oder blanker Zweckoptimismus? Was sagen „Betroffene“?
Schluss mit dem negativen Image der Generation 20 bis 35. Und weg mit den lästigen Etiketten, die über diese Gruppe junger Menschen gestülpt wurden: Generation Praktikum, Generation Prekär, Generation Resignation. Wir sind anders, wir haben gelernt, trotz Dauerkrise das Beste aus unserem Leben zu machen, und wir können noch viel mehr. Und wenn schon ein Etikett, dann basteln wir uns das schon selber: „Generation Yes we can“.
So könnte in etwa eine Kurz-Zusammenfassung jenes Buches lauten, das die beiden Zeit-Journalisten Manuel J. Hartung und Cosima Schmitt unter dem Titel „Die netten Jahre sind vorbei –Schöner leben in der Dauerkrise“ jüngst publiziert haben (siehe Interview rechts und Rezension unten). Autorin Schmitt meint im Interview mit der FURCHE, dass das Buch nicht als Aufmunterung für eine Generation zu verstehen ist, sondern als Korrektur von vielfach gezeichneten Bildern und als Appell an ihre Alterskollegen, für mehr Generationengerechtigkeit zu kämpfen.
Doch was sagen Mitglieder dieser Generation zu den Kernthesen des Buches? Die Soziologin und Initiatorin der österreichischen Plattform „Generation Praktikum“, Anna Schopf, stuft ihre Generation weder als optimistisch noch als Jammerlappen ein. Es gebe auch keine großen Kritikbekundungen gegen Missstände. Vielmehr versuche jeder Einzelne, für sich das Beste aus den Gegebenheiten zu machen. Insofern würde für Schopf der Slogan „Yes we can“ eher ein „Yes I can“ bedeuten. „Die Leute bleiben eher in ihrem Mikrobereich, die Bezugnahme zu den großen Problemlagen fehlt.“ Es gebe wenig Solidarisierung untereinander. Eigentlich steht die Soziologin Generationenbüchern skeptisch gegenüber. „Es fehlt mir der Gesamtblick, der Bezug nimmt zu den vorhergehenden und nachfolgenden Generationen.“
Doch es gibt auch Thesen des Buches, denen Schopf voll zustimmen kann, vor allem dem Appell zu mehr Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Generationen. Sie weist auf eine fast paradoxe Situation hin: Viele junge Menschen können nur aufgrund der finanziellen Unterstützung ihrer Eltern den Übergang zwischen Ausbildung und Beruf bewältigen und etwa Praktika machen. Andererseits ist es genau die Elterngeneration, die diese Unsicherheit, in der die heute Jungen leben, nicht erfahren haben und vermutlich noch mit einer existenzsichernden Pension rechnen können. Schopfs Kritik: Bei dieser Frage würden vor allem Vertreter von Pensionisten zu sehr im Jetzt verankert sein und Weitblick vermissen lassen. Auch die Jungen würden sich aufgrund der Jugend und der Mühen des Karriereaufbaus noch wenig um das Thema kümmern.
„Blick auf Gesamtbild fehlt“
Anna Schopf sieht ebenso eine Werteverschiebung, wie sie im Buch betont wird: Eine Tätigkeit, die Sinn stiftet und Selbstverwirklichung ermöglicht, sei viel wichtiger geworden als finanzieller und karrieremäßiger Aufstieg, sagt die Soziologin: „Es gibt eine Reflexion darüber, welchen Beitrag meine Arbeit gesamtgesellschaftlich erfüllt.“ Auch die Autoren meinen: Das Engagement in NGOs und ehrenamtliche Tätigkeiten seien für diese Generation wichtige Sinnquellen. Wie wichtig die freie Entfaltung im Beruf und die Unabhängigkeit vielen 20- bis 35-Jährigen ist, zeigen drei Vertreterinnen und ein Vertreter dieser Alterskohorte: zwei selbstständige Grafikerinnen (Johanna Kurz und Kathi Reidelshöfer, siehe Kasten li.) und Hebamme Julia Stockenreiter (Kasten re.), die sich ebenso selbstständig gemacht hat.
Der einzige Angestellte in der Runde, Verfahrenstechniker Michael Lugbauer (33), findet laut eigenen Angaben genügend Raum für selbstständiges Denken und Entfaltung im Betrieb. „Ich gehe auf, wenn ich Ideen umsetzen kann, die nicht alltäglich sind“, sagt er. Lugbauer ist Vater eines zweijährigen Mädchens und lebt in Niederösterreich im Eigenheim samt Auto. Dank seines technischen Studiums hat er keine Jobprobleme gehabt, prekäre Verhältnisse kennt er nicht. Dennoch, mit einer ausreichenden Pension rechnet auch er nicht und betont: „Unabhängigkeit ist mir wichtiger als ein superschönes Haus.“
Angestellt war zunächst auch Hebamme Julia Stockenreiter. Die Stelle hat zwar Sicherheit geboten, aber nicht ausreichend Erfüllung. Also machte sich die 27-jährige Wienerin selbstständig. Arbeit soll Spaß machen, sagt sie. Ihr Statussymbol ist ebenso die Selbstständigkeit: „Allen, denen ich erzählt habe, dass ich mich selbstständig mache, haben das bewundert. Es ist irgendwie das Ziel von jedem, den ich von dieser Generation kenne“, sagt sie: „Es ist mir wichtig, nicht mehr auf andere angewiesen zu sein, sondern auf mich selber, ich bin der eigene Chef, ich kann über mich selbst bestimmen. Das ist ein gewisses Statussymbol.“
Statussymbol Selbstständigkeit
Die Krisen, die ihre Generation seit jeher begleiten, schrecken Stockenreiter nicht: „Selbst in der Wirtschaftskrise kriegt man Kinder.“ Diese Sicherheit hat die Hebamme immer.
Dennoch charakterisiert die Generation der 20- bis 35-Jährigen nicht nur ein Aufwachsen in der Dauerkrise, sondern auch in der privaten, beruflichen und globalen Unsicherheit. Beziehungen, Karrieren sind brüchiger geworden, die Finanzkrise oder die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA veränderten das Gefühl der globalen Sicherheit drastisch, so auch die Analyse des Buches.
„Es gibt nicht mehr die klassischen Strukturen von früher: Ausbildung, Heirat, Kinder, 30 Jahre im selben Job. Dadurch haben Ältere das Gefühl, als würde heute alles auseinanderbrechen. Aber unsere Generation hat diese Strukturen nie gehabt und würde diese auch nicht wollen“, sagt Grafikerin Johanna Kurz, die zusammen mit Kathi Reidelshöfer ein Grafikbüro im siebten Wiener Gemeindebezirk betreibt. Als Mitglied einer „Generation Praktikum“ haben sich beide nie gefühlt. Sie glauben, dass Ältere diese Etiketten formuliert haben, und die Jungen ihre Ausgangspositionen nicht so schlimm sehen würden.
„Sicherheit gibt es eben in unserer Zeit nicht mehr“, sagt Kurz. Für beide ist die Entfaltung im Beruf daher ihr Anker. Statussymbol sei heute Kreativität, meint Reidelshöfer. Dass es Tendenzen gibt, alte Werte im Strudel der Unsicherheit wieder hochzuhalten, quasi ein neues „Spießertum“, wie sie es nennen, macht beiden eher Angst. Unsicherheit aber nicht. Sie fahren gut damit. Sicherheit wird erst ein Thema, wenn es um mögliche Kinder geht. „Du willst ja deinen Kindern Sicherheit bieten. Es bedeutet Verantwortung. Das vergrößert die Hemmschwelle.“ Fragen zu Frauen- und Männerbildern nerven sie eher. „Wenn man im Beruf kämpfen muss, beziehe ich das nicht auf mein Frau-Sein“, sagt Johanna Kurz.
Die Freiheit und die vielen Möglichkeiten würden also genauso viele Chancen wie auch Risiken bedeuten, analysiert die Soziologin Anna Schopf. Und wer es schafft, seine Ideen zu verwirklichen und aufzusteigen, habe sich nicht immer mehr bemüht wie jemand, dem es nicht gelingt. „Es gibt kein Rezept, die einen schaffen es, die anderen nicht. Da ist viel Zufälligkeit mit im Spiel.“
Die Zufälligkeit von Erfolg
Daher gefällt Anna Schopf der Schlusssatz des Buches nicht: „In einer Gesellschaft, in der alte Gewissheiten nicht mehr gelten, ist Raum für uns, unsere Ideen, unsere Wünsche. Wir sind vom Glück begünstigt. Wir müssen nur zugreifen.“ Dass die Generation vom Glück begünstigt ist, hält Schopf für sehr naiv. „Das klingt danach: Wenn du es wirklich willst, dann kannst du es schaffen. Ich glaube nicht, dass es allein an Aktivität oder Inaktivität hängt. Ich habe das Gefühl, dass manche viel zu viel tun. Ich sehe auch die Gefahr, dass sich etliche in den ständigen Herausforderungen und Aktivitäten verlieren.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!





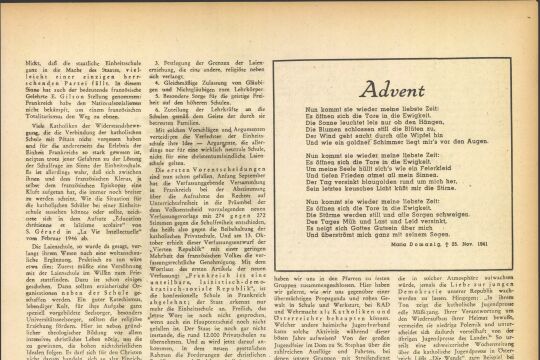






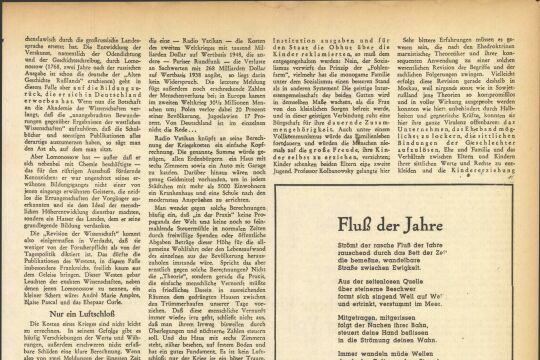

























































.png)


























