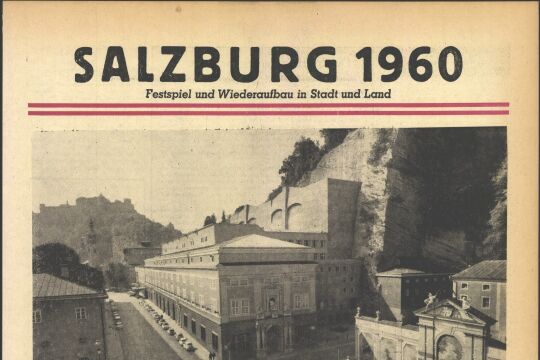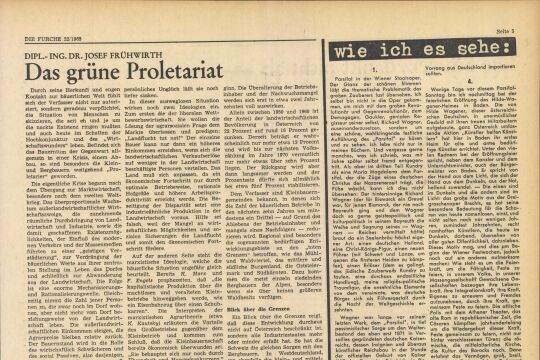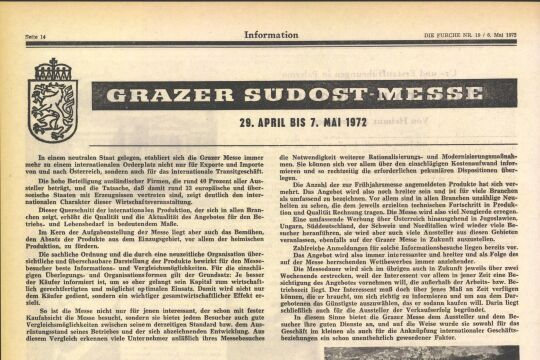Postfilialen, Gendarmerieposten, Bezirksgerichte und Kasernen - der Rotstift streicht, was zu teuer ist. Was für die Betreiber Kosteneinsparungen bedeutet, reduziert jedoch für die Bewohner der betroffenen Orte die Lebensqualität, erklärt Raumplanerin Gerlind Weber. Aber es gebe durchaus Strategien dagegen, betont sie. Oft fehle nur der Wille.
Von der Ausdünnung des ländlichen Raumes ist in letzter Zeit oft die Rede, wenn es um regionale Entwicklung geht. Verglichen mit den 80er Jahren hat sich beispielsweise die Zahl der Lebensmittelgeschäfte halbiert, jährlich schließen weitere drei bis vier Prozent der kleinen Geschäfte vor allem am Land, ergab eine Studie der Bundesanstalt für Bergbauernfragen.
Und auch staatliche und quasi-staatliche Einrichtungen werden nach und nach geschlossen. "Kosten senken", lautet die Begründung dafür, dass Nebenbahnen schon eingestellt wurden, Postfilialen, Gendarmerieposten, Kasernen und Bezirksgerichte zusperren. Ein Umstand, der Widerstand auf den Plan ruft, unter anderem von Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer. "Die Politik muss wissen: Wer den ländlichen Raum aushöhlen will, der wird bitter mit dem Verlust von Wirtschaftskraft und Arbeitsplätzen bezahlen müssen." Er kritisiert vor allem die fehlende Koordination der Maßnahmen: "Jeder Minister legt seine Sparpläne einzeln und ohne Blick für das Gesamte vor. Es fehlt der Blick für die Regionen in ihrer Gesamtheit." Er fordert daher einen Masterplan für Infrastruktur, der sich zwar auch, aber eben nicht nur nach ökonomischen Kriterien richten dürfe, um die Probleme der ländlichen Regionen zu lösen.
Mit diesen Problemen und ihrer Lösung beschäftigt sich Gerlind Weber vom Institut für Raumplanung und ländliche Neuorientierung an der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Furche-Interview sieht sie zwar die Schwierigkeiten, durchaus aber auch Handlungsmöglichkeiten, um ländlichen Gebieten wieder mehr Attraktivität zu geben.
Die Furche: In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Maßnahmen durchgeführt oder angekündigt, die die Infrastruktur ländlicher Gemeinden betreffen: Gendarmerieposten, Bezirksgerichte und Postämter wurden geschlossen. Nun steht die Schließung einiger Kasernen bevor. Was bedeutet das für die Gemeinden?
Gerlind Weber: Einen Verlust an Arbeitsplätzen, dadurch Abwanderung der Familien und somit der Kaufkraft, dadurch wieder einen weiteren Rückgang der Nahversorger, weil diese sich nicht mehr halten können, und damit einen Verlust an Lebensqualität für die, die bleiben. Das ist eine Spirale, in der sich viele ländliche Regionen befinden: Es beginnt damit, dass die Arbeitsplätze weniger werden. Dadurch wandern die Jungen, gut Ausgebildeten ab. Die Reproduktionsfähigen, die Optimisten, die Tat- und Zahlungskräftigen sind weg. Man bekommt eine negative, resignative Grundstimmung ins Dorf, eine No-Future-Stimmung. Mit dem Verlust der Arbeitsplätze verringern sich die Gemeindeeinnahmen, die Gemeinden können also ihre Infrastruktur nicht auf einem Niveau halten, das für neue Betriebsansiedlungen attraktiv ist. Der Ort wird immer unattraktiver, die Wirtschaftssubstanz geht weiter zurück, alte Unternehmen sperren zu, und so dreht sich die Spirale weiter.
Die Furche: Welche Folgen ergeben sich für das Gemeinschaftsleben?
Weber: Das Versorgungsnetz wird immer weitmaschiger, dadurch sinkt die Lebensqualität, denn wenn das nicht kompensiert wird, werden die Wege immer länger. Post, Einzelhändler und Gasthäuser wirken wie ein Kitt für das Dorfleben. Je mehr Kitt fehlt, umso größer die Zentrifugalkräfte: Die Gemeinschaft fließt auseinander, löst sich auf.
Die Furche: Wer leidet darunter am meisten?
Weber: Da die Wege für Erledigungen immer länger werden, sind es die, die nicht mobil sind. Vor allem die Alten - in ländlichen Regionen haben nur elf Prozent der Frauen und 57 Prozent der Männer über 60 einen Führerschein. Auch Kinder und Jugendliche nicht so mobil. Es ist also ein relativ großer Personenkreis, der auf Nahversorger angewiesen ist. Aber es gibt noch einen zweiten Faktor: Die Gasthäuser, die traditionellen Männertreffpunkte, halten sich relativ gut. Die kleinen Geschäfte dagegen brechen weg. Dort treffen die Frauen einander und tauschen sich aus. Fehlt das Geschäft, fehlt dieser Austausch, und darunter leiden die Frauen.
Die Furche: Sehen Sie Alternativen zu den oft unrentablen Nahversorgern?
Weber: Es gibt einige Ansätze, etwa den großen Händler aus der Region, der die einzelnen Gemeinden anfährt und Waren direkt ins Haus liefert. Ich denke, das werden in Zukunft vor allem die Lebensmittelketten machen. Aber das wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit für die Post. Die bewältigt eine unglaubliche Logistik und kommt, wenn nötig, jeden Tag zu jedem österreichischen Haushalt. Die könnte doch auch Lebensmittelbestellungen aufnehmen. So funktioniert es übrigens in Japan. Andererseits muss man damit auch sehr vorsichtig sein, denn das Einkaufen ist ja gerade für viele ältere Menschen das einzige Erlebnis des Tages, bei dem sie unter die Leute kommen. Und einen Ersatz für den Frauentreffpunkt bietet so ein Hauszusteller auch nicht. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit der multifunktionellen Versorger: Mehrere Funktionen, die einzeln nicht rentabel sind, werden bei einem Anbieter gesammelt. Das könnte zum Beispiel das Lebensmittelgeschäft sein, das auch eine Kaffeehaus-Ecke hat und eine Trafik samt Post. Rund tausend Einwohner können einen solchen Anbieter tragen. Aber dazu ist ein geändertes Einkaufsverhalten der Bewohner notwendig. Solange die nämlich Einkaufen als Wochenendausflug in die großen Einkaufszentren am Rande der Städte inszenieren, funktioniert das nicht. Das ist ein Teil des Problems: Die, die am lautesten jammern, dass es im Ort keinen Greißler mehr gibt, wollen einen Nahversorger nur, damit sie sich ab und zu schnell einen Liter Milch kaufen können. Aber ihr Einkaufsverhalten ändern wollen sie nicht.
Die Furche: Wo muss man denn ansetzen, um den ländlichen Raum wieder zu beleben?
Weber: Bei der neoliberalen Globalisierung. Im weltweiten Austausch von Waren und Dienstleistungen tun sich die Räume besonders leicht, die eine Infrastruktur haben, die diesem weltweiten Austausch besonders entgegenkommt: Flughafen- und Autobahnanschluss oder Anbindung an eine Hochleistungsstrecke der Bahn. Das sind Gunsträume. Für den Austausch von Gütern und Personen werden diese begünstigten Lagen gesucht. Mit dem Effekt, dass alle anderen zu Ungunsträumen werden. Nun gilt, dass dort die Tauben hinfliegen, wo schon die Tauben sind, daher werden diese Zentralräume immer mehr aufgebaut. Die Gunst der Zentralräume als Standorte steigt, die Ungunsträume fallen immer mehr zurück.
Die Furche: Das klingt alles ja ziemlich hoffnungslos ...
Weber: Nein, das nicht. In Österreich gibt es noch einen relativ guten Ausgleich dadurch, dass der Fremdenverkehr einen hohen Stellenwert hat und im ökonomischen Sinne Gunsträume schafft, die sonst klassische Ungunsträume wären. Man kann sagen, jede Region hat ihre Stärken. Gerade wenn sie ökonomisch stark zurückgefallen ist, ist sie landschaftlich oft ein Juwel, bietet hohe Wohnqualität und kann Alternativen zu den gängigen Möglichkeiten prüfen. Da muss ein Paradigmenwechsel im Kopf stattfinden, hin zur nachhaltigen Entwicklung. Man muss beginnen, jede ökonomische Entscheidung auch hinsichtlich ihrer ökologischen und sozialen Folgen zu betrachten. Zum Beispiel der Verkehr: Es kann doch nicht sein, dass eine Erdbeere aus Südafrika billi-ger ist als eine aus dem Marchfeld. Aber die Preisbildung verzerrt die tatsächlichen Kosten völlig. Die Globalisierung im Güterverkehr würde in dem Moment zusammenbrechen, wo verursachergerechte Tarife zu zahlen sind. Das heißt aber auch, dass wir das einfordern müssen, etwa durch verursachergerechte Preisbildung, ein nachhaltiges Steuersystem.
Dadurch würden natürlich regionalen Wirtschaftsbeziehungen gestärkt. Es gilt also, die Wertschöpfung im regionalen Kreislauf zu halten - kleinräumige Wertschöpfungskreisläufe aufzubauen. Etwa im Energiewesen. Die Ölpreise steigen wegen der hohen Nachfrage aus Indien und China so stark, dass bisher ungenutzte Alternativen der Energiegewinnung an Attraktivität gewinnen. Nachwachsende Rohstoffe zum Beispiel, die in der Region gewonnen, verarbeitet, vertrieben, konsumiert und entsorgt werden. Das eignet sich natürlich nicht für jeden Ressourcenstrom, aber für die Ernährung, Bauen, Energie und Dienstleistungen wäre eine starke regionale Bindung möglich.
Die Furche: Gibt es Beispiele für Gemeinden, die sich erfolgreich gegen Zentralisierung und Globalisierung wehren?
Weber: Ein Musterbeispiel nachhaltiger Gemeindeentwicklung ist der "Steinbacher Weg", den Steinbach an der Steyr geht. Der Ort hatte früher eine Besteckindustrie, die wegen der internationalen Konkurrenz in den 60er Jahren zusammengebrochen ist. Es gab keine Arbeitsplätze mehr, die Leute sind weggezogen. Dann kam ein Bürgermeister, der etwas gegen den Niedergang unternehmenwollte. Seither sind mehr als 80 Projekte gemeinsam mit der Bevölkerung realisiert worden, um innerhalb der Gemeinde eine Trendwende herbeizuführen - mit Erfolg. Als das Projekt 1987 begonnen wurde, gab es in Steinbach 27 Betriebe mit 68 Arbeitsplätze, im Jahr 2001 waren es 55 Betriebe mit 215 Arbeitsplätzen. Heute ist das eine prosperierende Gemeinde und die Leute ziehen dort hin. Es gibt also schon Möglichkeiten.
Aber man kann gut erkennen, dass es teilweise auch Blockaden sind, die diese zurückfallenden Regionen stark behindern, die nur noch im Gejammer versinken und nur über ihre Schwächen nachdenken. Was aber viel wichtiger wäre, ist die Schwächen zu schwächen und die Stärken zu stärken.
Das Gespräch führte Claudia Feiertag.