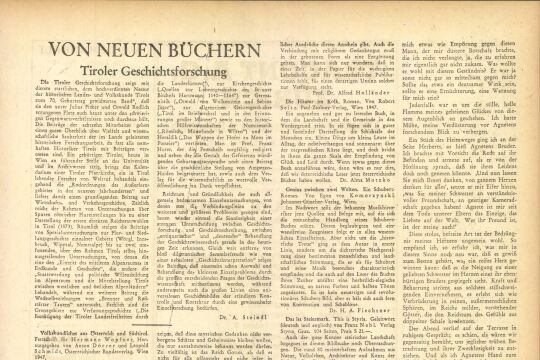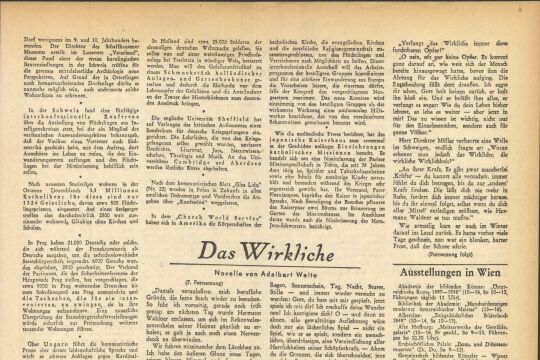Die Schriftstellerin Monika Wogrolly über Terri Schiavo und die "außergewöhnliche Seinsweise" von Menschen im Wachkoma.
Meine erste Berührung mit Menschen im Wachkoma war während meiner siebenjährigen teilnehmenden Beobachtung an österreichischen Kliniken auf einer geriatrischen Langzeitpflegestation. Der erste Wachkomatöse Herr W. war Mitte vierzig und während eines Tennismatches durch einen Herzinfarkt zusammengebrochen. Die Reanimation wurde versucht, wobei jedoch Herrn W's Gehirn zu lange sauerstoffunterversorgt war, worauf er ins Wachkoma fiel. Als ich sein Krankenzimmer betrat, saß Herr W. mit starrem Blick halb aufgerichtet im Bett, aus seiner Luftröhrenkanüle kam tröpfchenweise Schleim, wobei mir ein Pfleger erklärte, dass die Schleimproduktion mal mehr und mal weniger sei und es von den Pflegenden als Herrn W.'s neue Art, sich bemerkbar zu machen, gewertet werde. Mein Gefühl gegenüber Menschen mit Großhirndefekten, die im apallischen Syndrom waren - der Volksmund sagt "Wachkoma" zu diesem Schwebezustand zwischen Leben und Sterben - war das eines bodenlosen Respektes. Fast wie gegenüber jemandem, der eine fremde Sprache spricht, die ich (noch) nicht verstehe. Behutsamkeit - war mein erster Impuls und ein gewisses Gefühl der Beschämung, weil ich mit all meinen Kommunikationsstrategien auf Granit zu beißen schien. Der Hamburger Sozialpsychiater Klaus Dörner umschrieb diesen Zustand sehr treffend mit dem Begriff der "außergewöhnlichen Seinsweise", welcher man sich erst annähern muss. Ich rätselte, wie ich es anstellen könnte, in Herrn W.'s Begriffswelt einzutauchen. Um einen Komatösen zu begreifen, muss man mit ihm in Beziehung sein, darf sich weder abschotten noch zu sehr öffnen. Nur so kann man auch erspüren, ob es im Sinne dieses Menschen ist, unter uns zu bleiben, oder ob er wirklich sterben will und man ihn nicht gewaltsam unter Aufbietung aller medizintechnischer Möglichkeiten ans Leben binden sollte.
Frau O., 39jährig und nach zwei gescheiterten Suizidversuchen seit vielen Jahren auf einer österreichischen Langzeitpflegestation im Wachkoma, gab nach Meinung der Schwestern über die Ersatzsprache vegetativer Funktionen ihren Gefühlen Ausdruck. Wer sie gut genug kannte und mit ihr beim mehrmals täglich erforderlichen Umlagern, bei einer beruhigenden Waschung in Berührung kam, konnte mitreden. Wer das nicht tat, wurde von den wiederkehrenden stationsinternen Debatten um passive Sterbehilfe ausgeschlossen. Einmal meinte eine Schwester, die neu an der Station war, dass Frau O. mit ihren Selbstmordversuchen klar den Wunsch zu sterben geäußert habe und es daher moralisch nicht vertretbar sei, sie unter kostspieligem Pflegeaufwand am Leben zu erhalten. Darauf entgegnete die Stationsärztin, dass sie Frau O. auf Minimaltherapie gesetzt und ihr im Falle einer Lungenentzündung kein Antibiotikum gegeben habe, doch durch einen unglaublichen Lebenswillen habe sie überlebt und sei dann wieder weiter künstlich ernährt worden. Frau O.'s Sieg über mehrere Atemwegsinfekte schien den Pflegenden und der Ärztin ein Signal ihres Lebenswunsches und dafür hinreichend zu sein, sie noch weiter zu pflegen und in ihrem (mutmaßlichen) Lebenswillen zu unterstützen, wobei die Überwindung einer schweren Lungenentzündung "die Nagelprobe" gewesen war, der die Ärztin von der Sinnhaftigkeit therapeutischer Interventionen überzeugt hatte.
Überhöhte Heilserwartung
Neben wohlmeinenden Anstrengungen um Reintegration kann im Umgang mit Wachkomatösen die Gefahr einer - dem mutmaßlichen Interesse des Patienten nur scheinbar dienlichen - Übertherapierung nicht ausgeräumt werden. Zudem werden Wachkomatöse, die auf therapeutisches Engagement nicht oder nur wenig reagieren, bisweilen als "nicht ausbaufähig" und "unwillig" erlebt. Überhöhte Heilungserwartungen werden bisweilen in Wachkomatöse gesetzt, wobei eigene Wunschprojektionen von Äußerungen der Wachkomapatienten nicht klar zu unterscheiden sind.
Als man wiederholt bei Frau O. eine Träne beobachtete, wenn ihr Vater sie besuchte, war im Pflegebericht vermerkt, dass man nicht wisse, ob das etwas zu bedeuten habe. Die Klinikmedizin war der Überzeugung, dass es sich um ein rein physiologisches Phänomen handle. Der Träne könne keinerlei Empfindung korrespondieren, zumal die für Empfindungen zuständigen Hirnregionen ausgefallen seien. Dennoch blieben die Stationsärztin und Schwestern dabei, dass Frau O. nur in bestimmten Situationen geweint habe und es daher ein Ausdruck von Rührung und Anteilnahme sei.
Die unterschiedlichen Erkenntniszugänge machen klar, wie schwierig die moralisch angemessene Umgangsweise mit Menschen im dauernden Koma ist, umso mehr in einer Gesellschaft utilitaristischen Denkens. Nur in einer beziehungsethischen Kultur der Sorge für die Schwächsten kann offenbar werden, welchen Wert es für die menschliche Gemeinschaft hat, wenn eine Terri Schiavo in den USA oder eine Frau O. in Österreich in ihrer besonderen Seinsweise unter uns leben.
Die Autorin ist Schriftstellerin ("Herzlos", "Rabenbraten"), studierte Philosophie und Deutsche Philologie und promovierte im Rahmen eines dreijährigen Forschungsprojektes über Menschen im Wachkoma.
ABBILDER GOTTES.
Demente, Komatöse, Hirntote.
Von Monika Wogrolly-Domej. 295 S., Styria/Pichler: Wien 2004. (=Bibliothek der Unruhe und des Bewahrens. 8.)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!