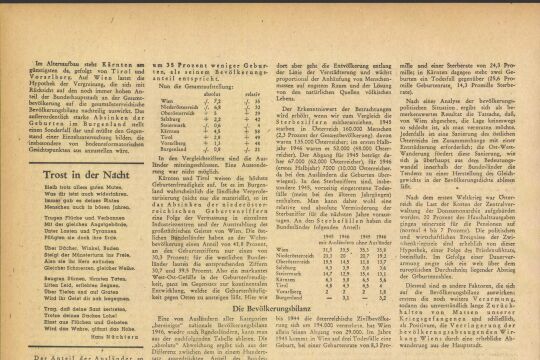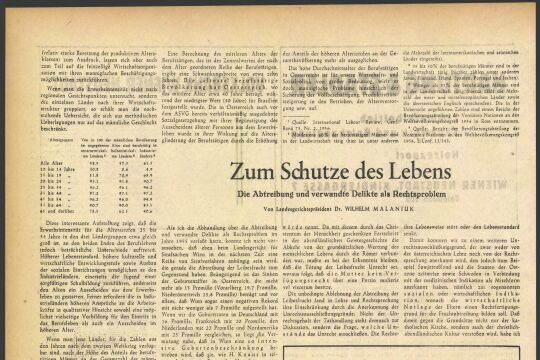Dass sich der Papst gegen Abtreibung ausspricht, ist keine Überraschung. Die Worte, die Franziskus am 10. Oktober bei seiner Generalaudienz wählte, sorgten freilich für Empörung. "Einen Menschen zu beseitigen ist wie die Inanspruchnahme eine Auftragsmörders, um ein Problem zu lösen", meinte das Oberhaupt der katholischen Kirche mit Blick auf Schwangerschaftsabbrüche. Insbesondere jene von Kindern mit Behinderung prangerte Franziskus an. Schon im Juni hatte er diese mit dem NS-Euthanasieprogramm verglichen.
Mord auf der einen Seite, "mein Bauch gehört mir" auf der anderen: Zwischen diesen Extremen bewegt sich die Abtreibungsdebatte. In Argentinien, dem Heimatland des Papstes, ist erst im August ein Gesetz zur Legalisierung von Abbrüchen gescheitert - nicht zuletzt wegen des massiven Widerstands der katholischen Kirche. In Irland hingegen berät das Parlament gerade darüber, wie das historische Ja zu legalen Abbrüchen in Gesetze gegossen werden kann.
Polarisierender Spätabbruch
Österreich hat sich mit der am 1. Jänner 1975 in Kraft getretenen Fristenregelung einen Kompromiss erkämpft. Ein Schwangerschaftsabbruch ist nicht legal, aber straffrei, wenn er innerhalb der ersten drei Monate von einem Arzt nach vorheriger Beratung durchgeführt wird. Besteht "eine ernste Gefahr, dass das Kind geistig oder körperlich schwer geschädigt sein werde", ist Abtreibung theoretisch bis zur Geburt straffrei.
Diese "embryopathische Indikation" polarisiert bis heute. Und auch sonst regt das Thema Abtreibung auf. Die Forderung nach Schwangerschaftsabbrüchen auf Krankenschein war wohl für nicht wenige Menschen ein Grund, das Frauenvolksbegehren nicht zu unterstützen. Dazu kommt der ewige Streit um eine Statistik. Anders als in Deutschland oder der Schweiz gibt es in Österreich bis heute keine offiziellen Abbruchzahlen. Schätzungen gehen von 35.000 Fällen jährlich aus. Würde das stimmen, dann gäbe es in Relation mehr als drei Mal so viele Fälle wie in Deutschland mit seinen 100.000 Abbrüchen pro Jahr.
Um die Mutmaßungen zu beenden, fordert Aktion Leben seit langem eine offizielle Statistik sowie eine anonyme Erhebung der Motive. "Jede seriöse Politik braucht Zahlen, um Präventionsmaßnahmen setzen zu können", heißt es. Die Kritik, dass dadurch der Datenschutz verletzt werde, sei schlicht falsch. Rund 55.000 Menschen haben die parlamentarische Bürgerinitiative "Fakten helfen!" bereits unterzeichnet, bis Jahresende soll sie im Plenum behandelt werden.
Auch die Bürgerinitiative "#fairändern" fordert Zahlen -und noch viel mehr: Man will auch eine Hinweispflicht des Arztes auf (psychosoziale) Beratungsangebote, eine Informationskampagne über Adoption oder Pflege als Alternative zum Schwangerschaftsabbruch und eine mindestens dreitägige Bedenkzeit vor einem Abbruch - nach deutschem Vorbild. "Frauen stehen oft unter enormem Druck", erklärte Petra Plonner, Erstunterzeichnerin der Initiative und Pastorin der freikirchlichen "Life Church" in Leoben, vergangene Woche bei einer Podiumsdiskussion in Wien. Sie selbst habe mit 18 Jahren "viel zu schnell" einen Abbruch vornehmen lassen. Eine Bedenkzeit könne ein wichtiger Zeitpuffer sein, um keine übereilte Entscheidung zu treffen. Für Eltern, die ein Kind mit Behinderung erwarten, wünscht sich Plonner ein breites Unterstützungsangebot; die "eugenische Indikation", wie sie die Option zum straffreien Abbruch von behinderten Kindern nennt, soll entfallen. "Ein solches Werturteil über das Lebensrecht von Menschen hat in unserer Zeit keinen Platz", meint die Pastorin.
Doch was bedeutet das konkret? Würden Frauen in diesem Fall zum Austragen solcher Kinder gezwungen werden? Plonner zögert. "Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der alle gemeinsam diese Familien und Frauen unterstützen und ein Klima schaffen, in dem Menschen mit Behinderungen wieder willkommen sind", sagt sie schließlich. "Außerdem kann nur ein kleiner Teil der Behinderungen pränatal festgestellt werden. Und wir können ja auch nach der Geburt nicht sagen: Dieses Kind muss weg!"
Herbert Pichler sieht das ähnlich -und doch anders. "Wir wollen die eugenische Indikation weghaben", betont auch der Präsident des Österreichischen Behindertenrates. "Aber wir wollen den Frauen nicht das Recht auf Selbstbestimmung nehmen." Wie in Deutschland soll nicht mehr der Gesundheitszustand des Kindes als Kriterium für einen straffreien Spätabbruch herangezogen werden, sondern die Frage, ob dieses Kind "eine Gefahr für das Leben oder die körperliche oder seelische Gesundheit der Frau" darstelle (medizinische Indikation). Aus Pichlers Sicht wäre dies wichtig, "weil es nicht sein kann, dass das Leben eines behinderten Kindes weniger wert ist als das eines nichtbehinderten". Die Zahl der Spätabbrüche hat sich durch diese Änderung in Deutschland freilich nicht verändert.
Zugleich erhöhen immer ausgefeiltere pränatale Diagnostikmethoden den Druck. Aktuell diskutiert werden etwa (teure) nicht-invasive pränatale Blut-Tests (NIPT). Durch sie müssen Eltern noch früher -und oft unvorbereitet -über Sein oder Nichtsein ihres Kindes entscheiden. Auch der Druck auf die Mediziner nimmt zu. Herbert Pichler erinnert an jenes OGH-Urteil, das einer Familie den gesamten Unterhalt ihres Buben als "Schadenersatz" zugesprochen hat, weil man dessen Behinderung nicht erkannt und deshalb eine Abtreibung verunmöglicht hat. "Das war ein Katastrophenurteil", meint auch der Gynäkologe Martin Langer. Als Oberarzt an der Universitätsfrauenklinik am Wiener AKH ist er täglich mit Fällen konfrontiert, in denen Eltern, Psychologen und Ärzte darum ringen, ob ein Spätabbruch vorgenommen wird oder nicht. Wobei man selbst rote Linien gezogen habe, betont Langer: "Eine Kiefer-Lippen-Gaumen-Spalte oder eine fehlende Extremität sind etwa keine Gründe für einen Spätabbruch." Trisomie 21 freilich schon: Rund ein Viertel der Spätabbrüche am AKH basieren auf dieser Diagnose. Dabei ist das Down-Syndrom eine vergleichsweise harmlose Beeinträchtigung. "Die Trisomie 21 ist für uns eine offene Wunde", gesteht auch Martin Langer. Je weiter fortgeschritten eine Schwangerschaft sei, desto schwerer müsse grundsätzlich die Behinderung sein, bevor ein Abbruch vorgenommen werde, betont der Mediziner. Bei Abbrüchen jenseits der 24. Woche, also dem Beginn der Lebensfähigkeit außerhalb des Mutterleibes, wird das Kind durch eine Kaliumchloridspritze ins Herz getötet (Fetozid), bevor es von der Mutter geboren werden muss.
Warum nicht sterben lassen?
Für die betroffenen Frauen ein traumatisches Erlebnis, wie die Hebamme und Trauerbegleiterin Renate Mitterhuber weiß. Am stärksten in Erinnerung ist ihr der Fall einer Frau, die sich nach einem Fetozid in der 33. Woche verzweifelt an sie gewendet hat: "Die Begründung war damals ein nichtlebensfähiger Herzfehler", erzählt Mitterhuber. "Da habe ich mich schon gefragt: Warum lässt man das Kind nicht einfach begleitet im Kreis der Familie sterben?" Mehr Angebote einer solchen Palliative Care für sterbende Kinder und ein dichteres Beratungs-und Begleitungsnetz für Eltern: Das würde sich Mitterhuber wünschen.
Petra Plonner kann das nur unterschreiben. Darüber hinaus wünscht sich die freikirchliche Pastorin aber auch, "dass wir einander wieder mehr zumuten -und dass Platz für alle Kinder ist, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht". Der Papst in Rom hätte es nicht schöner sagen können.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!