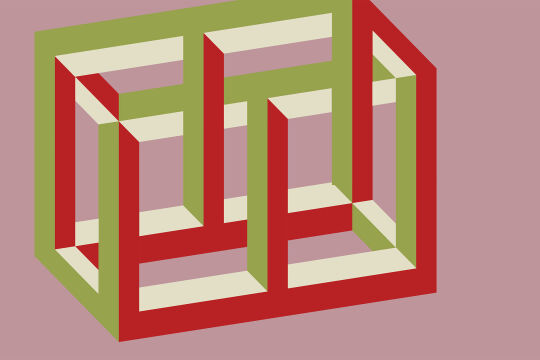Elisabeth Seidl gilt als "Doyenne" der Pflegewissenschaft und ist seit Jänner 2005 Vorständin des gleichnamigen, neuen Instituts an der Universität Wien. Im Furche-Interview spricht sie über die chronische Misere des österreichischen Pflegewesens - und längst fällige Reformen.
Die Furche: Frau Professor Seidl, gibt es einen "Pflegenotstand"?
Elisabeth Seidl: Wenn wir bedenken, dass sehr viele Menschen zu Hause liegen und keine gute Versorgung haben, dann gibt es einen Notstand. Wenn wir bedenken, dass von den etwa 425.000 Angehörigen - meist Frauen -, die ihre Eltern, Partner oder Kinder pflegen, viele extrem überlastet sind, dann gibt es auch einen Notstand. Was gut läuft in Österreich, und darauf sind die Politiker ja immer wieder stolz, ist das Akutkrankenhaus. Das verschlingt aber auch den größten Teil der Kosten. Wir haben also einen Notstand im ambulanten Bereich der häuslichen Pflege. Da sucht man sich dann zur Not billige Kräfte aus dem Ausland, die vielfach nicht geschult sind und schlecht bezahlt werden. Das ist das eigentliche Problem.
Die Furche: Die Zahl der illegalen Pflegekräfte wird auf 40.000 geschätzt. Eine realistische Zahl?
Seidl: Es wird immer diese Zahl genannt, eine Dunkelziffer, wobei man diese Personen nicht als "Pflegekräfte" bezeichnen darf. Das sind Frauen, teilweise Hausfrauen, die die ihnen gestellte Aufgabe zum Teil gut erfüllen, aber manches auch nicht leisten können, weil ihnen die Ausbildung fehlt.
Die Furche: Aber sie leisten eine Arbeit, die sonst nicht finanzierbar wäre - und scheinen derzeit unersetzbar.
Seidl: Wir hätten sie schon längst ersetzen müssen. Österreichweit haben wir - ohne Heimhelferinnen - rund 70.000 Pflegepersonen. Diese Zahl ist viel zu niedrig. Laut WHO gibt es etwa in Finnland 22 Pflegepersonen auf tausend Einwohner, wir haben nur 5,6. Die finnischen Pflegekräfte sind noch dazu hochqualifiziert und arbeiten ganz selbstständig im häuslichen Bereich in den Gemeinden und in den Familien. Solche Konzepte brauchen wir auch in Österreich.
Die Furche: Wie wird dieses finnische System finanziert?
Seidl: Die Finnen haben ein Gesundheitssystem, wo die Versorgung zu Hause ohne Zusatzkosten möglich ist, rund um die Uhr. Auch die Dänen haben in all ihren 274 Gemeinden ein Rufsystem, wo man Tag und Nacht eine Pflegerin anrufen kann, ohne das selbst bezahlen zu müssen. Doch dazu müsste unser Finanzierungssystem grundlegend verändert werden. Bei uns geht derzeit jeder mangels Alternativen ins Krankenhaus. Wir haben europaweit die meisten Krankenhausbetten und-tage, doch Spitäler sind extrem teuer. Wenn wir diese Kosten umschichten würden, indem wir häusliche und Gemeindestrukturen aufbauen, dann könnten die Spitäler wirklich Betten abbauen und alles wäre mit der gleichen Summe finanzierbar. Doch bei uns läuft viel unlogisch: Die Hauskrankenpflege muss zu einem Teil vom Patienten oder von den Angehörigen bezahlt werden und zum anderen Teil vom Land. Aber im Krankenhaus wird alles bezahlt. Wieso? Wir machen seit 20 Jahren Änderungsvorschläge. Die Politiker müssten sich das nur anschauen.
Die Furche: Wie erklären Sie sich die Politiker-Resistenz?
Seidl: Das ist eben typisch österreichisch. Wir haben etwa schon im Jahr 1988 die Bildungsfrage im Pflegebereich thematisiert und gefordert, dass zumindest ein Zehntel der Pflegepersonen akademisch ausgebildet sein soll. Aber bei uns hat sich immer alles hinausgezögert. Jetzt heißt es, dass es Arbeitsgruppen geben soll, bei denen Waltraud Klasnic eine Aufgabe übernimmt. Die kennt sich gut aus. Ein Pflege-Gipfel allein reicht aber nicht! Es müssten Expertengruppen einberufen werden, die kurz-, mittel-und langfristige Maßnahmen planen und auch die Kompetenz haben, etwas durchzusetzen, was auch finanziert wird.
Die Furche: Der Laie mag sich fragen, wofür wir teure, akademisch gebildete Pflegekräfte brauchen ...
Seidl: In anderen Ländern sind diese exzellent ausgebildeten Kräfte die ersten Ansprechpersonen, die man zu Hause bei einem Notfall ruft. Sie entscheiden auch, ob man rasch eine Maßnahme setzen kann oder ob ein Arzt gerufen wird. Das sind "Advanced Nurses", die auf verschiedene Fälle, etwa Demenz-Kranke, spezialisiert sind. Außerdem werden die akademisch gebildeten Pflegekräfte auch die Lehrenden der Pflegeschulen stellen oder die Manager der großen Spitäler. Derzeit gibt es ja Pflegepersonen, die bis zu tausend Angestellte unter sich haben. In keinem Wirtschaftsbetrieb würde man dort nicht die höchste Ausbildung verlangen. Die offizielle europäische Richtlinie besagt sogar, dass die gesamte Grundausbildung an die Universität muss - bis zum Bachelor. Und zehn Prozent sollten ein Master-Diplom erreichen.
Die Furche: Das wäre finanzierbar?
Seidl: Wenn man sich ansieht, wie viel derzeit die 62 Gesundheits-und Krankenpflegeschulen kosten, würde ich wetten, dass das nicht teurer wird.
Die Furche: Eine Anhebung auf Bachelor-Niveau würde wohl auch das Image des Pflegeberufes heben ...
Seidl: Natürlich. Wir haben in anderen Ländern auch deshalb so viele Pflegepersonen, weil es ein hoch angesehener, autonom arbeitender Beruf ist. Da will jeder hin! Außerdem gibt es in der Pflege in Zukunft Arbeitsplätze genug!
Die Furche: Wie glücklich sind Sie mit den großen Pflegeheimen, etwa mit Lainz?
Seidl: Man muss auf alle Fälle Situationen schaffen, in denen es würdig ist, den gesamten Lebensabend dort zu verbringen. Ist es würdig, in einem Vierbett-oder Sechsbettzimmer nur ein Bett und einen Schrank zu haben? Nein, denn das führt dazu, dass die Leute immer inaktiver werden und keine Freude mehr am Leben haben.
Die Furche: Was wären Alternativen?
Seidl: Dänemark hat schon 1985 begonnen, die Hälfte aller Heime zu schließen und stattdessen speziell angepasste Wohneinheiten zu schaffen. Und in der Schweiz haben sich kleine Heime mit Garten bewährt. Dort können auch Angehörige und Freiwillige eingebunden werden. Oft wird den jungen Frauen ja vorgehalten, dass sie sich nur für den Beruf interessieren und nicht für die Mutter. Das ist völlig falsch. Man müsste ihnen - und den Söhnen - nur die Möglichkeit geben, ihren Beitrag zu leisten. In manchen Ländern macht man das sogar auf Vertragsebene: Dann hat die Tochter offiziell eine Funktion und wird auch anerkannt - anders als bei uns, wo oft behauptet wird, man habe "einfach abgeschoben".
Die Furche: Inwiefern könnte eine bessere Pflege auch Diskussionen über aktive Sterbehilfe vermeiden helfen?
Seidl: Das ist ein wichtiger Punkt: In dem Ausmaß, in dem wir Hospize und Hospiznetze einrichten, wo würdevolles Sterben, gut begleitet, möglich ist, ist das Problem der aktiven Sterbehilfe gering. Da werden jedenfalls noch viele Fragen auf uns zukommen. Wir brauchen also in jedem Fall neue Konzepte. Sonst drohen tatsächlich erschreckende Szenarien, weil die demografische Entwicklung starke Veränderungen bringt und die Bevölkerung dann, wenn wir nicht vorbereitet sind, rasch sagen würde: Wir können uns die Alten nicht mehr leisten! Es ist also wirklich fünf nach zwölf!
Das Gespräch führte Doris Helmberger.
Kompetenz in Theorie und Praxis
Das passt so gar nicht zusammen: Die ständigen Meldungen über den Mangel an Pflegepersonen - und die Begeisterung von Elisabeth Seidl, wenn sie von Pflege spricht: "Stellen Sie sich vor, Sie kommen in eine verzweifelte häusliche Situation, wo einfach durch Beratung, Begleitung und gezielten Einsatz von Hilfen eine entspannte, zufrieden stellende Situation entsteht", erzählt sie. Kein Zweifel: Für Elisabeth Seidl ist Pfleger/in
"sicher der schönste Beruf". Umso bedrückter ist sie von den Problemen im österreichischen Pflegesystem. Seidl selbst hat es von der Pike auf kennen gelernt: Im Wiener Rudolfinerhaus besuchte sie die Krankenpflegeschule und arbeitete als Lehrschwester. Nach einer Weiterbildung in Pflegepädagogik und-management an der Kaderschule Zürich begann sie das Studium der Psychologie und Soziologie an der Universität Wien und promovierte 1978 bei Giselher Guttmann über "Interaktionsprobleme im Krankenhaus". 1975 wurde sie Direktorin des Pflegedienstes und der Gesundheits-und Krankenpflegeschule des Rudolfinerhauses - und blieb bis 1999 in dieser Funktion. In den 80er Jahren gelang es ihr, mit internationalen Kolleginnen den Bereich der Pflegeforschung aufzubauen. 1995 habilitierte sie sich am Institut für Pflegeforschung der Universität Linz und wurde schließlich im Oktober 2004 Vertragsprofessorin für Pflegewissenschaft an der Universität Wien, wo sie derzeit 650 Studierende betreut. Bis dieses Studium nicht mehr nur als "individuelles", sondern (an der Wiener Medizin-Uni) als "ordentliches" angeboten wird, muss sie freilich noch bis 2007 warten. Insgesamt wird ihr Fach dann an vier Hochschulen beheimatet sein: Neben Wien auch an der Grazer Medizin-Uni, an der Tiroler Privatuni UMIT und an der Salzburger (privaten) Paracelsus Universität.









































































.jpg)