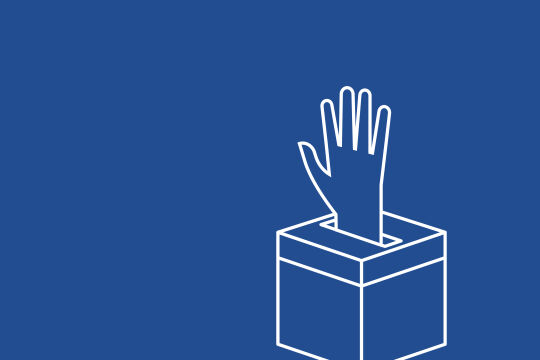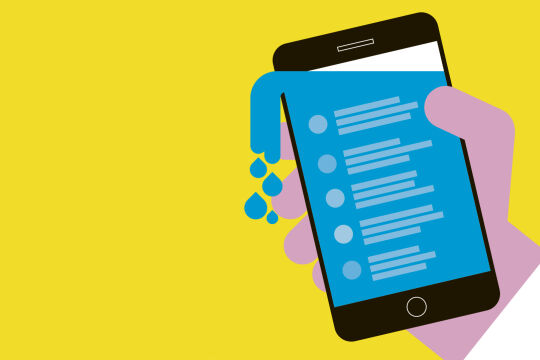Liquid Democracy - die neuen Formen der politischen Kommunikation via Internet bedeuten neue Verbindung zwischen Bürgern und Politik. Differenzierte Betrachtung ist aber geboten.
Die Sache begann vor zwei Jahren in Deutschland auf dem 26. Chaos-Computer-Kongress. Da wurde in einem Vortrag von einer "Revolution ohne Blutvergießen“ gesprochen, um durch Unterstützung neuer Medien verkrustete Strukturen der repräsentativen Demokratie aufzubrechen. An die Stelle von Parteigremien und Parlamentssitzungen sollten als wahre Volksvertretung direktdemokratische Beteiligungsformen diese ergänzen.
Jeder Bürger kann im jeweiligen Einzelfall eines Gesetzes entscheiden, ob er seine Interessen von Abgeordneten vulgo Politikern gut vertreten fühlt. Oder ihnen das in klassischen Wahlperioden für ein paar Jährchen übertragene Stimmrecht entzieht, um lieber selbst abzustimmen. Dafür kann sich natürlich nicht die ganze Republik Tag für Tag auf einem Marktplatz versammeln, doch das Internet macht’s möglich. Im Zeitalter der Piraten und sonstiger Online-Parteien erscheinen solche Ideen real, obwohl in der Diskussion darüber notwendige Verfassungsänderungen und die Notwendigkeit einer entsprechenden Mehrheit ignoriert werden.
Immerhin steht sowohl in Artikel 38 des deutschen Grundgesetzes als auch Artikel 56 der österreichischen Bundesverfassung, dass politische Mandatare als Vertreter des ganzen Volkes - und nicht etwa nur der Anhänger oder Wähler einer Partei - völlig weisungsfrei und nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. Das würde durch Mausklicks eines untypischen Grüppchens im Netz genauso frivol unterlaufen wie durch die angeblich freiwillige Fraktionsdisziplin vulgo Klubzwang in traditionellen Parteien.
Die Schlüsselfrage eines "flüssigen“ Wechselspiels von Basis- und Repräsentativdemokratie ("Liquid Democracy“) ist, ob man neuen Medien und neuen Parteien im Duett eine Mobilisierung bisher an der Politik nicht teilnehmender Gruppen zutraut, so dass diese sich konstruktiv in Demokratieprozesse einbringen.
Die Mobilisierungstheorie stimmte, als im arabischen Frühling via Facebook, Twitter & Co. Leute eine Chance zur politischen Teilnahme sahen, deren Meinungen ansonsten ein Diktator unterdrückt und von traditionellen Medien ferngehalten hätte. Weniger eindeutig ist die Antwort für demokratische Systeme. Natürlich haben wir ebenfalls privilegierte Medieneliten, doch warum sollte das politische Interesse steigen, wenn Wahlbeteiligungen trotz aller Freiheiten dazu sinken?
Die Top-Twitterati sind bestehende Eliten
Eine Systemveränderung in Richtung "Liquid Democracy“ führt nicht automatisch zu einem Einstellungswandel. Wer die Piraten aus Protest oder Jux wählt, ist keineswegs zwangsläufig bereit, für etwas statt gegen alles zu sein oder sich auch nur länger als ein paar Minuten in der Woche mit politischen Themen auseinanderzusetzen. Mehr Informationsbereitschaft und verbesserte politische Bildung der Massen wäre jedoch Voraussetzung.
Der Tatsache, dass sich neue Gruppen und Parteien über das Internet formieren, stehen freilich unzählige Beispiele gegen-über, dass bestehende Eliten neue Medien besonders effektiv zu nutzen verstehen. Österreichs Top-Twitterati sind Journalisten oder professionelle Kommunikatoren. Die am meisten genutzten Internetangebote stammen von altbekannten Medienunternehmen.
Eine Informationskluft und kommunikative Überforderung kann sich in der digitalen Demokratie also verstärken und nicht abschwächen. Das wäre die Verstärkungstheorie als Gegenthese: Wer schon jetzt Politik für unwichtig hält oder sich daraus einen Jux ohne jedwedes Verantwortungsbewusstsein für seine Meinung macht, der wird womöglich in großer Zahl zum Schrecken der Piraten, weil sie sich als Partei nach ihm richten wollen.
Vertrauen in die neuen Akteure?
Das ist ernst zu nehmen, denn der Satz von der drohenden Tyrannei einer populistischen Mehrheit stammt nicht von rotschwarzblaugrünorangen Systembewahrern, sondern vom französischen Denker Alexis de Toqueville. Ebenso führt die unbestreitbare Tatsache, dass den momentanen Parlamentsparteien Österreichs misstraut wird, nicht zum Umkehrschluss, neuen und sich via Internet formierenden Akteuren würde vertraut.
WikiLeaks, Anonymous und Piraten erhalten Zuspruch für das, wogegen sie sind und auftreten. Es ist zudem medial spannend, darüber zu berichten. Doch folgt daraus eine mehrheitliche Zustimmung, wofür sie sind bzw. wie sie denken und handeln? Kein Law and Order-Rechtsaußen, sondern SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte: "Das Verhältnis der Internet-Community zu Polizei und Justiz muss sich ändern. Gelegentlich werden Hetze, Beleidigungen oder gar Bedrohungen als eine Art Folklore hingenommen.“
Fairerweise muss man ergänzen, dass Neuparteien sich wahrscheinlich der Gefahr bewusst sind, zum Zugpferd auch für fragwürdige Gestalten zu werden. Mehrere Piraten versuchen gegenzusteuern. Auch ist allein ihre Existenz ein Wert für das politische System, welches nach der Logik des Jahres 1945 entstand und in der Tat reformiert gehört.
Die nach der Indoktrinierung durch nationalsozialistische Propaganda früher verständliche Angst vor zu viel Beteiligung des Volkes ist heute als Argument nicht mehr zeitgemäß. Mehr Möglichkeiten direkter Demokratie sind durchaus zu befürworten. Lösungskompetenz für die Alltagssorgen der Menschen - Angst vor Inflation, Jobverlust, dem Versagen des Gesundheitssystems o. Ä. - wird allerdings den alten und neuen Akteuren gleichermaßen kaum zugetraut, sodass sich der politische Zynismus ungeachtet von Proteststimmen für Piraten und Konsorten in einer "Liquid Democracy“ erhöhen könnte.
Es ist nicht bewiesen, ob durch eine solche a) die Qualität politischer Entscheidungen, b) die Verpflichtung solcher für das Gemeinwohl und c) die Transparenz zunehmen. Ein Problem ist, wenn Befürworter primär mit Vergleichen punkten: "Die Entscheidungen unserer Parlamentarier sind sicher nicht klüger, verantwortungsvoller und leichter verständlich!“ Das mag öfters stimmen, doch beim genauen Lesen zeigt sich, dass im Grunde gar nicht mehr an gute Politik geglaubt wird. Unterschiedliche Demokratiemodelle werden bloß noch nach dem Kriterium des kleineren Übels verglichen.
Die Hauptgefahr einer "Liquid Democracy“ steht damit in Zusammenhang: "Die Wiki-Revolution“-Buchautor Wätzold Plaum schreibt als Mitglied der deutschen Piraten, dass man künftig nicht nur Parteien, sondern themenspezifische Bündnisse oder Bürgerinitiativen wählen könnte. Also etwa die "Uni brennt“-Bewegung beim Thema Studiengebühren.
Internet-Demokratie bedeutet junge Themen
Der Haken ist eine mögliche Systemblockade. Die Zeit für längere Diskussionen und Entscheidungsprozesse zwecks mehr Basisdemokratie kann und soll man sich nehmen. Doch ist das Schlagwort der mangelnden Effizienz nicht von der Hand zu weisen. Dafür ist das Paradebeispiel zu dramatisch: Im Reichstag fanden sich Negativmehrheiten gegen alles - zum Teil mit kuriosen Allianzen von Nationalsozialisten und Kommunisten -, sowie Positivmehrheiten für nichts.
Das hat den Ruf nach einer diktatorischen Führung unterstützt. Wenn neue Parteien in ihrer Vorstellung einer "Liquid Democracy“ mangels Mehrheitsfindung ihre Ziele nie umsetzen, so wären stets die Altparteien da oben schuld. Das ist bequem. Doch ist man letztlich dazu verdammt, bloß vergossene Milch zu produzieren und jedwede Politik zu verhindern.
Und noch etwas: Für Volksabstimmungen beweisen Studien, dass sich weniger Bürger als an Wahlen beteiligen - in Italien sind das rund 50 zu 90 Prozent - und darunter besonders viele gut gebildete und gut verdienende Menschen sind. Das macht Entscheide von der Beibehaltung des Gymnasiums bis zum Steuersatz je nach Einkommenskategorie sehr subjektiv.
Bei einer durch das Internet vermittelten Direktdemokratie kommt hinzu, dass eine Technik-Elite am besten weiß, wie "Liquid Feedback“ funktioniert. Es ist Altersdiskriminierung, wenn man das mit einem Achselzucken abtut. Wenn Gesundheit und Pflege auf Facebook oder Twitter selten ein Thema sind, so liegt das an der jugendlichen Fachöffentlichkeit und ist gesellschaftspolitisch schlecht.
Zur Klarstellung: Das soll kein Plädoyer gegen neue Parteien und "Liquid Democracy“ sein. Vielmehr ist es ein Aufruf an alle Proponenten sich zeitgerecht mit möglichen Gefahren auseinanderzusetzen. Nur so können sie neben emotionalen Apokalyptikern und Agnostikern - diese sehen in "Liquid Democracy“ den Untergang oder die Rettung demokratischen Miteinanders - sachlich einen zentralen Beitrag zur Modifikation des Politsystems leisten. Es muss nicht immer gleich eine Revolution sein.
|Der Autor ist Professor für Politische Kommunikation (Uni Krems und Graz), Leiter des Instituts für Strategieanalysen (ISA, Wien)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!