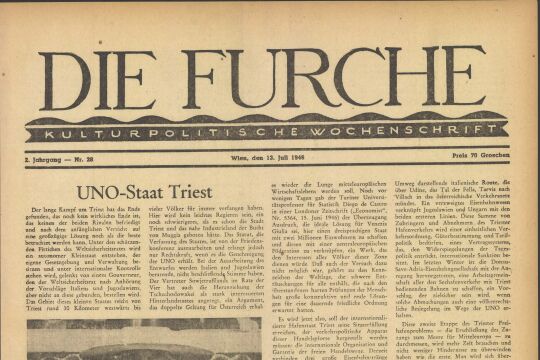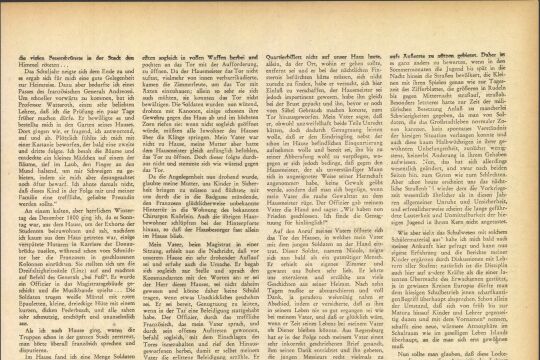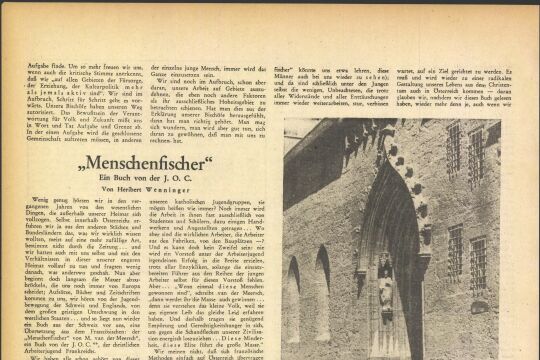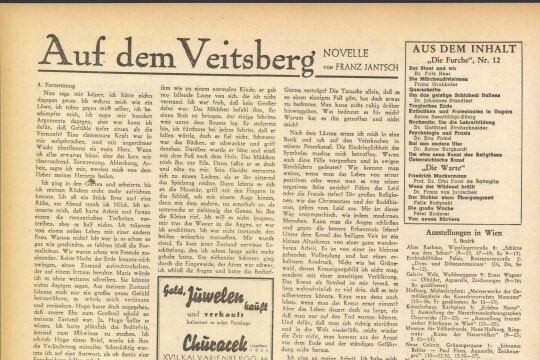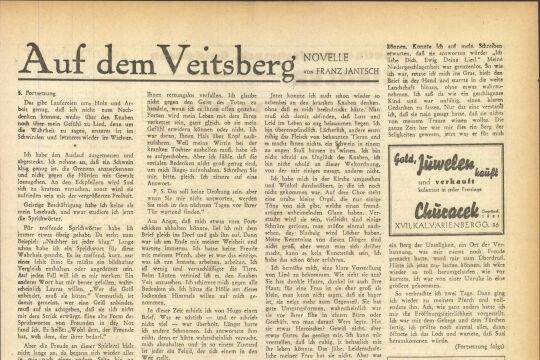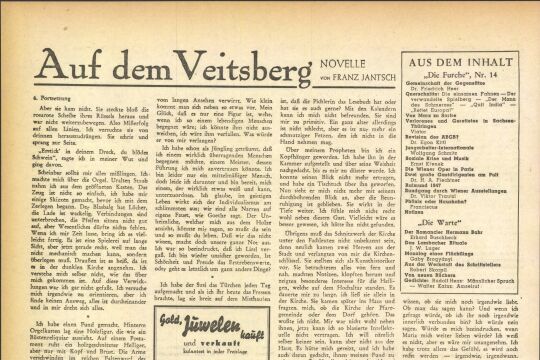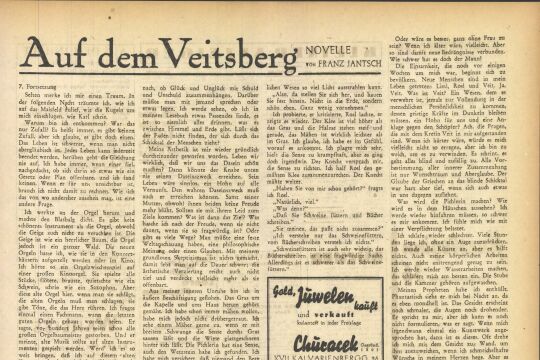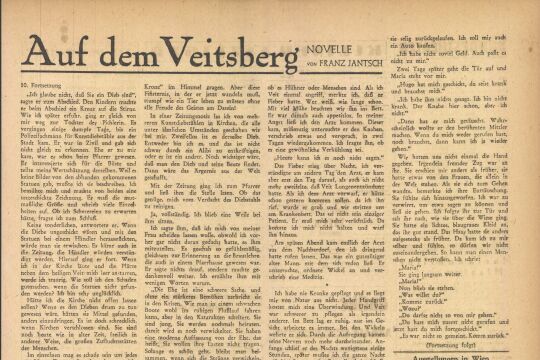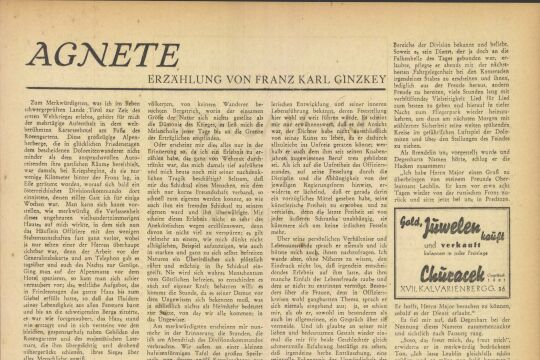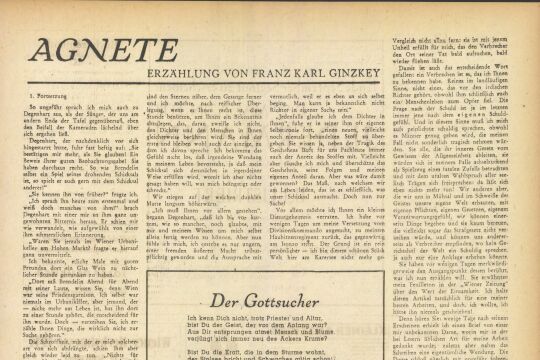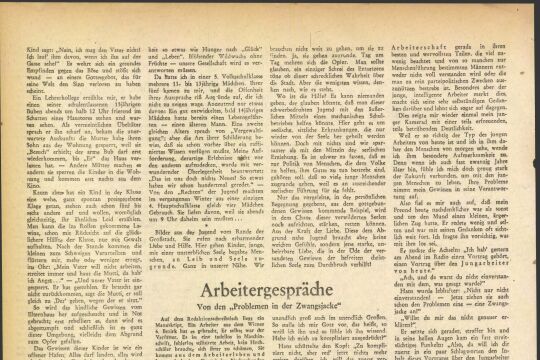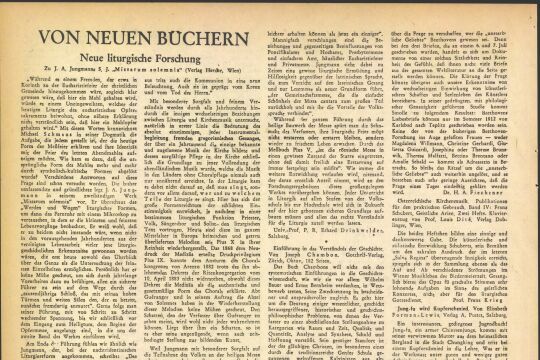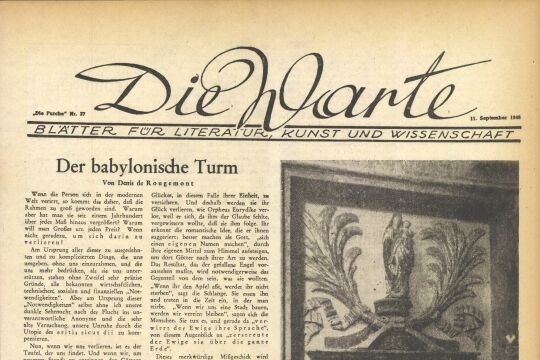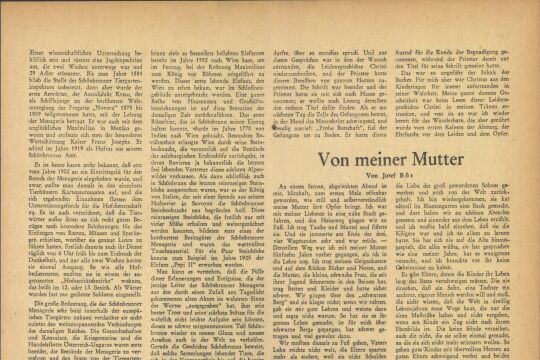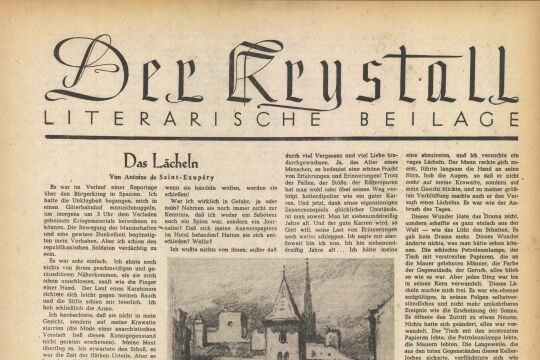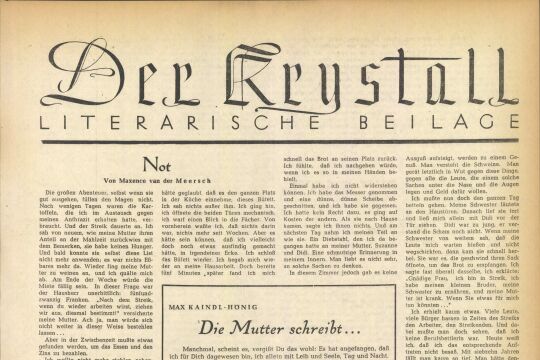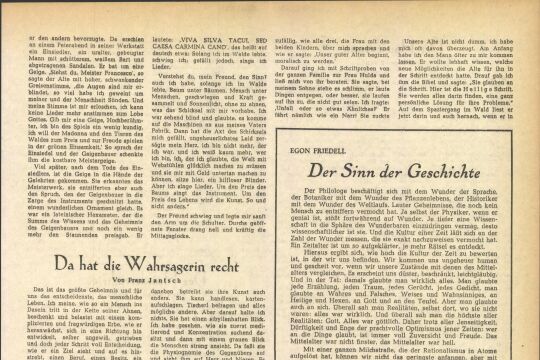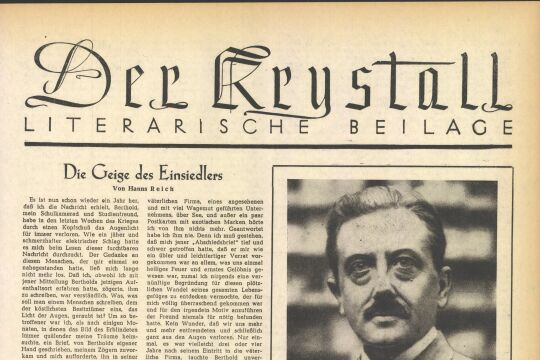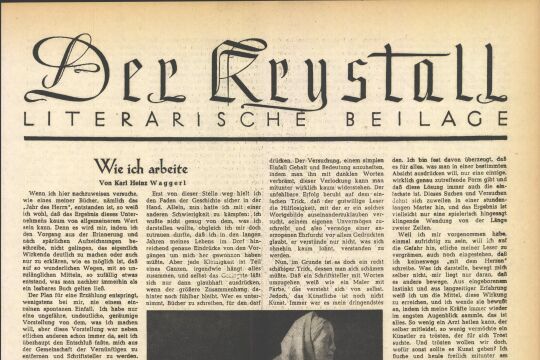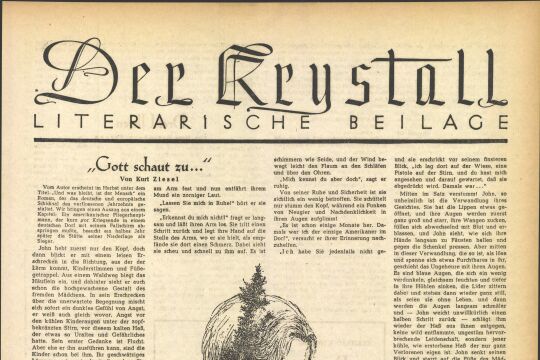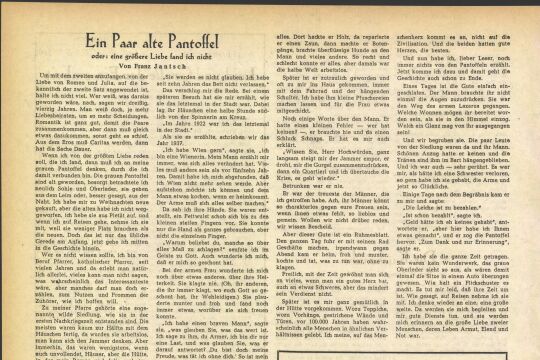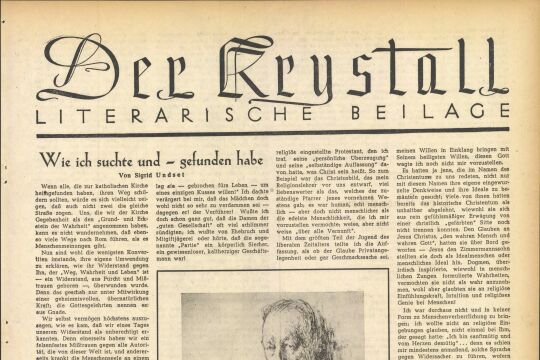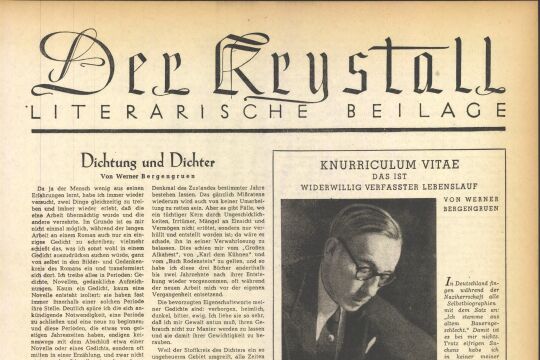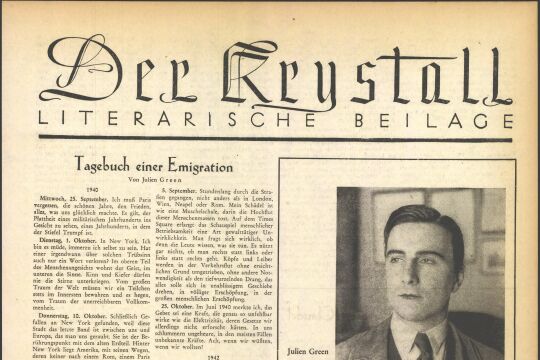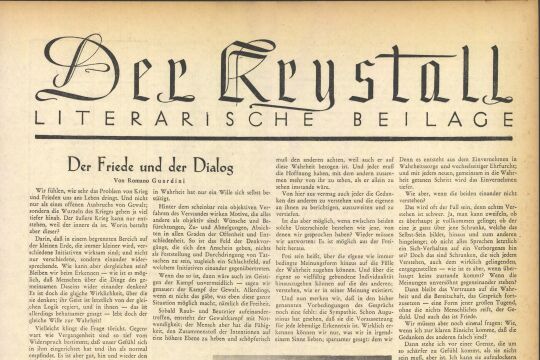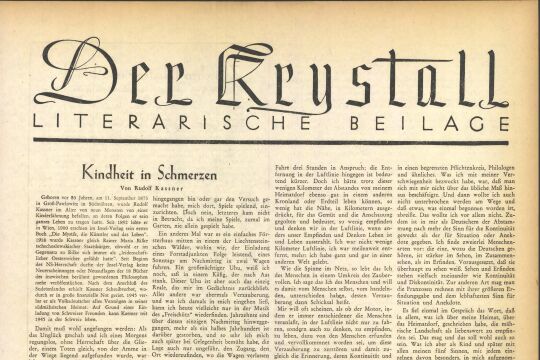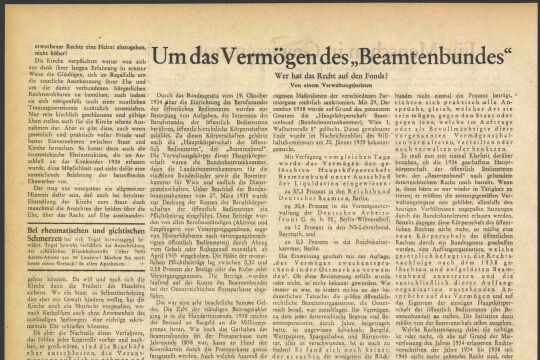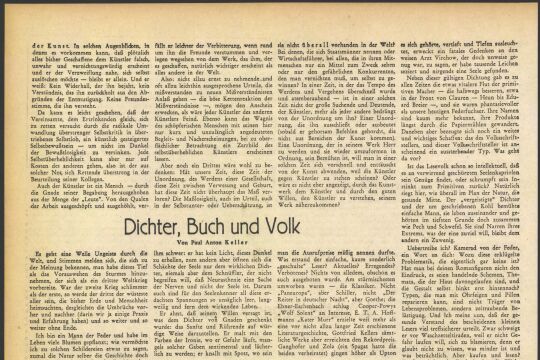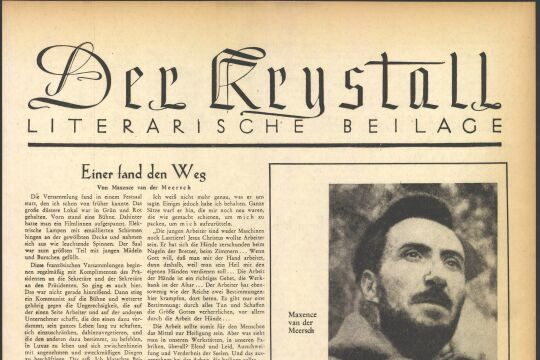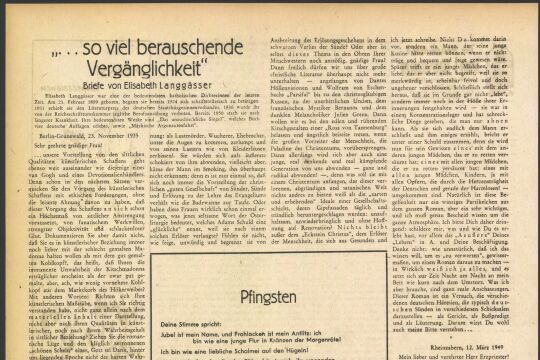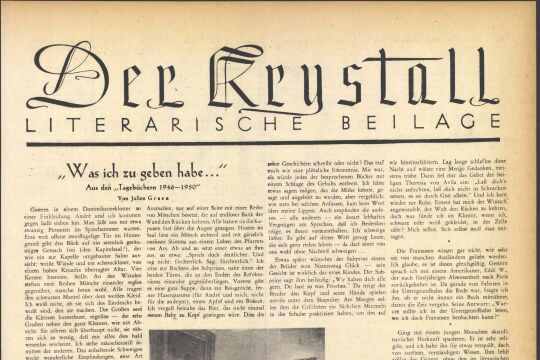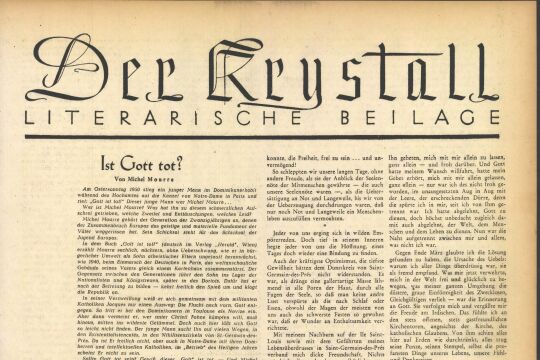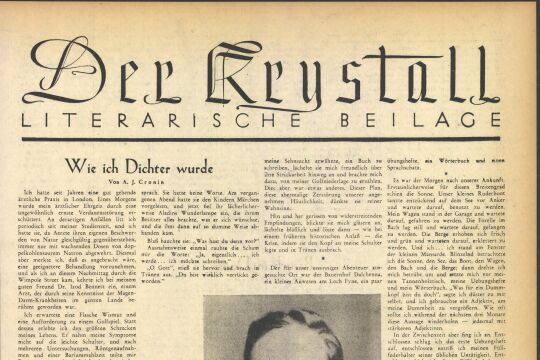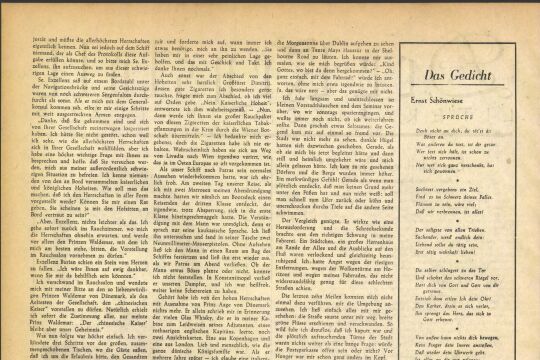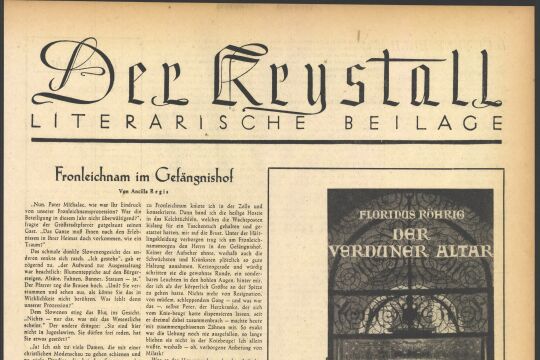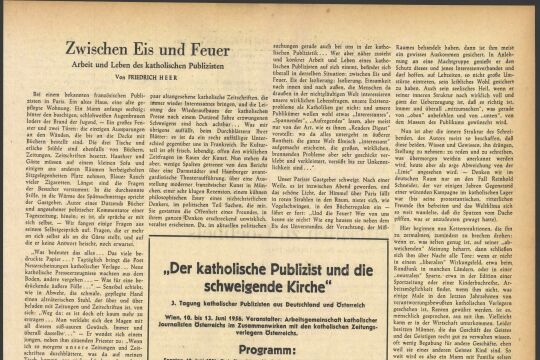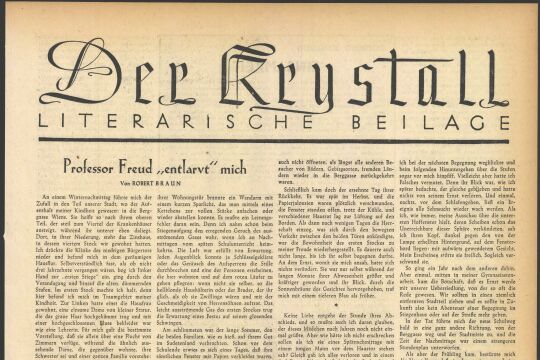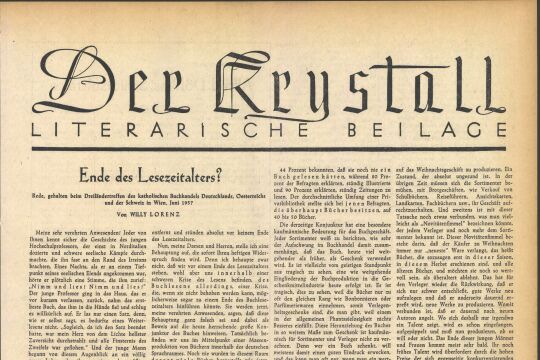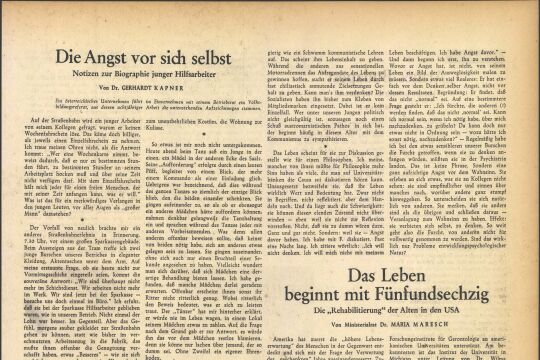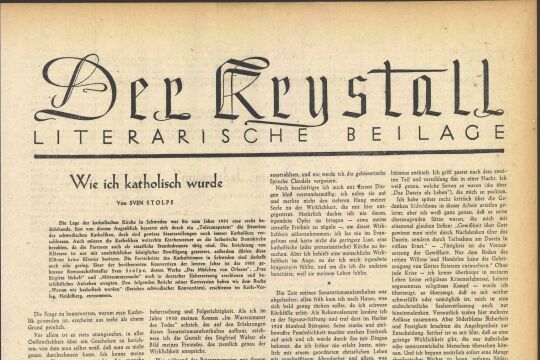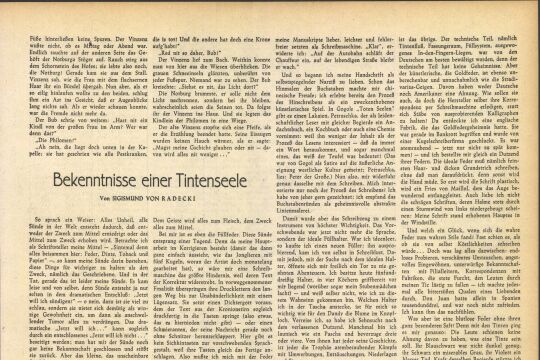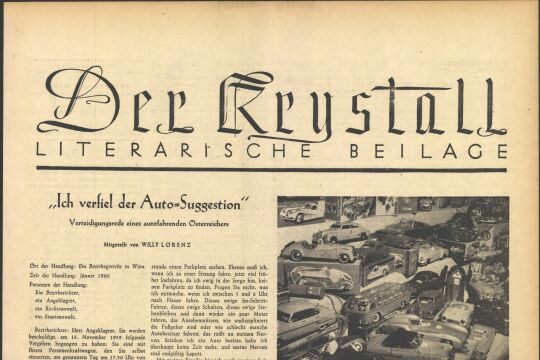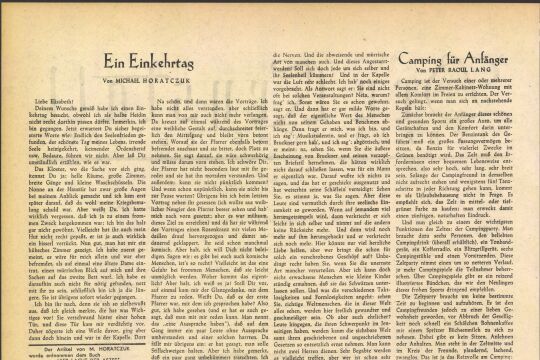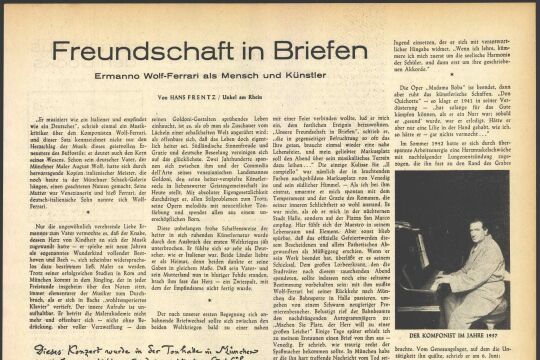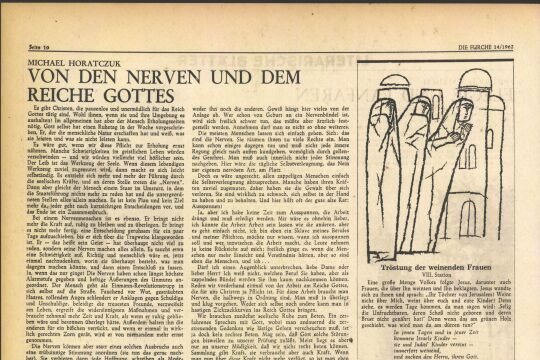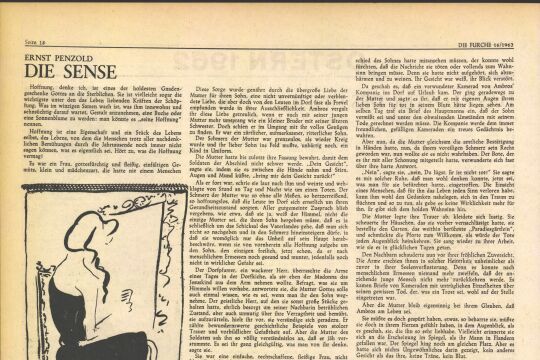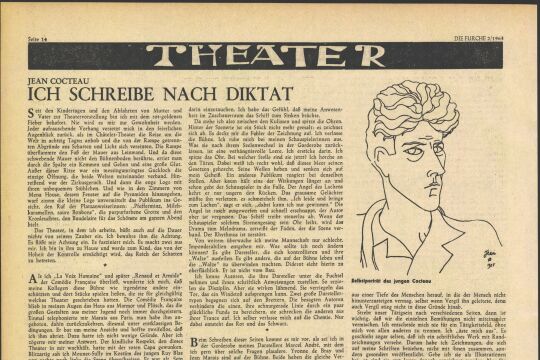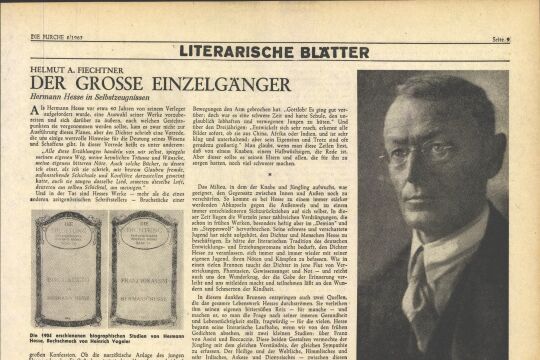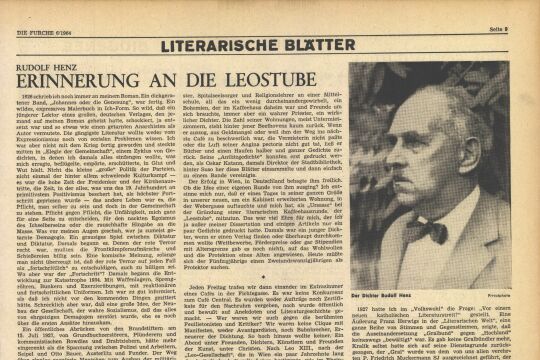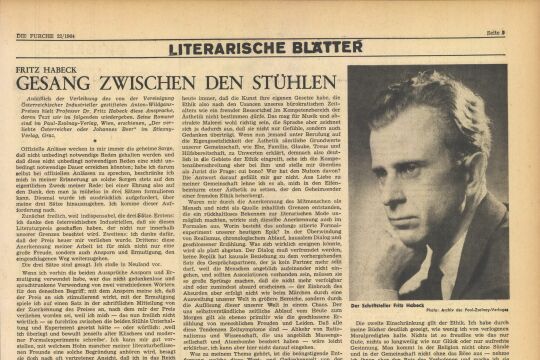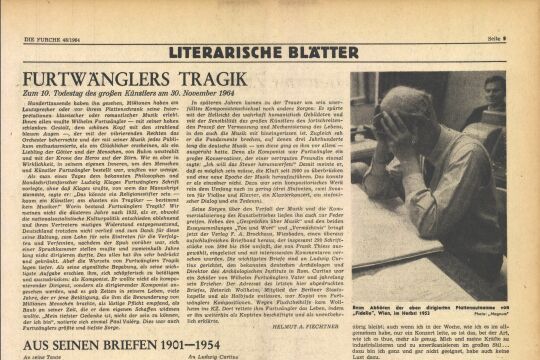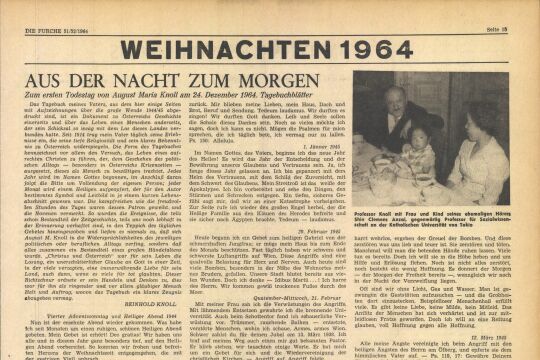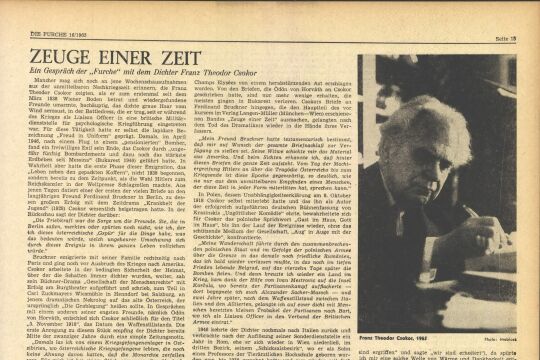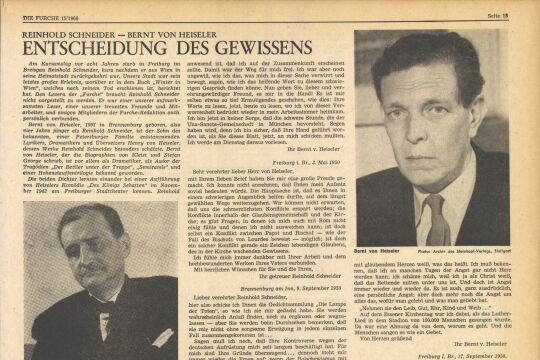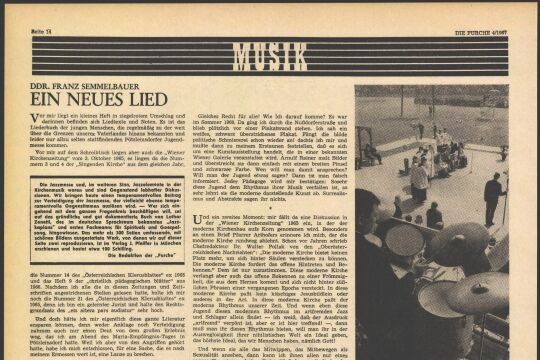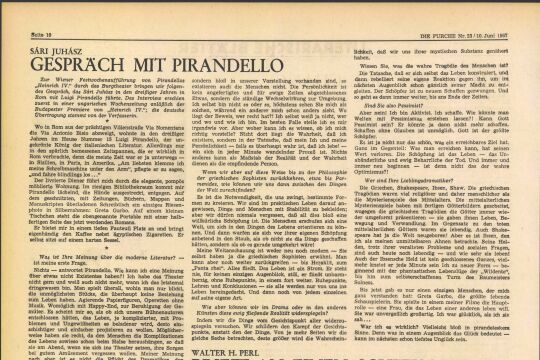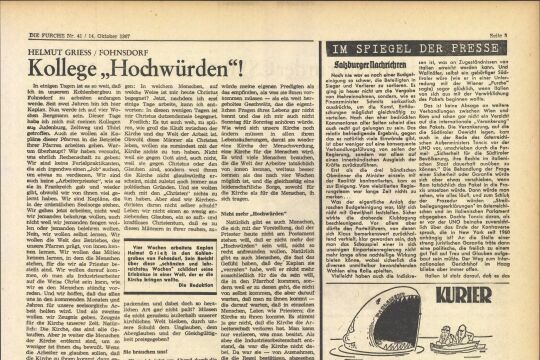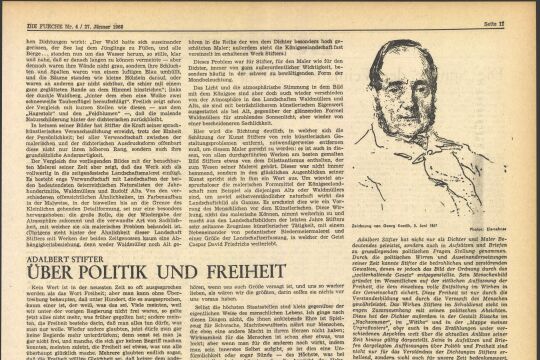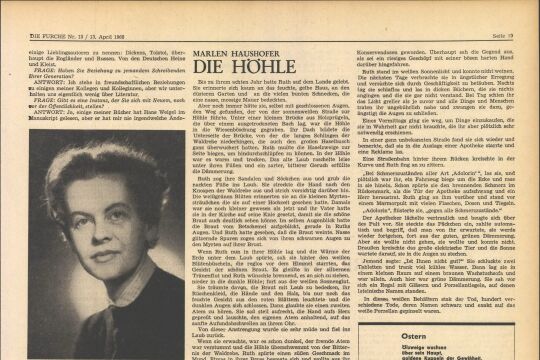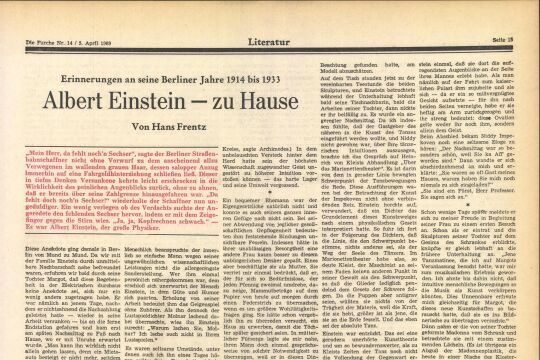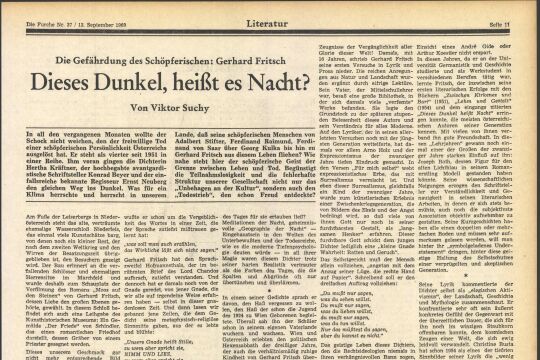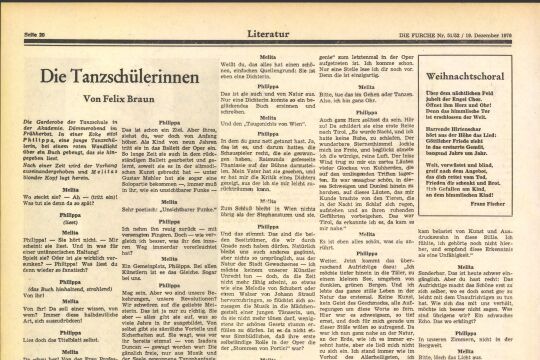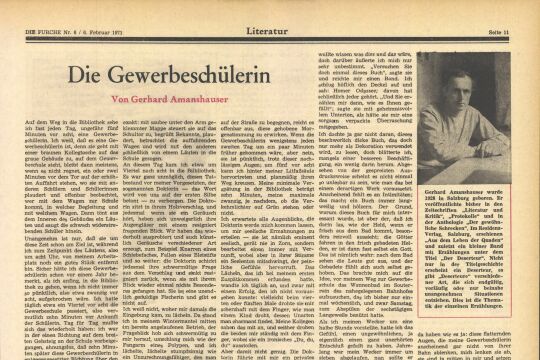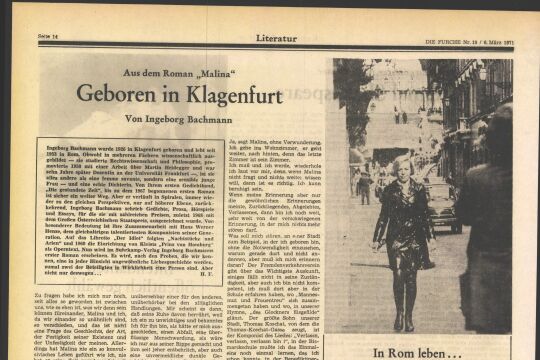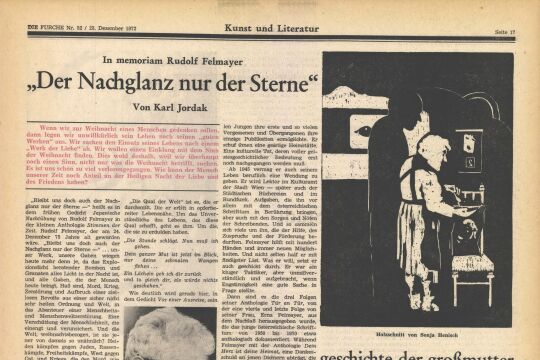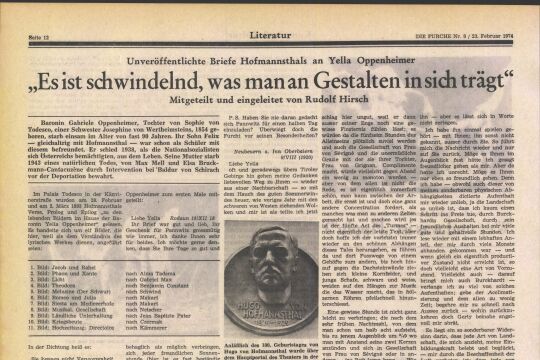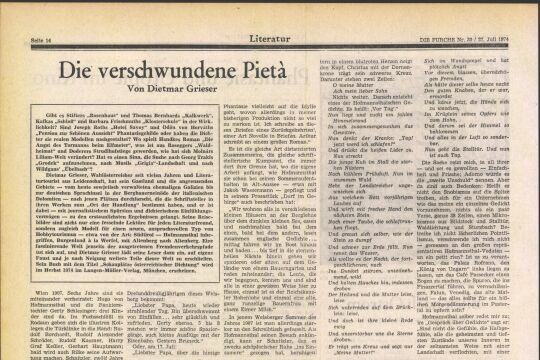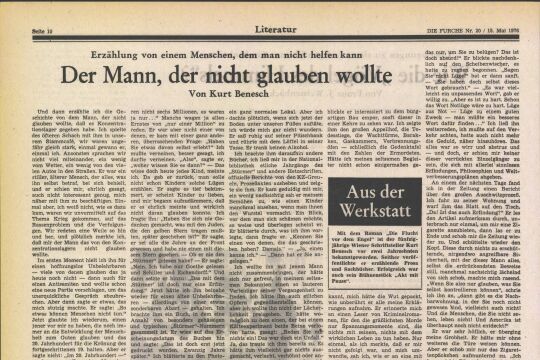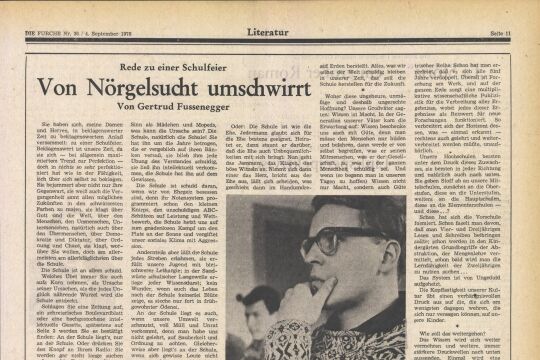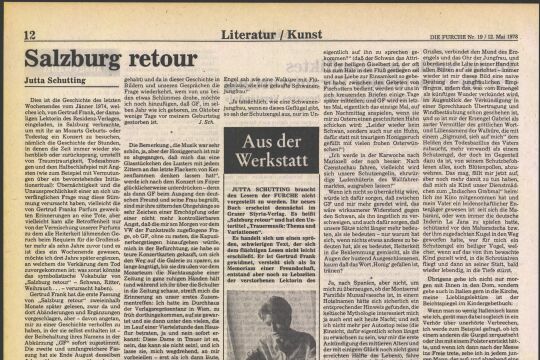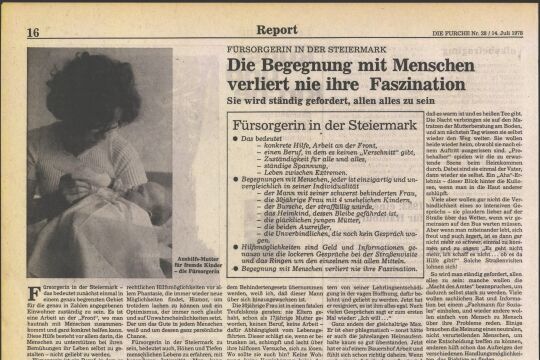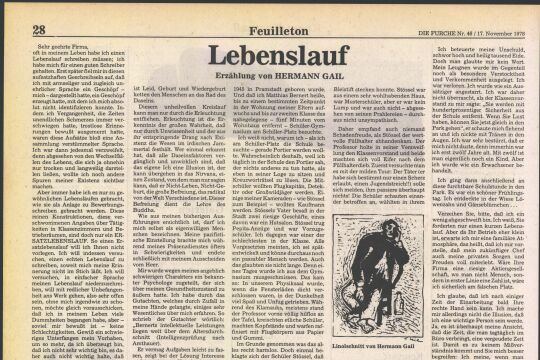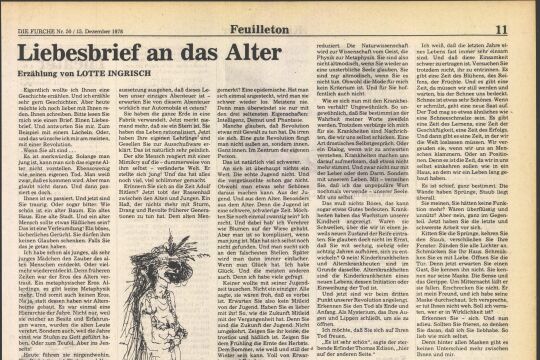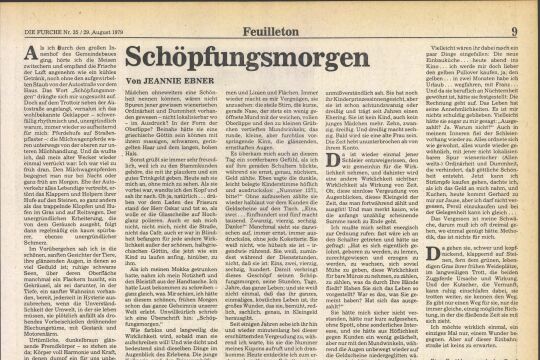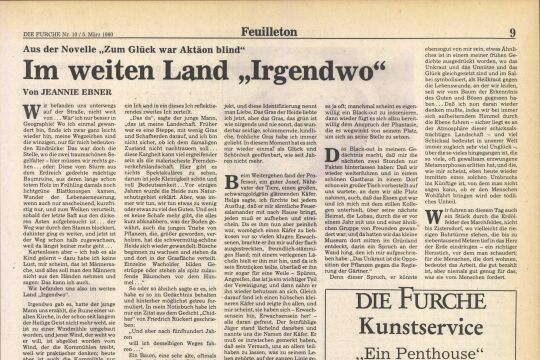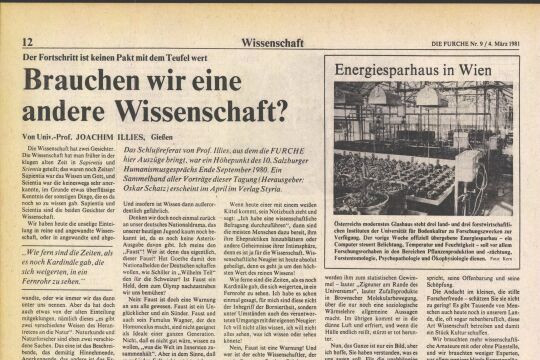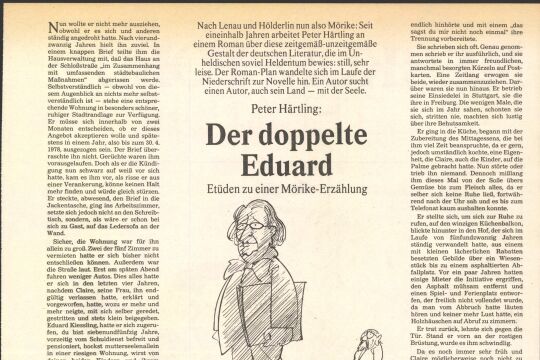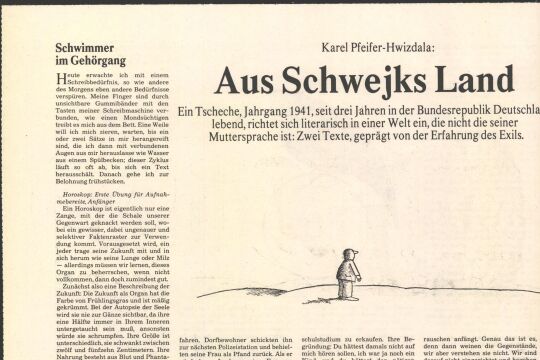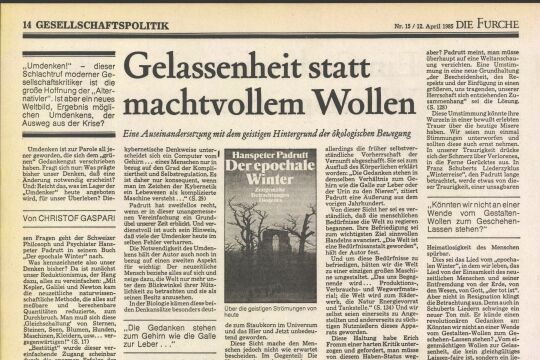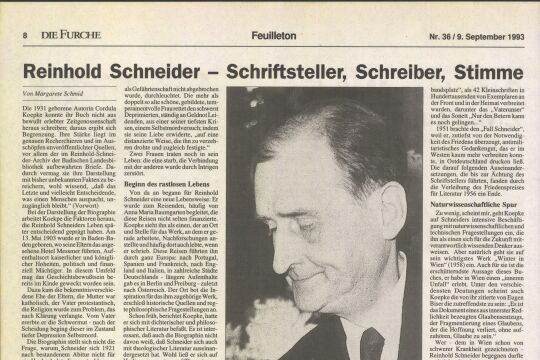Globart: Transformationen
DISKURS
Friedrich von Borries: Erstmal aufhören
Der Designtheoretiker und Autor erwidert auf das Jahresthema der Tage der Transformation „Anfängerinnen“ mit einem dringlichen Plädoyer.
Der Designtheoretiker und Autor erwidert auf das Jahresthema der Tage der Transformation „Anfängerinnen“ mit einem dringlichen Plädoyer.
Er hatte es fast geschafft, der Stein, so schien es, lag sicher auf der Spitze des Berges, dann geriet er wieder in Bewegung und rollte donnernd hinab ins Tal; Sisyphos schaute ihm hinterher, dann stieg er den Berg wieder herunter. Im Tal angekommen, fing er wieder von Neuem an.
Sisyphos war ein Meister im Anfangen. Immer wieder, immer wieder. Warum aber hörte er mit der sinnlosen Tätigkeit nicht einfach auf?
Ich glaube, er hatte Angst. Er hätte sich von seinen Göttern und Götzen lossagen müssen.
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, heißt es in Hermann Hesses berühmten Gedicht Stufen. Dem Bild des Anfangens wohnt also auch etwas Poetisches inne. Eine neue Chance. Neues Glück. Wir sind unschuldig – und beginnen etwas, spielerisch, leicht, unbefangen. Ein schönes Bild – in Anbetracht der globalen politischen und ökologischen Situation aber auch unangebracht, wenn nicht gar verlogen. Nichts ist da unschuldig, nichts ist leicht, auch wenn wir uns das –verständlicherweise – wünschen wollen.
Geniale Dilletanten lautet der –absichtlich falsch geschriebene – Titel eines Festivals, das 1981 in Berlin stattfand. Die Vorstellung, nichts nach althergebrachten Vorstellungen „richtig“ machen zu müssen, sondern einfach alles auszuprobieren, war damals ein Akt des Widerstands, war Protest, war Punk. Aber eben auch nur Revolte im Kleinem, die zu keiner grundlegenden Veränderung führte. Im Gegenteil: Der Modus des Einfach-mal-drauflos-Machens ist längst kapitalistisch inkorporiert und der Business Punk ist neues Leitbild der Wachstumsgesellschaft. Einfach-mal-drauflos-Machen ist keine kritische Haltung mehr, sondern stabilisiert das bestehende System.
Besonders problematisch wird das Bild des „Anfangs“, wenn es eine entlastende Funktion hat, im Sinne von: Wir wissen ja noch nicht, wie es geht, deshalb fangen wir halt mal irgendwo an, um zu schauen, was möglich ist. Denn sowohl im Hirn als auch tief in unserem Herzen wissen wir, was zu tun ist: Wir müssen nicht Neues anfangen, sondern Gewohntes, Bekanntes, Geliebtes beenden. Das Problem ist nicht, was unser Lebensstil der Zukunft sein wird, sondern wie wir mit dem gewohnten – der Art, wie wir wohnen, was wir essen, was wir konsumieren – aufhören. „Unsere Kultur“, so der Sozialpsychologe Harald Welzer, „hat kein Konzept zum Aufhören“. Anfangen, ja das können wir, Anfänger:in sein, ja, das finden wir toll, das ist aufregend, das ist sexy, das ist hip. Aber aufhören, das ist schwierig. Das ist schmerzhaft. Das ist Verlust. Verlust an Sicherheit, Verlust an Komfort.
Also: Bevor wir etwas anfangen, bevor wir uns fröhlich und wohlgemut als Anfänger:innen beschreiben, sollten wir erstmal aufhören mit dem, wovon wir wissen, das es falsch ist. Kein Anfang ohne vorherigen Abschied. Kein Zauber ohne Schmerz. Wie müssen Abschied nehmen von den alten Göttern und Götzen, von denen wir wissen, dass sie nicht gut sind für den Planeten. Auch wenn es wehtut. Oder, wie Hesse am Ende seiner Stufen schreibt: „Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!“
Und dann kann man auch etwas wirklich Neues anfangen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!