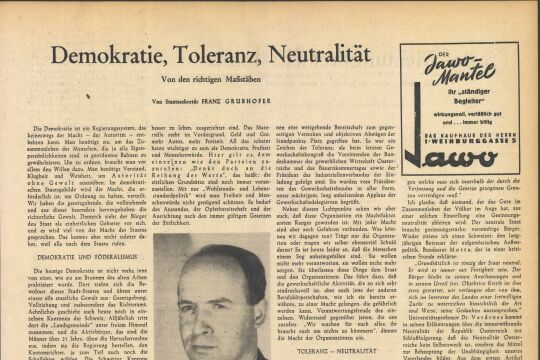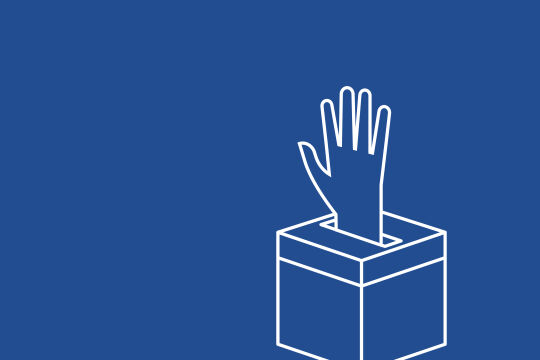Führungs-Kraft und TÄUSCHUNG
Autorität soll nicht autoritär werden, soweit so klar. Aber wann wird aus dem Einen das Andere? Anhaltspunkte für die politische Praxis.
Autorität soll nicht autoritär werden, soweit so klar. Aber wann wird aus dem Einen das Andere? Anhaltspunkte für die politische Praxis.
Jede politische Ordnung hat Autorität, braucht Autorität. Verbindliche Entscheidungen müssen getroffen, die gefassten Beschlüsse umgesetzt werden. Dies alles hat mit Macht zu tun - mit der Fähigkeit, den eigenen Willen gegen Widerstand durchzusetzen; gleichgültig, worauf sich diese Fähigkeit gründet. Die Ordnung der Macht aber ist Autorität. Diese ist unvermeidlich -in der Demokratie so - und in der Diktatur.
In der Demokratie freilich gibt es Mechanismen, die verhindern sollen, dass die notwendige, die unvermeidliche Autorität außer Kontrolle gerät; dass sie autoritär wird. Die Demokratie ist auch und vor allem als "Nicht-Tyrannei" zu verstehen. Demokratie wird definiert durch das, was sie nicht ist: Sie ist nicht die Herrschaft eines Einzigen, auch nicht die Herrschaft einer Minderheit; aber auch nicht einfach die Herrschaft der Mehrheit. Denn diese - so unverzichtbar auch das Mehrheitsprinzip in der Demokratie ist - braucht ihre Begrenzung: in Form unveräußerlicher, politisch nicht zur Disposition stehender Minderheits- und Individualrechte.
Deshalb folgt jede Demokratie dem Prinzip der Machtteilung. Autorität darf nicht nur eine Person, auch nicht nur eine Institution besitzen. "Checks and Balances" wird dieser Grundsatz in den USA genannt, Gewaltenteilung ist der andere Begriff dafür. Diese Machtteilung kann konkret verschiedene Formen annehmen -aber in allen Demokratien der Gegenwart besteht sie vor allem in der Unabhängigkeit der Rechtsprechung und in einem Mehrparteiensystem, das sicherstellt, dass es eine offen auftretende Opposition gibt, die auf die zeitliche und inhaltliche Begrenzung jeder Autorität verweist.
Das eherne Gesetz der Oligarchie
Mit der Demokratie ist eine zeitlich unbegrenzte Autorität nur in Ausnahmefällen vereinbar: In parlamentarischen Monarchien etwa, wenn die Rolle der Krone auf eine symbolische Funktion beschränkt ist; oder bei Höchstrichtern, deren Unabhängigkeit dadurch garantiert werden soll, dass sie nicht um ihrer Wiederbestellung willen einem Präsidenten zu Belieben sein wollen.
Vor mehr als einem Jahrhundert haben in Europa die Elitentheoretiker (Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels) darauf verweisen, dass es auch in einer institutionell eingebundenen, durch "Checks and Balances" beschränkten Autorität Tendenzen zur Verselbständigung von Macht gibt - zur Emanzipation der Autorität von ihren Begrenzungen. Michels hat diese Neigung das "Eherne Gesetz der Oligarchie" genannt.
Gegen diese Neigung können Instrumente eingesetzt werden -etwa die Begrenzung der Möglichkeiten, immer und immer wieder in das gleiche Amt gewählt zu werden. Deshalb sieht etwa die Verfassung Mexikos vor, dass ein Präsident nie mehr wieder gewählt werden kann -Ergebnis der Erfahrung des "Porfiriats", als Ende des 19. Jahrhunderts Porfirio Diaz sich immer und immer wieder zum Präsidenten wählen ließ und dabei Techniken der Machterhaltung verwendet wurden, die "autoritär" zu nennen sind: Manipulation von Gremien, Einschüchterung von politischen Gegnern, Korrumpierung von Entscheidungsträgern.
Auch im demokratischen Rechtsstaat droht Autorität, autoritär zu werden - wenn sie sich den institutionellen Begrenzungen der Verfassung zu entziehen versucht; auch, wenn sie diesen Begrenzungen zum Trotz sich autoritär gibt: durch die Betonung der Bedeutung einer Einzelperson, durch die Vereinfachung komplexer Zusammenhänge im Sinne "Da werden wir durchgreifen". Die Einsicht, dass Demokratie eine Balance zwischen verschiedenen Institutionen und Personen ist, wird so in den Hintergrund gedrängt.
Sehnsucht nach Stärke
Unterstützt werden solche autoritären Tendenzen durch Erwartungshaltungen, die aus der Gesellschaft kommen. Personen, die legitim Autorität ausüben, werden nur zu oft geradezu gedrängt, sich mächtiger zu geben als sie -als Personen - eigentlich sind. Es ist diese Sehnsucht nach dem "starken Mann", der die "Flucht aus der Komplexität" bewerkstelligen soll, die auch von Teilen der Gesellschaft gesucht wird. Warum schwierige Verhandlungen, warum nicht eine Entscheidung sofort - und nicht erst nach Monaten? Wozu sich aufhalten mit der Feinabstimmung der verschiedenen gegenläufigen Interessen?
Die Studien, die Theodor Adorno und andere um die Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA durchgeführt haben, sind durch aufwendige Erhebungen gestützte empirische Analysen dessen, was die "autoritäre Persönlichkeit" genannt wird: Menschen, die sich durchaus als Demokraten verstehen, erwarten sich von "denen da oben" klare Ansagen, klare Entscheidungen, klare Positionen in einem gesellschaftlichen Feld, das so in grober Vereinfachung auf den Konflikt zwischen Gut und Böse, zwischen Schwarz und Weiß reduziert wird.
Dass Politik gerade in der Demokratie vor allem auf einem Abwägen zwischen Grautönen aufbaut, dass es nur in Ausnahmefällen - wenn es um den Bestand der Demokratie insgesamt geht - eine allen einsichtige, alle verpflichtende Parteinahme gibt: Das geht dabei unter.
Hans Kelsen hat den Relativismus als die Grundtugend der Demokratie bezeichnet: Zur Demokratie ist der (die) kaum fähig, der (die) mit absoluter Sicherheit zu wissen glaubt, was für Gesellschaft und Staat das einzig Richtige ist. Wer das "Mehr oder Weniger", das "Sowohl-als-auch" der Demokratie ablehnt, wird sich -bestimmt von der Sehnsucht nach unbedingter Eindeutigkeit -in der Demokratie nicht so recht heimisch fühlen können; und wird, als Wählerin oder Wähler, Druck auf die Parteien ausüben, doch diese Eindeutigkeit vorzutäuschen. Und Parteien, geleitet vom Interesse am Wahlerfolg, werden diese Sehnsucht berücksichtigen - indem sie etwa wider besseres Wissen einfache Lösungen propagieren.
Die Spirale des Autoritären
Diese Widersprüchlichkeit ist Teil des demokratischen Alltags: Die "da oben" sind versucht, die Grenzen ihrer Macht auszuloten und nach Wegen zu suchen, da und dort diese Grenzen zu überschreiten. Die "da unten" sind nur zu oft geneigt, diese autoritären Tendenzen der Regierenden (oder zur Regierung Drängenden) geradezu einzufordern; und reduzieren so die Hemmungen der politischen Funktionseliten, nach mehr Macht zu greifen. Die Demokratie wird so zwar nicht zerstört -jedenfalls nicht unmittelbar; aber unter den fordernden Zurufen von "unten" werden die Grenzen der Macht durchlässiger.
In einer stabilen Demokratie kann man mit dieser Widersprüchlichkeit leben. Autoritäre Tendenzen werden demokratisch eingedämmt - und solange die Minimalstandards der Demokratie (freie und faire Wahlen, die darüber entscheiden, wer regiert) gewährleistet sind, müssen die Alarmsirenen noch nicht schrillen. Aber es ist notwendig, sich den skeptischen, den kritischen Blick auf diese Zusammenhänge zu bewahren.
Wir wissen nicht immer so ganz genau, wie und wo wir die Grenze zwischen demokratisch legitimer Autorität und politisch autoritärem Verhalten ziehen sollen. Aber in der Praxis ist zumeist schnell erkennbar, was autoritär ist -etwa das Verhalten eines Präsidenten oder eines Ministers, der Oppositionelle als "Feinde des Volkes" bezeichnet; aber auch das Verhalten von Parteien oder Bewegungen, die nach dem "starken Mann" rufen, der endlich "durchgreifen" soll. Und wenn die so Agierenden für ihr autoritäres Verhalten mehr Beifall als Kritik ernten - dann ist zwar nicht oder nicht unbedingt Sorge um den Bestand der Demokratie angesagt, sehr wohl aber um deren Qualität.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!