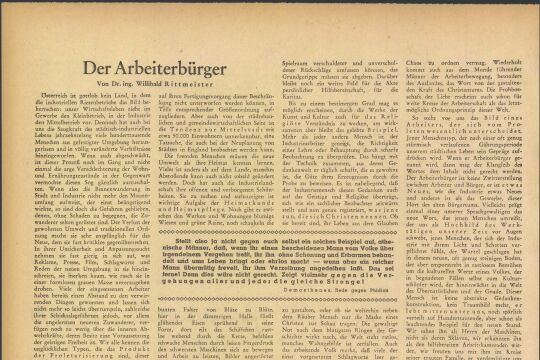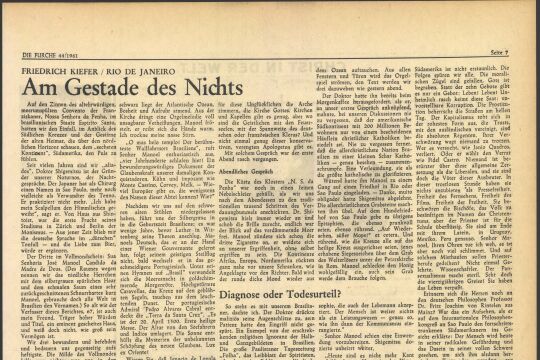Bescheidenheit ist eine Zier, die das europäische Wirtschaftsleben niemals schmückte. Die Krise ist eine dringende Aufforderung zur Mäßigung, doch wer geht schon gerne in die Wüste?
Da stand er nun, der Kuchen, in all seiner fruchtigen Pracht und seiner streuselbeladenen Süße, von Oma Hanna aufgetürmt zu einer Pyramide des Genusses auf dem Servierteller – die Mehlspeise gewordene Versuchung auf dem Frühstückstisch. Wer von uns Kindern Zeit hatte, während des Schlingens aufzusehen, konnte den zufriedenen Blick der Oma wahrnehmen, angesichts der schmatzenden Nachkommenschaft. Wenn nun die Sucht auch nach dem vierten oder fünften verzehrten Stück nicht nachlassen wollte und die vom Streuselpapp schweren Finger immer wieder Richtung Kuchenteller langten, konnte es aber plötzlich vorbei sein mit der großmütterlichen Güte: „Alles mit Maß und Ziel“, rief die Oma dann – und weg war der Kuchen.
So ist es mit dem „rechten Maß“: Die subjektiven Vorstellungen darüber klaffen weit auseinander – und das nicht nur zwischen Omas und Enkelkindern am Frühstückstisch. Die Unmäßigkeit taucht als latente Gefahr immer dort auf, wo es viel Angebot gibt, an Streuselkuchen, Immobilienkrediten oder Rendite. Und soviel ist sicher: Einigkeit bestand zu keiner Zeit darüber, was nun „genug“ oder „gerecht“ sei. Die Römer etwa wissen vom Erfinder der Kochkunst, Marcus Apicius, zu berichten, er sei durch Selbstvergiftung aus dem Leben geschieden, weil er ein Vermögen von 100 Millionen Sesterzen in Orgien verjubelt hatte und ihm nun „nur“ zehn Millionen für den Rest seines Daseins geblieben wären. Der Philosoph Seneca empörte sich deshalb, wie groß die „Üppigkeit eines Mannes sein muss, dem zehn Millionen nicht zum Leben reichen“.
Der „unparteiische Beobachter“
In diesen Tagen erlebt man viele ähnliche Auseinandersetzungen: Wenn sich Manager des Wiener Flughafens als Nachschlag zum „Skylink“-Terminal-Skandal Gehälter und Abfindung von Hundertausenden Euro zugestehen und ruhigen Gewissens auf ihre vertraglichen Rechte pochen; wenn sich Manager von US-Banken und Versicherungen von 700 Milliarden Staatsstütze 70 Milliarden als Boni auszahlen.
Allein an der Empörung darüber lässt sich ablesen: Es gibt offenbar einen gesellschaftlichen Konsens darüber, wo das Maß aufhört und die Maßlosigkeit anfängt, einen moralischen Nullmeridian des Nicht-zu-viel und Nicht-zu-wenig. Adam Smith hat in seiner epochalen Untersuchung über den „Wohlstand der Völker“ das Bild vom „unparteiischen Beobachter“ gezeichnet, der als moralische Instanz den freien Wettbewerb überwacht. Der unparteiische Beobachter ist das gesellschaftliche Gewissen. Heute wären das wohl aufgeklärte Medien, Experten, Mitglieder der Zivilgesellschaft – kurz: Meinungsbildner. Sie sollten gemeinsam mit Notenbanken und Regierungen diese Kontrollfunktion erfüllen.
Allein, wo waren sie alle, als die US-Wirtschaft der Immobilien- und sonstigen Blasenvöllerei erlag? Hatte da nicht Smiths „unsichtbare Hand“ der Märkte ungeheuren Profit versprochen und damit die „Unparteiischen“ von Beobachtern zu gierigen Komplizen gemacht? Das alles in heiterer Zusammenarbeit mit rechtsverwässernden Regierungen und durch Zinssenkungen marktbefeuernden Notenbankchefs.
Und wäre es nur das: Mindestens so schädlich wie die Gier von gestern setzt sich nun das negative Übermaß in Szene: Die ehemals freigiebigen Banken sind gerade dabei, wie schon 1929 per Kreditklemme der Realwirtschaft den Gnadenschuss zu geben, indem sie kein Geld mehr verleihen. Sie haben also nicht plötzlich zur Moral gefunden, sondern verpassen das gesuchte Mittelmaß kreditorischer Verantwortung erneut. Vielleicht wäre es hilfreich, den Managern ein Schild ins Büro zu hängen, auf dem Michel de Montaignes simpler Schluss aus seinem Essay „Von der Mäßigung“ zu lesen steht: „Der Schütze, der über die Scheibe hinschießt, fehlt ebenso als der, welcher zu kurz schießt.“
Aber wer trifft nun eigentlich noch ins Schwarze? Die sogenannte Konsumgesellschaft tut es nicht, das zeigt schon ein Blick auf die Müllberge und die staatlichen Hilfsprogramme für an Fettsucht oder Essbrechsucht leidende Jugendliche. Unser Wirtschaftssystem und Millionen Arbeitsplätze hängen von nichts mehr ab als von Erzeugung von Überfluss. Leider haben die Verwalter dieses System jene Ökonomen nicht zu Ende gelesen, die sie gerne als ihre Lehrmeister hinstellen.
Adam Smith entlarvt beispielsweise in seinen ethischen Schriften den unersättlichen Konsum, für den gerade er bis heute als Ahnvater gilt, als Selbsttäuschung der Konsumenten: „Reichtum und Macht erscheint jedem, sobald er durch Verdrossenheit oder Krankheit dahin gebracht wurde zu überlegen, was ihm tatsächlich zur Glückseligkeit fehlt, in einem erbärmlichen Licht, als ungeheure und mühsam konstruierte Maschinen, ersonnen, um ein paar wertlose Bequemlichkeiten zustande zu bringen.“ Die Menschen lassen sich demnach durch Wachstums-Versprechen blenden. Mathias Binswanger, ein St. Gallener Wirtschaftsprofessor, beschreibt in seinem Buch „Die Tretmühlen des Glücks“ den Mechanismus der Maßlosigkeit. Mehr Konsum, so Binswanger, führt ab jenem Punkt, wo die Primärbedürfnisse – also Essen, Kleidung und Wohnen – erfüllt sind, nicht zu höherem Glücksgefühl. Trotzdem würde der Konsum unter Einsatz immer neuer uneinlösbarer Glücksversprechen aufrecht erhalten. Insoferne gilt Binswangers Diktum für fettleibige Hamburgeropfer ebenso wie für Spekulanten: „Wachstum ist Opium für das Volk“.
Nietzsches Gang in die Wüste
Wo liegen aber die Alternativen zu der als Schwindel enttarnten Heilsbotschaft? Wenn nicht mehr das Wachstum, sondern das rechte Maß das Ziel des Wirtschaftens sein soll, so erfordert das die von Friedrich Nietzsche ersonnene und von Joseph Schumpeter übernommene „Umwertung der Werte“. Nietzsche nennt diesen Prozess auch treffend den „Gang in die Wüste“. Tatsächlich wäre das Umdenken radikal, wollte man nun die Mäßigung auf den Schild heben. Denn ein solches Umdenken bedeutete in der Praxis weniger Konsum, weniger Nachfrage, weniger Produktion, mehr Arbeitslose – und damit genau jene Krise, die die Staaten weltweit mit Billionenspritzen zu verhindern versuchen. Aber selbst wenn diese Rettung der Konsumgesellschaft gelänge, wäre das Dilemma nicht kleiner, sondern größer: Sollten China und Indien das Konsumniveau Europas und der USA erreichen, so könnten die globalen Nahrungsmittelressourcen den gestiegenen Bedarf niemals befriedigen: Sie würden gerade noch für 2,5 Milliarden Menschen ausreichen – die Übrigen müsste sehen, wo sie bleiben. So besehen bräuchte es den mäßigenden Gang in die Wüste eher als die Rettung des Überfluss-Systems.
Alternativen zur Rosskur liegen vielleicht in der „kreativen Revolution“, für die der Zukunftsforscher Matthias Horx und der Journalist Wolf Lotter werben (siehe S. 23) oder in einer Fokussierung auf ein durch staatliche Geldkontrolle gebremstes Wachstum, das Ökonomen wie Joseph Huber oder Hans Christoph Binswanger einfordern.
Das alles unterstellt aber, dass der Mensch europäischer Denkart ein Grundprinzip seines Wesen ändern kann. Vergebliche Appelle dazu gibt es seit mehr als 2000 Jahren: Sokrates mahnt zur Mäßigung als einzigem Weg zum Glück, Seneca beklagt die Sucht nach Besitz, Papst Benedikt XVI. jüngst den zügellosen Materialismus und den Mangel an Liebe. Und das ist nun die Situation: Wir sitzen gemeinsam mit unseren Politikern mit klebrigen Händen vor Oma Hannas Kuchen, schlingen, was der Rachen fasst – und jetzt kommt jemand und sagt: „Finger weg!“
Es wird also Tränen geben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!