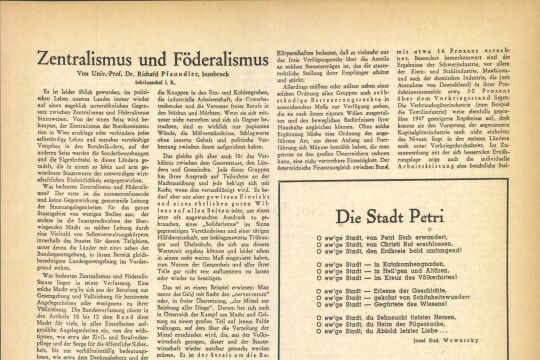Die hehren politischen Ziele des Treffens der G8 in Deauville beschäftigen sich kaum mit der schwierigen wirtschaftlichen Situation, in der die größten Industriestaaten selbst stecken.
Wer immer noch meint, die Welt hätte mit dem Tod von Osama Bin Laden an Sicherheit gewonnen, der werfe einen Blick nach dem Cannes des Nordens - nach Deauville, wo am Donnerstag die Führer der acht größten Industrienationen zusammentrafen, um unter französischem Vorsitz die Lage der Wirtschaft und der Weltpolitik zu erörtern: Flugabwehrraketen gegen allfällige Terrorattacken wurden in Stellung gebracht, der Hochsicherheitstrakt, in dem die Politiker der mächtigsten Demokratien über die Zukunft verhandeln, muss von 12.000 Polizisten bewacht werden.
Demonstriert werden darf nur außerhalb einer streng bewachten Sperrzone. So gesehen ist also alles beim Alten geblieben. Und auch wenn die Tagesordnung als Hauptpunkte der Tagung die "aktuellere“ Atomkraft und die Revolutionen im arabischen Raum ins Zentrum gestellt hat: Eigentlich geht es um noch Näherliegendes - Altbekanntes - Ungelöstes: die Schuldenkrise, in der sich die meisten jener Staaten befinden, die sich selbst zu den "Großen Acht“ zählen. Um die Dringlichkeit der Angelegenheit zu erkennen, bräuchten sie eigentlich bloß Nabelschau zu betreiben.
Dazu ein paar wenige Zahlen: Die USA haben in der vergangenen Woche ihre gesetzlich vereinbarte Höchstschuldenlatte gerissen: Die Gesamtsumme der US-Schulden liegt bei mehr als 14,29 Billionen Dollar, das sind immerhin 84 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Jene von G8-Vorsitzland und Gipfelgastgeber Frankreich liegt bei 81,7 Prozent des BIP - Tendenz stark steigend, jene von Japan bei 220 Prozent. Kanada reist mit Gesamtschulden von knapp 80 Prozent des BIP an, Deutschland bringt es auf 83 Prozent. Am schwersten in Schieflage ist allerdings Italien, dessen Gesamtstaatsverschuldung bei 119 Prozent liegt.
Im Zentrum des Interesses der Ökonomen steht nun nicht bloß der enorme jährliche Schuldendienst, der damit auf den Steuerzahlern lastet, sondern die Frage, wie lange das System so weiter laufen könne. Denn dass es bisher etwa im Falle Italiens nicht schon zu ähnlichen Finanzmarktreaktionen wie in Griechenland gekommen ist, hängt an einem einzigen - immer dünner werdenden - Faden: dem Vertrauen der Anleger auf den Anleihemärkten. Zwischen Stabilität und Desaster trennt die Finanzwelt also nichts weiter als ein Gefühl.
Wenn dieses Sentiment einmal bei einer G8-Nation kippt, dann könnte es zumindest sehr teuer werden für jene großen Staaten, die sich ebenfalls über dem 90 Prozent-Niveau bewegen. Denn wenn einmal die staatlichen Anleihetitel Italiens höhere Risikoaufschläge anziehen, dann könnte Frankreich als nächstes folgen.
Schon im Februar vergangenen Jahres warnte der Nobelpreisträger Robert Mundell davor, dass Italien "die größte Gefahr für den Euro“ sei und Griechenland dagegen ein "lokales Problem“.
Wenn die Stimmung kippt
Die Schieflage wird noch dadurch verstärkt, dass auch die kompetenten "Krisenfeuerwehren“, die sich die G8/G20 im ersten Schock des Wirtschaftseinbruchs verordnen wollten, immer noch relativ zahnlos sind. Der Internationale Währungsfonds, der derzeit ohne Führung dasteht, scheint für diese Funktion als politisch besetzter Interessenträger wenig geeignet, analysiert der Direktor der London School of Economics, Howard Davies. Er begründet sein Misstrauen unter anderem auf einem Report der Evaluierungsabteilung des IWF, welcher der eigenen Organisation vorwirft, Krisen nicht erkennen zu können. Davies Schlussfolgerung: Die Industriestaaten sollten dem im Vergleich zum IWF wesentlich unabhängigeren Expertengremium "Financial Stability Board“ wesentlich mehr entscheidende Kompetenzen zuordnen. Doch eine derartige Neuregulierung steht ebenso wenig auf der Tagesordnung wie die nur durch langfristige Sanierungsprogramme zu lösende Schuldenthematik. Vielleicht wird man sich aber schon im November den Folgen des griechischen Schulden-Desasters widmen müssen, das nach Ansicht des US-Ökonomen Nouriel Roubini "klar insolvent“ ist.
Deauville wird sich demgegenüber den scheinbar einfacheren Aktionen hingeben, etwa einem "Stabilitätspakt für die arabische Revolution“. Dieser besteht vornehmlich in der großzügigen Gewährung von Wirtschaftshilfe. Doch auch da liegt der Teufel im Detail. Denn die Verwirklichung der Grundforderungen, die sich von Tunesien bis Syrien ziehen, ist nicht leicht zu herzustellen: politische und wirtschaftliche Freiheit. Beides, so der libanesische Wirtschaftslehrer Saifedean Ammous lässt sich nicht einfach durch einen Wechsel an der Spitze der Staatsführung herstellen: Die arabische Wirtschaft sei, so Ammous "ökonomischer Totalitarismus“, über Generationen gewachsen und die gesamte Gesellschaft durchdringend. Mit Milliardenspritzen allein wird es also nicht getan sein.
Bleibt für die Abschlusserklärung von Deauville noch die "Sicherheitsallianz“, die Russlands Präsident Dimitri Medwedew eingebracht hat. Dieses Thema ist leichter zu fassen. Der Feind ist unsichtbar. Die Flugabwehrraketen von Deauville weisen also auch inhaltlich den Weg.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!