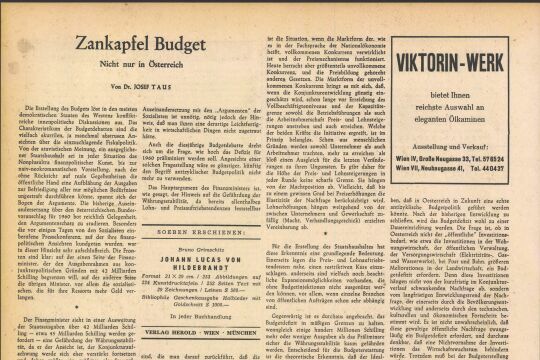Gut für Österreich, schlecht für Europa
GASTKOMMENTAR. Weder die Niedrigzinspolitik der EZB noch europapolitische Überhöhung kann auf Dauer die strukturellen Probleme der europäischen Einheitswährung übertünchen. Es ist Zeit, sich ernsthaft mit dem Austritt einzelner Länder aus dem Euro zu befassen.
GASTKOMMENTAR. Weder die Niedrigzinspolitik der EZB noch europapolitische Überhöhung kann auf Dauer die strukturellen Probleme der europäischen Einheitswährung übertünchen. Es ist Zeit, sich ernsthaft mit dem Austritt einzelner Länder aus dem Euro zu befassen.
Nicht einmal mehr begeisterte Anhänger des Euro halten ihn für einen Segen, sondern bestenfalls für einen notwendigen Schritt in Richtung eines gemeinsamen und einheitlichen Europas. Warum soll er dann ausgerechnet für Österreich gut sein?
Tatsächlich hat die österreichische Wirtschaftspolitik schon in der Zeit vor der Einführung des Euro eine harte Währung angestrebt. Für Stephan Koren als Nationalbankpräsident und Hannes Androsch als Finanzminister war es ein offen verfolgtes Ziel, den Schilling gegenüber der D-Mark stabil zu halten. Den Konsumenten brachte das stabile Preise, der Wirtschaft brachte das zunächst die Herausforderung, gegenüber der deutschen Industrie, aber auch gegenüber Ländern wettbewerbsfähig zu bleiben, die -wie etwa Italien -ihre Währung wiederholt abwerteten. Das war ein hartes Stück Arbeit, wurde aber erfolgreich bewältigt und hat zu unserem heutigen Wohlstand wesentlich beigetragen.
Logik des gemeinsamen Marktes
Allerdings war das noch vor der Jahrtausendwende, in einer Zeit noch geringerer internationaler Verflechtung und geringerer Wettbewerbsintensität als heute und nicht zuletzt bei geringerer Mobilität der internationalen Konzerne, was die Verlagerung von Arbeitsplätzen betrifft. Man kann sich vorstellen, wie heute die Situation bei einem wesentlich höheren Außenwert (sagen wir vereinfacht Preis) der österreichischen Währung wäre. Die Konkurrenz von Unternehmen außerhalb Österreichs wäre wesentlich härter.
Die österreichische Wirtschaft profitiert also recht kräftig von einer einheitlichen Währung in Europa. Noch deutlicher ist der Effekt in Deutschland, 2016 war der deutsche Leistungsbilanzüberschuss mit 261 Milliarden Euro der höchste aller Länder dieser Erde.
Aber auch von einem europäischen Standpunkt aus ist es nur logisch, einem einheitlichen Markt eine einheitliche Währung zu geben. In den Jahren vor der Euro-Einführung ist es gängige Praxis auch europäischer Staaten gewesen, fehlende Wettbewerbsfähigkeit durch Abwertung der eigenen Währung zu ersetzen. Sowohl der französische Franc als auch die italienische Lira sind gute Beispiele dafür. Und abgesehen von der höheren Unsicherheit, wenn jeder Staat einseitig die Tauschverhältnisse manipulieren kann: Kurzfristig verbessert man mit einer Abwertung die Chancen der eigenen Unternehmen im internationalen Wettbewerb, längerfristig zahlt den Preis dafür die Bevölkerung - über den sinkenden Wert ihrer Einkommen und ihrer Ersparnisse.
Es war die Logik eines einheitlichen Marktes und nicht nur die deutsche Bereitwilligkeit, für die Wiedervereinigung fast jeden Preis zu zahlen, sowie der französische Widerwille gegen eine zu starke D-Mark, aus der noch vor der Jahrtausendwende der Euro als künftige Gemeinschaftswährung geschaffen wurde.
Die meisten Ökonomen waren allerdings mit dieser Vorgangsweise nicht glücklich und haben in großer Zahl (in Deutschland allein mehr als 150!) gegen die Einführung einer Einheitswährung protestiert. Denn eines war Befürwortern und Gegnern gleichermaßen klar: Eine einheitliche Währung ist auf Dauer nur dann möglich, wenn auch die Wirtschaftspolitik der einzelnen Staaten gleiche Ziele (und mit gleichem Erfolg, muss man dazu sagen) verfolgt: die Unternehmen durch vernünftige Rahmenbedingungen wettbewerbsfähig zu erhalten, Investitionen zu fördern und die Budgetdefizite nicht ausufern zu lassen, um nur die wichtigsten zu nennen.
Nun ist aber genau diese Voraussetzung einer einheitlichen Wirtschaftspolitik bisher in keiner Weise erfüllt worden. Schafft ein Land aber weder ausreichende Reformen noch entsprechende Investitionen, um auch bei fixen Wechselkursen wettbewerbsfähig zu bleiben, dann sind die unausweichlichen Folgen geringeres Wachstum, der Verlust von Arbeitsplätzen sowie Verarmung zumindest des von den geringeren Beschäftigungsmöglichkeiten betroffenen Teils der Bevölkerung - und letztlich auch eine Verschlechterung des politischen Klimas. All das kann man eine Zeit lang durch höhere Budgetdefizite zudecken oder wenigstens hinausschieben, aber nicht auf Dauer. In Italien stagnieren die Einkommen breiter Schichten seit Langem, in Griechenland leiden unter den Einsparungen die Ärmsten am meisten, und dramatisch hohe Jugendarbeitslosigkeit gibt es hier wie dort.
Die europäische Politik hat in zweifacher Weise auf das Problem reagiert, und mit beiden Reaktionen kann man nicht glücklich sein. Das eine ist eine forcierte Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die ermöglicht es zwar, dass viele Staaten weiter Schulden machen und dabei die Last der hohen Staatsschulden als weniger drückend empfinden. EZB-Präsident Mario Draghi hat wiederholt beklagt, dass genau deshalb manche Länder von unpopulären aber bitter notwendigen Reformen Abstand nehmen. Das führt aber dazu, dass die EZB derzeit von der Niedrigzinspolitik auf Kosten der kleinen Sparer gar nicht abgehen kann, weil sonst die Belastung der hoch verschuldeten Länder sprunghaft steigt.
Teure Realitätsverweigerung
Die zweite Reaktion ist auch nicht besser: die Verschleierung der Probleme und der Rückzug aus einer Sachdebatte durch Emotionalisierung. Im März 2015, und das ausgerechnet zur Begründung weiterer Hilfe für Griechenland, hat Frau Merkel wörtlich erklärt:
"Der Euro ist weit mehr als eine Währung. Er ist [ ] der stärkste Ausdruck unseres Willens, die Völker Europas wirklich im Guten und Friedlichen zu vereinigen." Man kann Symbole so oder so wählen. Die alten Römer haben für ihre Legionen jedenfalls einen Adler als Feldzeichen gewählt und nicht einen Pleitegeier. Man bleibt an der Oberfläche, wenn man die bereits erkennbaren politischen Folgen einfach nur mit dem Pauschalbegriff des Rechtspopulismus abtut, ohne eine wichtige Ursache dieses Phänomens auch nur zu akzeptieren. Man sieht den rechten Splitter im Auge des Nächsten, aber nicht den ökonomischen Balken im eigenen Auge.
Es ist daher bitter notwendig, eine der Ursachen der Spannungen zu beseitigen. Und eine besonders ins Gewicht fallende Ursache ist nun einmal das Experiment des Euro. Zwar wäre es besser, in Ländern wie Italien oder Griechenland oder auch Frankreich durch weitreichende Reformen die Wirtschaft zu stärken und damit auch neue Arbeitsplätze zu schaffen. Aber wenn Plan A nicht geht (auch deshalb, weil über den Inhalt der vorzunehmenden Reformen keinerlei Einigung zu finden ist), muss man irgendwann Plan B in Angriff nehmen. Und der muss für einzelne Staaten nun einmal Austritt aus dem Euro heißen. Effekt eines Austritts wäre zunächst eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, allerdings um den Preis einer weiteren Erhöhung der Staatsschulden der Länder, die zu einer eigenen Währung zurückkehren. Im Falle Griechenlands bedeutete das vielleicht sogar den offiziellen Staatsbankrott. Aber rein technisch ist Griechenland ohnedies längst hoffnungslos überschuldet. Was derzeit in Sachen Hilfe für Griechenland betrieben wird, ist nichts anderes als eine immer wieder Milliarden kostende Realitätsverweigerung.
Günstige Konjunktur
Momentan herrscht in Europa Hochkonjunktur. Das lässt alle Probleme in freundlicherem Licht erscheinen. Aber keine Konjunktur dauert ewig. Und wir sind auf die Folgen ihres Endes nicht wirklich vorbereitet. Gerade die günstige Konjunktur gäbe aber für eine begrenzte Zeit Gelegenheit, eine solche Operation wie etwa einen Grexit leichter zu verkraften.
Derzeit versucht man, die Probleme durch interne Ausgleichsmechanismen zu lösen. Im Klartext heißt das, die Deutschen sollen zahlen -ob man das nun Bankenunion oder Sozialunion nennt. Ich persönlich meine, dass man die Kosten einer laufenden Verschiebung des Grundproblems unterschiedlicher Wettbewerbsfähigkeit massiv unterschätzt. Warum sollte man nicht stattdessen besonders betroffenen Ländern Gelegenheit geben, sich auf recht unvollkommene, aber praktisch durchsetzbare Art und Weise zu helfen, und das heißt nun einmal: durch die Möglichkeit von Abwertungen?
Retten wir Europa vor weiter zunehmenden Spannungen (und unsere österreichische Position als konkurrenzfähiger Exporteur): Behalten wir den Euro, aber lassen wir Länder aus dem Euro, die ihn einfach nicht verkraften.
Der Autor ist Gesellschafter einer Vermögensverwaltungsgesellschaft und als Publizist tätig |