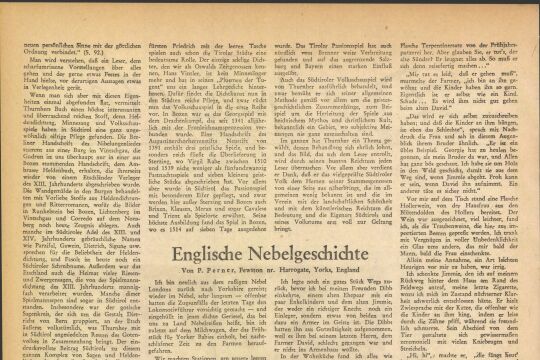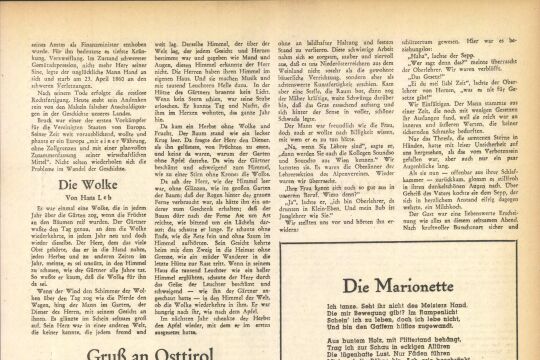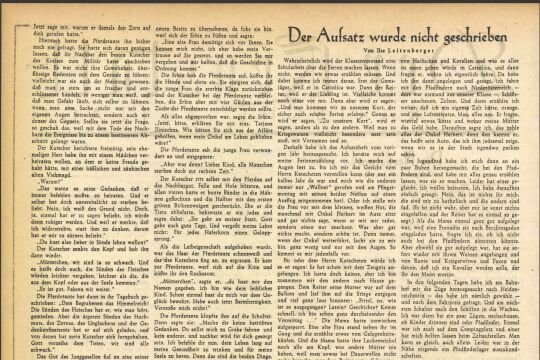Große Eltern
FOKUS
Helene: Die Frau, die meine Oma ist
Eine 90-jährige Frau als Quelle der Lebensweisheit: Helene ist genau das – und noch so viel mehr. Eine persönliche Geschichte über die Beziehung zur eigenen Großmutter, die eine klare Botschaft hat
Eine 90-jährige Frau als Quelle der Lebensweisheit: Helene ist genau das – und noch so viel mehr. Eine persönliche Geschichte über die Beziehung zur eigenen Großmutter, die eine klare Botschaft hat
Helene fragt mich immer nach dem Garten. Ich erzähle ihr davon, wie ich im Maulbeerbaum herumgeklettert bin. Ob sie weiß, wie Maulbeeren aussehen? „Sicher!“, sagt sie. Früher seien viele Straßen gesäumt gewesen mit Maulbeerbäumen, in ihrer Volksschulzeit während des Krieges habe ihre Klasse Blätter davon gesammelt und getrocknet. Was denn damit gemacht worden sei, frage ich verwundert. Helene vermutet, sie seien als Tee an die Front geschickt worden. Als ich eine Woche später wieder im Altersheim bin, funkeln ihre Augen: Sie habe nachgedacht. Die Blätter seien als Futter für Seidenraupen gesammelt worden, und die wiederum wurden für die Fallschirmproduktion gebraucht.
Sie hat sich wieder erholt. Sie erinnert sich. Ganz genau.
Helene ist meine Großmutter. Ich nenne sie in diesem Text bei ihrem Namen, damit sie als sie selbst erscheint und nicht immer den Oma-Mantel tragen muss, den sie wohl gerne trägt, der aber vielleicht verbirgt, was für eine großartige Frau sie ist, ganz für sich. Der eine Schneidezahn, der im Oberkiefer verblieben ist, unterstreicht das: Keck steht er da und verleiht ihrem Antlitz einen Hauch von Hexe. Hexen, wie sie wirklich waren – weise, alte Frauen nämlich, die sich auskannten im Leben. Und zupacken konnten
Die Wucht des Moments
Als Helene Ende Mai auf die Herzüberwachungsstation gebracht werden musste (gegen ihren Widerstand, wie meine Mutter erzählt, sie habe auf die Rollstuhllehnen gehämmert und geschrien, sie gehe nicht, sie gehe nicht), wollte ich ihr explizit sagen, dass ich viel von ihr gelernt habe. Sie war guter Dinge, hellwach und vollkommen bei sich, und als ich sagte: „Ich hab viel von dir. Nummer eins: die Schönheit!“, lachte sie laut und herzlich, die Hand am Plastikdreieck über dem Bett.
Kaum zurück vom Spital hieß es allerdings, sie habe Schwächeanfälle und Atemnot. Es lag eine Dringlichkeit in diesen Anrufen aus dem Heim, die alle von Helenes Kindern ins Burgenland kommen ließ, ihre Enkel, meine Cousins und Cousinen, die ich selten sehe.
Auch mich. Aus Wien angekommen, stellte ich das Auto ab und spürte die ersten Tränen kommen, auch Anflüge des surrealen Gefühls, das ich in den letzten Tagen meines Großvaters kennengelernt habe: die leichte Verschobenheit im Gleichgewicht, die hilflose Verwunderung angesichts des Ausgeliefertseins an das Leben auf dem Weg zu jemandem, von dem man sich für immer verabschieden muss. Die Wucht dieses Moments. Als ich ins Zimmer kam, sagte Helene mit schwacher Stimme, sie habe nach mir gerufen, zu Mittag: „Hilfe, Kathi, Hilfe, aber du hast mich nicht gehört.“
Sie hatte nichts gegessen. Seitlich am Bett hing der Beutel, in den der Katheter mündete. Wenn sie das Essen einstelle, hieß es, dann sterbe sie.
Sie hat immer gearbeitet. Sie war immer da. Ich erinnere mich an eine kalkbespritzte Helene, die das Esszimmer ausweißt, an Helene an der Kassa der Baustoffhandlung meines Vaters, an die Abende, als ich im Verzug mit einer Arbeit für den Werkunterricht war und in Helenes Gesellschaft im Akkord fünf Runden Häkelei auf einer riesigen Tischdecke anbrachte. Helene hat uns im Zug nach Italien begleitet, wo mein Bruder seine Hautkrankheit auskurieren sollte, und trieb auf einer Luftmatratze im seichten Wasser: Sie kann nicht schwimmen. Sie kann mit acht Jahren Volksschule auch kein Englisch und merkt sich fremde Wörter nur schlecht, meinen amerikanischen Freund nannte sie damals eher „Dead“ statt „Ted“.
Sie ist die weiseste Frau, die ich kenne.
Nach ihrem Anfall artikulierte Helene in seltener Vehemenz einen Wunsch: nicht allein gelassen zu werden, auch nachts nicht. Also wechselten wir einander ab. Wir hielten ihre Trinkflasche, richteten die Pölster, hielten ihre Hand und schlossen Freundschaft mit Frau S., der dementen Zimmergenossin. Besuch kam, auch das mittlerweile erwachsene Kind aus Albanien, das in den Neunzigerjahren über eine österreichische Hilfsorganisation im örtlichen Spital behandelt wurde.
Dem Helene die ersten deutschen Wörter beibrachte und dessen Vater sie beherbergt hat. Wenn mehr als zwei von uns da waren, wurde die kleine Terrasse mit dem Flecken Grün zum erweiterten Wohnzimmer, ab und zu klappte jemand den Laptop zum Arbeiten auf. Die angrenzende, dichte Hecke ist die meiner Eltern: Schon vor Jahren sind zwei Thujen dort verdorrt und haben in Vorbereitung der jetzigen Zeit eine Sichtschneise auf das Haus freigelegt, in dem wir so viel Zeit mit Helene verbracht haben. Jetzt war dieses Leben komprimiert: auf die kleine Terrasse, die Miniwiese, das halbe Zimmer. Auf, vielleicht, ein paar Tage.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!