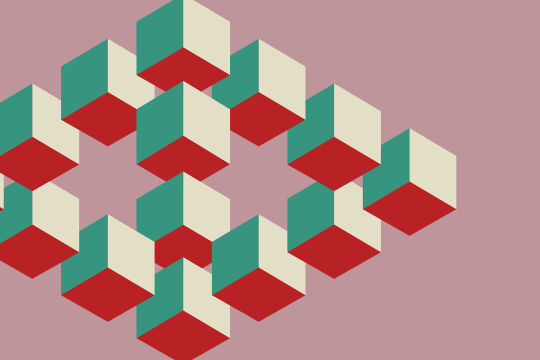Als Krankenschwester auf einer Hospizstation hat Romana Wasinger schon viele Menschen sterben gesehen. Doch den Tod ihrer eigenen Mutter hat sie kaum verwunden. Über die Schwierigkeit, selber loszulassen - und den Tod als natürlichsten Bestandteil des Lebens.
So einzigartig die Menschen sind, so individuell ist auch ihr Sterben. Da ist etwa Herr P., Mitte 50, ein vormals drahtiger Mann mit sonnengebräunter Haut und wilden Locken, der mit der Diagnose Krebs auf die Hospizstation gelangt. Fünf Wochen vor seinem Tod beginnt er jegliche Pflege vehement abzulehnen. Er will seine Ruhe haben, aber dabei nicht alleine sein; er will nichts mehr essen und nichts mehr sehen von der Welt, obwohl draußen im Garten gerade der Frühling seinen Einzug hält. Am Tag seines Todes wird er unruhig, bohrt panisch seine Fingernägel in den Arm von Romana Wasinger, die gerade für seine Pflege zuständig ist. Erst nach stundenlangem Kampf kommt er zur Ruhe und entspannt sich, bis er schließlich friedlich stirbt.
Oder da ist Frau S., 80 Jahre alt, eine sympathische, gebildete Frau, die an Lungenkrebs leidet. Sie ahnt, dass sie bald schon sterben wird - doch ihr Mann, der täglich Stunden an ihrem Bett verbringt, fleht sie an, ihn nicht zu verlassen. "Ich setzte mich also zu dem verzweifelten Ehemann und erklärte ihm, dass seine Frau ein Recht darauf hätte, zu sterben“, schreibt Wasinger in ihrem Buch "Leben im Sterben“, das erst kürzlich erschienen ist (siehe Buchtipp). Der Mann kann das anfangs nicht fassen und beginnt haltlos zu weinen. Doch etwas später setzt er sich an das Bett seiner Frau und sagt, dass er jetzt bereit sei, sie gehen zu lassen. Nur wenige Minuten später schließt Frau S. für immer ihre Augen.
Begleitung im Ausnahmezustand
Viele Menschen würden Szenen wie diese als unerträglich empfinden. Doch für Romana Wasinger sind sie prägender Teil ihres Traumberufs. "Die Betreuung von Sterbenden ist einfach mein Bereich, da gehöre ich hin“, sagt die 50-Jährige langsam und bedacht. Seit mittlerweile acht Jahren arbeitet sie als diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester in der kleinen, neun Betten umfassenden Hospizstation des Landespflegeheimes Wiener Neustadt. 90 Prozent der Menschen, die hierher kommen, haben Krebs im Endstadium; sehr viele blicken auf eine lange Leidensgeschichte zurück: auf Bestrahlungen, Chemotherapien, Operationen und Schmerzen. Wer auf der Hospizstation landet, gilt als "austherapiert“, als medizinisch hoffnungsloser Fall.
"Unsere Patienten sind aufgeklärt über ihre Situation, was aber nicht heißt, dass jeder das auch annehmen kann“, weiß Romana Wasinger. "Manche sagen gleich zu Beginn:, Ich weiß, dass ich eure Station nicht mehr verlassen werde.‘ Andere bekämpfen den Gedanken an den Tod bis zu ihrem letzten Atemzug. Wieder andere durchleben einen ständigen Wechsel zwischen Depression und Aggression.“ In diesem emotionalen Ausnahmezustand will sie Wasinger bestmöglich begleiten. Vor allem nachts, wenn es still wird, beginnen viele mit ihrem Schicksal zu hadern. "Das ist der Moment, wo sie mich fragen: Wie ist das denn mit dem Sterben?“ Standardantworten habe sie darauf keine. Sie könne nur zuhören und auf Wunsch einen Seelsorger vermitteln.
Trotzdem - oder gerade deswegen - seien Hospize keine von Schwermut geprägten Endstationen, erklärt Romana Wasinger. Sie seien Orte der Menschlichkeit, der Wärme und der Begegnung. Hier hätten die Patientinnen und Patienten - nebst aller pflegerischer Professionalität - endlich wieder jene Freiräume, die sie im Klinikalltag so schmerzlich vermissen würden. Und hier könne sie selbst - dank eines erhöhten Personalschlüssels - ihre Vorstellung von guter Pflege tatsächlich leben.
Geträumt hat sie davon schon als Kind. In die Tat umsetzen konnte sie diesen Traum freilich erst denkbar spät: nach einer abgebrochenen Koch- und Kellnerlehre, nach ihrer Ausbildung zur Verkäuferin und nach der Geburt ihrer zwei mittlerweile erwachsenen Kinder. 1986 beginnt sie sich beim Roten Kreuz zu engagieren, sieben Jahre später erfährt sie von der Caritas-Pflegeschule in Wiener Neustadt, wo sie eine zweijährige Ausbildung zur Altenfachbetreuerin und Pflegehelferin absolviert. Mit Begeisterung beginnt sie 1996 auf der geriatrischen Station des damaligen Landespflege- und Pensionistenheims Wiener Neustadt ihre Arbeit. Als der Neubau des Hauses in Aussicht steht, wird für sie freilich klar, wo sich ihr eigentlicher Bestimmungsort befindet: bei den Sterbenden. Kurz entschlossen beginnt sie die nötige Diplomausbildung; seit 2003 ist sie eine von elf diplomierten Schwestern auf der neuen Hospizstation.
Bisweilen gelangt freilich auch sie an ihre Grenzen. Vor allem der Tod ihrer eigenen Mutter, die im April 2006 plötzlich leblos im Bett lag und von der sie sich deshalb nicht verabschieden konnte, habe sie in eine tiefe Sinnkrise gestürzt. "Das war die größte Tragödie meines Lebens, obwohl ich so oft mit Sterben und Tod konfrontiert bin“, erzählt Wasinger. Am liebsten hätte sie damals gekündigt. Doch am Ende hätte das Gefühl überwogen, am richtigen Platz zu sein.
Anders als das Loslassen geliebter Menschen mache ihr der Gedanke an ihr eigenes Ende weniger Probleme. "Leben und Tod gibt es nur gemeinsam, das ist das natürlichste der Welt“, sagt sie bedacht. Überhaupt stelle sie sich das Sterben "irgendwie abenteuerlich“ vor: "Ich glaube, dass der Moment, in dem es passiert, etwas Schönes ist - wie Heimgehen ins Licht.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

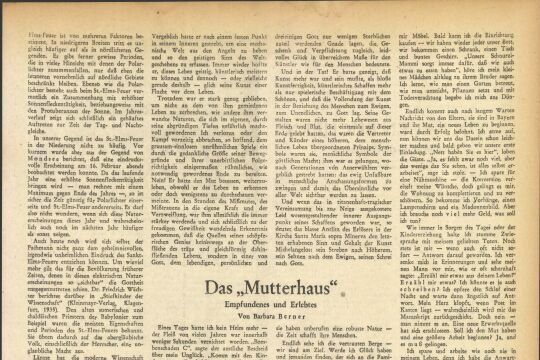


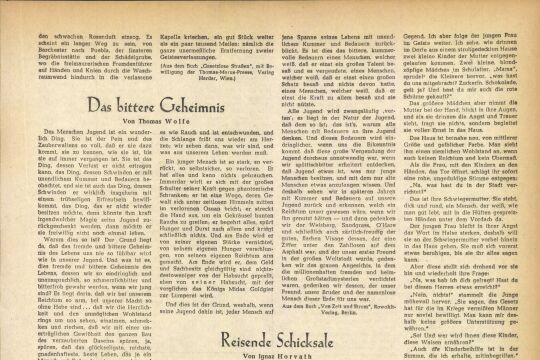















































































.jpg)