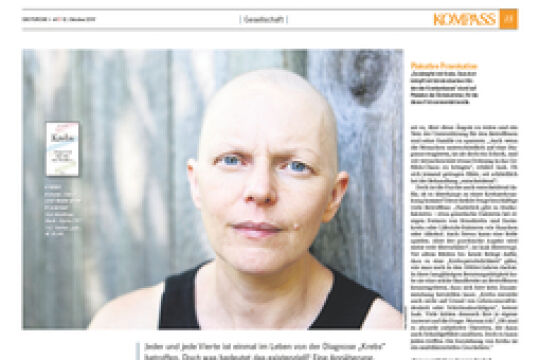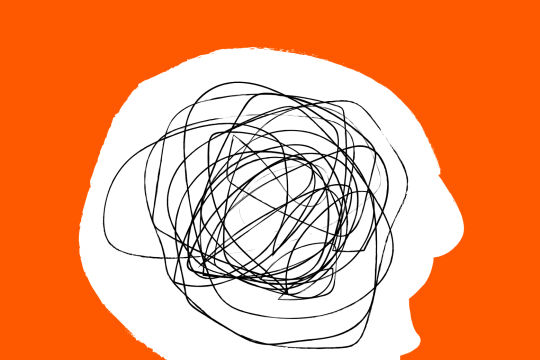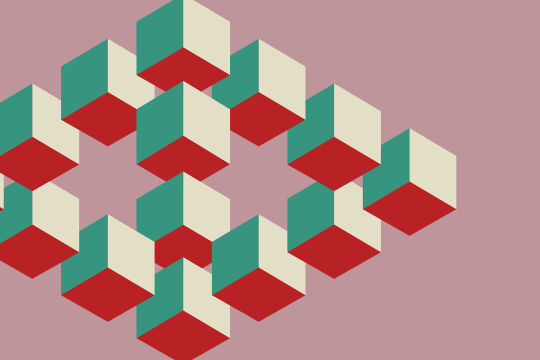Sonja Gobara verlor 1996 ihren Sohn. Er verstarb mit sieben Monaten. Gobara ist Kinderärztin und systemische Familientherapeutin, zudem Primaria im Ambulatorium „Sonnenschein“ in Niederösterreich und Mutter von zwei Kindern.
Die Furche: Frau Doktor, wie haben Sie damals, als Ihr Kind starb, die Betreuung erlebt?
Sonja Gobara: Mein Sohn verstarb an einer seltenen Krankheit und ich habe zusätzliche Kränkungen durch das medizinische Personal erfahren müssen. In der Folge habe ich viele Streitgespräche mit meinen Kollegen geführt. Es ist schwer, Mediziner zu erreichen. Sie sind im Umgang mit dem Tod oder unheilbaren Krankheiten oft selbst hilflos und überfordert. Die psychosoziale Begleitung der Eltern hat nicht den selben Stellenwert, wie wenn Mediziner heilend tätig sein können. Das wird immer noch nicht ausreichend in der Mediziner-Ausbildung aufgegriffen.
Die Furche: Was hat Ihnen geholfen, mit dieser unvorstellbaren Trauer fertig zu werden?
Gobara: Erstmals hat mir der Rückzug geholfen und viel Gehen. Ich habe aktiv eine Entscheidung getroffen, dass ich dieses Ereignis so gut als möglich in mein Leben integrieren möchte und Erfahrungen, die ich daraus gewonnen habe, an andere weitergeben möchte. Da war es hilfreich, dass ich auch Ärztin bin und weiß, wie wenig Raum für Trauer und Emotionen in den Spitälern vorhanden ist – für beide Seiten.
Die Furche: Außer einer verbesserten Aus- und Fortbildung von Fachpersonal, was müsste sich noch für betroffene Eltern verbessern?
Gobara: In Krankenhäusern gibt es für alles Qualitätsstandards, nur für den Umgang mit solchen Situationen nicht, dabei sind diese keine Ausnahmefälle. Es hat sich schon einiges im Bewusstsein von Fachpersonal geändert, aber vor allem Mediziner, meist männliche Kollegen, tun sich immer noch schwer mit diesem Thema. Die psychodynamischen Grundlagen dieser Situation sind vielen Medizinern immer noch zu wenig klar. Es gibt Missverständnisse, zum Beispiel, wenn eine Frau sagt, sie will ihr totes Kind nicht sehen, heißt das nicht, dass sie ihr Kind ablehnt, sondern nur die Situation. Hier braucht es Leitlinien. Wenn die psychosoziale Begleitung und Krisenintervention gut läuft, dann ist das Prävention: Folgeschäden können vermieden werden, etwa Depressionen, lange Krankenstände oder Erkrankungen der Geschwister.
Die Furche: Was ist derzeit das brennendste Problem?
Gobara: Es gibt immer mehr medizinisch indizierte Schwangerschaftsabbrüche. Hier überrollt uns eine Lawine. Viele Eltern, die die Diagnose erhalten, dass ihr Kind im Mutterleib wahrscheinlich oder sicher krank oder behindert ist, fühlen sich schlecht begleitet. Hier spüren wir sehr viel Not und Bedarf für Begleitung, sowohl bei Betroffenen als auch beim Fachpersonal. Ganz wenige Eltern haben den Mut, nach Alternativen zu suchen. Die Diagnose – behindertes Kind – bedeutet Abbruch. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein krankes Kind auszutragen, und sich dann von ihm zu verabschieden. (bog)