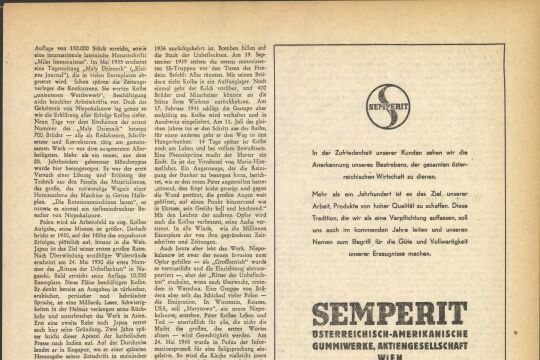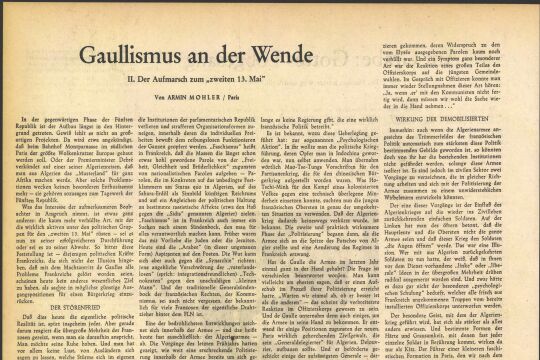Im Spiegel von Krieg und Frieden
Wie wird ein Mensch in bewaffneten Konflikten zum Killer? Die Geschichte zeigt: Erst wenn die Anderen genügend "fremd" gemacht werden, lässt sich "erfolgreich" töten.
Wie wird ein Mensch in bewaffneten Konflikten zum Killer? Die Geschichte zeigt: Erst wenn die Anderen genügend "fremd" gemacht werden, lässt sich "erfolgreich" töten.
Der amerikanische Militärpsychologe Dave Grossman sammelte für sein Buch "On Killing" Erfahrungsberichte von Soldaten über die grauenhaft intime Erfahrung des Tötens. Er bestätigte, was seit den bahnbrechenden Studien von S. L. A. Marshall während des Zweiten Weltkrieges nicht länger ignoriert werden konnte: Die meisten Menschen sind emotional und rational nicht bereit zu töten, nicht einmal zu ihrem eigenen Schutz -man kann es ihnen aber beibringen.
Seit Urzeiten bedienen sich unterschiedliche Kulturen unterschiedlicher Mittel, um dies zu erreichen. Kriegstänze und Trommelschlag, Drill und Feldmessen, Bootcamps und Exerzierübungen dienen dazu, Krieger in die geistige Verfassung zu versetzen, die nötig ist, damit sie ihr blutiges Handwerk ausüben können. Denn im Krieg geht es am Ende ums Töten -oder um dessen glaubhafte Androhung. Mittlerweile haben wir unsere Methoden verfeinert. Waren noch während des Zweiten Weltkrieges kaum 20 Prozent der Soldaten bereit, wirklich auf den Feind zu schießen, sind es heute aufgrund psychologisch fundierter Trainingsmethoden über 90 Prozent. Doch auch der Preis, den wir als Gesellschaft dafür bezahlen, ist gestiegen: Immer mehr Veteranen kehren als sogenannte "psychische Verluste" nach Hause zurück. Nur die beeindruckenden Fortschritte in der Behandlung seelischer Erkrankungen -mit pharmazeutischen und anderen Mitteln -helfen, dieses unblutige Massaker zu kaschieren.
Die wichtigste Voraussetzung, um den Einzelnen zum Killer zu machen, ist die Herstellung psychologischer Distanz zum Tötungsakt und zum Opfer. Wer im Feind sein "Alter Ego" - in den unverblümteren Worten eines Veteranen "einen anderen armen Scheißkerl" - erkennt, kann sich zur ultimativen Verneinung der Menschlichkeit nicht durchringen; kann nicht töten, besonders, wenn man dem Anderen dabei ins Gesicht sehen muss. Abstand - was wir zwischen Menschen auch "Fremdheit" nennen -ermöglicht erst Mord und Gewalt.
Macheten und Maschinengewehre
Doch gerade das stellte und stellt die Kriegstreiber und Feldherren vor die größte Herausforderung, denn historisch kämpfen meist Menschen gegeneinander, die sich ähnlich genug sind, sodass sie sich einig sind, worum es sich zu kämpfen lohnt. Die meisten gewaltsamen Auseinandersetzungen finden zwischen politischen Einheiten statt, die einander zum Verwechseln ähnlich sind: "Ich gegen meine Brüder, meine Brüder gegen unseren Cousins, wir und unsere Cousins gegen die anderen Clans in unserem Stamm, unser Stamm gegen die anderen Stämme, unser Volk gegen den Rest der Welt", beschreibt für die längste Zeit der Menschheitsgeschichte die Bruchlinien, entlang derer organisierte Gewalt - Blutrache, Fehde oder Krieg - stattzufinden pflegte.
Wo die Linie gezogen wird, auf deren einer Seite "wir" und auf deren anderer "die Anderen" stehen, wechselt dabei ständig und zufällig. Dementsprechend waren die meisten Kriege der Vergangenheit weniger tödlich, als man erwarten würde. Der Historiker G. B. Grundy verglich die Kämpfe zwischen den antiken griechischen Stadtstaaten mit Rugby. Was dann später die aus nächster Nähe feuernden Schützenlinien der Schießpulverzeit auszeichnete, war gerade ihr Mangel an Treffsicherheit. Mehr Menschen starben regelmäßig durch Kriegsfolgen - Hunger, Seuchen, Unfälle und Entbehrungen -als in der Schlacht. Überall, wo sich Ähnliche bekämpften, einigte man sich bald auf Regeln und Rituale, um die ohnehin schon durch die psychische Konstitution des Einzelnen stark beschränkte Tötungsgefahr noch zusätzlich einzuhegen. Olympischer Friede, Kriegerehre, Ritterlichkeit, Kriegsrecht, die Genfer Konvention, der Atomwaffensperrvertrag sind die jeweils zeitgemäßen Ausprägungen des universalen Menschheitsbedürfnisses, nicht töten zu müssen.
Fremdheit ermöglicht dort Gräuel und Gewalt, wo sie zufällig vorliegt oder es erfolgreich gelingt, sie kulturell herzustellen. Dort, wo durch die Wechselfälle der Geschichte ausreichend verschiedenartige Gesellschaften aufeinandertreffen, fallen die Schranken. In Kreuzzügen und Mongolenstürmen, bei der Conquista und in Kolonialkriegen sind nicht überlegene Waffen die Sieger, sondern der Sieg über die individuelle Empathie ermöglicht erst ihren ungehemmt tödlichen Einsatz. Der Genozid in Ruanda erinnert uns daran, dass es eigentlich keiner technischen Überlegenheit bedarf. Mit Macheten lässt sich ebenso erfolgreich töten wie mit Maschinengewehren: Es muss nur der "Nächste", von dem man sich meist nur in vernachlässigbaren Details unterscheidet, ausreichend "fremd" gemacht werden.
| Der Autor ist Historiker am Institut für Kultur-und Sozialanthropologie der Universität Wien |
Nähe und Abstand
Wenn man im "bösen Feind" letztlich nur sein "Alter Ego" erkennt, fällt es selbst in der Kriegssituation schwer, sich zum Töten durchzuringen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!