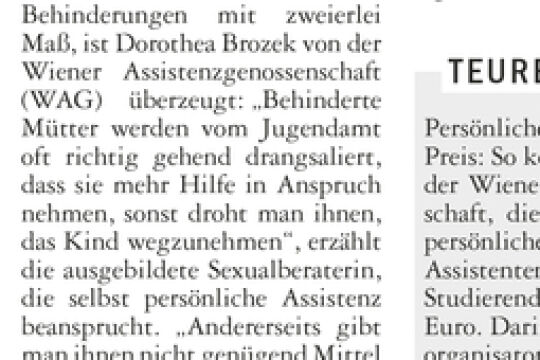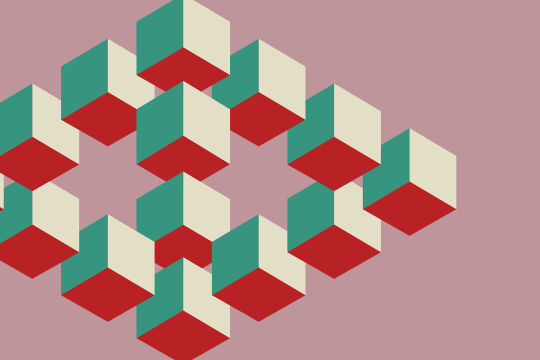Zwei Frauen erzählen über ihre schwere Entscheidung: Für oder gegen den Abbruch ihrer Schwangerschaft nach einem auffälligen pränatalen Befund.
Die junge Frau stellt eine Schachtel auf den Tisch, der Inhalt ist ihrem ersten Kind gewidmet. Sonja öffnet die Schachtel, sie hebt einen Strampler hervor, den das Kind tragen hätte sollen, sie blättert durch einen Stapel Papier und zeigt eine Geburtskarte: Darauf ein Foto; der Geburtstag, die Stunde der Geburt, das Gewicht wurden eingetragen. Doch das Kind auf dem Foto ist tot.
Es war vor über vier Jahren, als Sonja (Name von der Red. geändert) ihr erstes Kind fünf Monate vor dem errechneten Termin zur Welt brachte. Am letzten Tag einer langen Geburt hatte sie am Morgen aus dem Fenster in ein winterliches Grau geblickt, erzählt sie heute, da sei plötzlich die Sonne über den Dächern Wiens aufgegangen. "Ich habe mir gedacht, es müsste doch alles trüb sein." Ein Hoffnungszeichen nach den düsteren Wochen davor, als der Abschied von ihrem Wunschkind einsetzen musste. Das Ende fing in der 12. Schwangerschaftswoche mit einer auffälligen Nackenfalte an. Ist diese Falte im Nacken des Fötus verdickt, ist das Risiko eines Chromosomenschadens, wie etwa Trisomie 21, erhöht. Sonja wurde ans AKH überwiesen. Es wurde relativ rasch der Termin für eine Chorionzottenbiopsie zur Abklärung des auffälligen Befundes vereinbart, da diese Punktion der Plazenta nur bis zur einer bestimmten Schwangerschaftswoche durchgeführt werden kann. Doch dazu kam es nicht mehr. Sonja bekam starke Blutungen und dachte an eine Fehlgeburt. Doch das Kind lebte. Es war nur die Plazenta, die vor dem Muttermund lag. Es wurde ein Termin für eine Fruchtwasseruntersuchung, jedoch erst in der 16. Woche, angesetzt. Wenige Tage nach dieser Untersuchung mit Schnelltest kam die Diagnose: Trisomie 21; und es wird ein Bub. Das Paar hatte sich bereits über das Down-Syndrom informiert, es wollte das Kind.
Wenige Tage nach dieser Untersuchung gingen größere Mengen Fruchtwasser ab, wieder fürchtete Sonja, sie würde ihr Kind verlieren. Doch es lebte. Die Blase war im oberen Bereich gerissen, sie könnte sich wieder von selbst schließen, es lag eine Infektion bei der damals 24-Jährigen vor. Ist ihr Kind ein Kämpfer oder will ihr Körper nicht mehr? Sonja und ihr Mann rangen mit einer Entscheidung. Ein Abbruch war für Sonja bisher nicht in Frage gekommen. Doch die Situation verbesserte sich nicht: Bei einer weiteren Untersuchung wurde ein zweites Ödem am Körper des Ungeborenen entdeckt. Die Fruchtblase schloss sich nicht.
Das Unaussprechbare
Was nun? Sie fühlte sich gut beraten und betreut im AKH, niemals bedrängt oder unter Zeitdruck gesetzt, erzählt sie heute. "Wie kommen wir zu einer Entscheidung, wann wissen wir, dass wir uns richtig entschieden haben", fragte das Paar damals die Klinikpsychologin. Man spüre es, so die Antwort. Bis dahin hatte Sonja das Wort "Abbruch" nicht aussprechen können, ihr Mann hatte aber sachlich darüber reden wollen.
Nach Gesprächen mit der Psychologin kam das Paar zu einer Entscheidung: "Ich habe vom Kopf her schon länger gewusst, dass ein Abbruch in dieser Situation der einzige Weg ist, aber vom Herzen her ist es nicht gegangen. Das Loslassen ist so schwierig. Als der Entschluss feststand, hat sich der Nebel gelichtet. Es ist leichter geworden."
An einem Donnerstag im Jänner 2004 wurde die Geburt eingeleitet. Erst fünf Tage später wurde das Kind in der 20. Schwangerschaftswoche mit ca. 200 Gramm geboren. Die Eltern verabschiedeten sich von ihrem Kind. Ein Fußabdruck war nicht mehr möglich, das Gewebe war bereits weich, da das Kind schon seit Tagen tot war, es musste aufgrund der Wehen gestorben sein. Danach spürte sie auch Erleichterung, dass endlich alles vorbei ist, die Strapazen der letzten Wochen, das Ungewisse. Sie hat nie an der Richtigkeit der Entscheidung gezweifelt. Der Trauerprozess verlief für sie überraschend gut. "Ich habe mich schon vor dem Tod des Kindes mehrmals unbewusst von ihm verabschiedet."
Wenige Monate später wurde Sonja wieder schwanger, fast genau ein Jahr nach dem Tod ihres ersten Kindes lag sie wieder in den Wehen, diesmal schrie das Kind, als es geboren wurde. Sonja hat heute zwei Kinder. "Wenn ich Menschen mit Down-Syndrom sehe, ist das sehr schwer", sagt sie: "Man liest meist nur von jenen Fällen, wo das Kind sich gut entwickelt. Aber was ist mit jenen, wo dies nicht so ist und die Familie daran zerbricht? Es muss jeder für sich selbst eine Entscheidung treffen, es ist schwer genug." Ihr Kind wurde in einem Sammelgrab beigesetzt.
Vor fast 13 Jahren stand Petra (Name von der Red. geändert) vor einer ähnlich schweren Entscheidung. Sie erinnert sich an jene Untersuchung, als die damals 35-Jährige "vom siebtem Himmel einer bisher problemlosen Schwangerschaft in die tiefste Hölle stürzte". Der Arzt blickte auf den Ultraschallmonitor und sagte nichts mehr, kritzelte etwas Unlesbares auf den Überweisungsschein ins AKH. Petra entzifferte die Schrift: "Verdacht auf Hydrocephalus (Wasserkopf)." Heulend verließ sie den Arzt. "Das Furchtbare ist, dass nicht sofort jemand da ist, eine Krisenintervention für solche Fälle." Stattdessen hieß es: lange Warten. Nach der Untersuchung im AKH wurde ein schlechter Zustand des Fötus festgestellt. Petra war damals fast in der 20. Schwangerschaftswoche. Es wurde eine Plazentabiopsie gemacht, die Diagnose: Triploidie, also ein dreifacher Chromosomensatz. Wenn ein davon betroffener Fötus bis zur Geburt überlebt, würde es nur wenige Tage leben, so die Prognose. Nun stand Petra vor der Entscheidung: Entweder warten, bis das Kind von selber stirbt, oder einen Abbruch vornehmen. Im Nachhinein fiel die Entscheidung zu schnell. "Man ist in einem Schockzustand, der eine solche schwere Entscheidung nicht zulässt. Man sucht einen Anker, eine Vaterfigur, die einem sagt, was man tun sollte. Wenn er dir einen Rat gibt, ist es eigentlich falsch. Man muss selbst zu einer Entscheidung kommen."
Petra spürte die Hilflosigkeit um sich herum, es herrschte ein großes Schweigen. "Die Ärzte müssen einsehen, dass in solchen Fällen ihre Weisheit am Ende ist, dass hier eine andere Berufsgruppe gefragt ist, professionelle Berater und Beraterinnen." Auch Petras Mann bedauert die fehlende Zeit der Reflexion: "Man ist in einer Medizin-Maschinerie drinnen. Man bekommt das Gefühl, als müsse es rasch gehen." Petra fügt hinzu: "Die Betroffenen wollen auch eine rasche Entscheidung, weil dieser Zustand nicht auszuhalten ist." Das Paar entschloss sich für den Abbruch. Für Petra, eine Lehrerin, die sich für die Integration behinderter Kinder und für "Aktion Leben" stark gemacht hat, ein bisher kaum vorstellbarer Weg. Ein Kind mit Trisomie 21 hätte sie angenommen.
Während der Geburt fühlte sie sich schlecht betreut, sie hatte heftige Schmerzen. Plötzlich waren diese weg; es war kurz nach Mitternacht, als ihr Kind in der intakten Fruchtblase beim Gang aufs Klo in die Toilette fiel. Eine Schwester kam, nahm das tote Kind, schwieg und ging. Was danach mit dem Fötus, der im Wachstum stark zurückgeblieben war, passierte, weiß das Paar bis heute nicht.
Anschauungsobjekt?
Ihr Mann erzählt: "Ich hätte das Kind gerne gesehen. Ich habe die erste Zeit so viel an das Kind gedacht. Auch heute denke ich manchmal noch: wo ist es, ist es in einem Reagenzglas, für die Studenten ausgestellt, wurde es mit dem Spitalsmüll entsorgt?" Der pathologische Befund war der nächste Schock: es stand darin, dass äußerlich keine Auffälligkeiten zu sehen seien. Petra rief einen mit dem Fall betrauten Arzt an. "Er schüttete mich mit Informationen zu, dass alles so richtig sei. Sein Rat: Das nächste Mal kommen Sie früher zu uns."
Warten auf den Tod
Petra kann sich an alle Einzelheiten vor der Geburt des ersten Kindes erinnern, darauf folgt eine große Erinnerungslücke: die Zeit der Trauer. Sie wurde wenige Monate später wieder schwanger, es kamen Monate des Bangens. Diesmal mit glücklichem Ausgang: Das Paar hat heute zwei Söhne. "Ich bereue die Entscheidung nicht", sagt sie heute; "aber es bleibt ein kleines Gefühl, dass ich es anders machen hätte können, nämlich noch zu warten. Aber es wäre schon sehr schwierig auszuhalten gewesen, dass man ein Kind in sich trägt, das sterben wird. Sich ständig zu fragen: ist es schon tot oder stirbt es morgen?"
Erst 2002 wurde am AKH eine Psychologin eingestellt, die schwangere Frauen und deren Partner in Krisensituationen berät: Karin Tordy. Sie wird in Kürze aufgrund des großen Bedarfs von zwei Kolleginnen unterstützt werden. Zudem gibt es am AKH eine spezielle Station mit geschulten Mitarbeiterinnen für Schwangere, deren Schwangerschaft glücklos zu enden droht oder endet. Die Psychologin steht den Paaren bei Befundbesprechungen, Entscheidungsfindungen und bei möglichen Abbrüchen bei. Acht Wochen nach dem Abbruch werden die Paare zu einem Nachgespräch eingeladen und je nach Bedarf an niedergelassene Therapeutinnen oder Selbsthilfegruppen weiterverwiesen. "Es ist für die Frauen wichtig, ihre Geschichte an einem neuen Ort zu verarbeiten, nicht hier, wo sie alles an den Verlust des Kindes erinnert."
Edeltraud Voill, Psychologin und Leiterin der Familienberatungsstelle Nanaya, empfiehlt, dass bereits vor der Entscheidung an Beratungsstellen außerhalb des Krankenhauses verwiesen werden soll: neben Nanaya die "Aktion Leben" und das Hebammenzentrum. Das Angebot werde aber zu wenig genützt. "Nach dem Befund befinden sich Frauen bzw. Paare in einem Schockzustand und sind nicht entscheidungsfähig. In Krankenhäusern wird den Betroffenen oft zu wenig Zeit eingeräumt."
Tipp: Durchgecheckt. Tagung des Netzwerkes "prenet - für die kritische Auseinandersetzung mit Pränataldiagnostik" am 25. und 26. April in St. Pölten.
Informationen: www.prenet.at