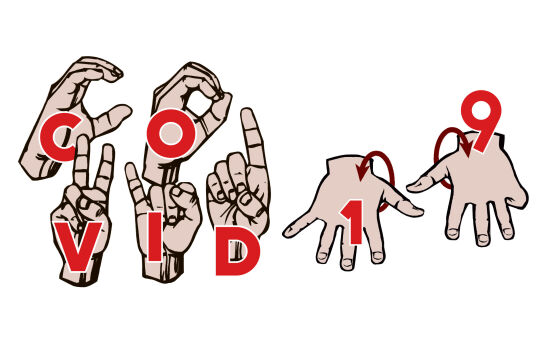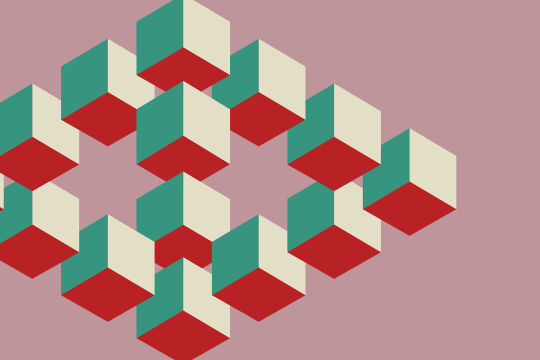Kinder mit Behinderung: Kämpfen, hadern, hoffen
Georg hat das Leben seiner Eltern und seiner vier Geschwister radikal verändert. Über eine besondere Familie - und ihr Ringen um Fairness und Zukunft.
Georg hat das Leben seiner Eltern und seiner vier Geschwister radikal verändert. Über eine besondere Familie - und ihr Ringen um Fairness und Zukunft.
Man könnte diese Geschichte mit Defiziten beginnen. Man könnte all das erwähnen, was Georg im Vergleich zu anderen Achtjährigen nicht vermag. Und es wäre eine lange Liste, denn er kann weder gehen noch alleine sitzen, weder alleine essen noch trinken, er kann nicht gut schlucken oder greifen und muss gewickelt werden. Dazu kommen epileptische Anfälle: Sein Bewusstsein schwindet, die Atmung wird flach, die verträumten blauen Augen werden starr und leer. Auch kognitiv ist der Bub beeinträchtigt. Wie sehr, ist wegen seiner begrenzten Ausdrucksfähigkeit nur zu erahnen.

Liebe Leserin, lieber Leser
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Man könnte Georgs Zustand aber auch ganz anders sehen. Man könnte sich vor Augen führen, was er schon alles schaffen konnte - entgegen vieler Prognosen. Er kann einige Meter am Boden kriechen und sich auf ein Ziel hinrollen; er kann große Tasten bedienen, über ein iPad wischen und mit dem linken Mittelfinger tippen. Anders als Kinder mit ähnlich schwerer Behinderung wird er auch nicht über eine Magensonde ernährt, sondern kann über den Mund gefüttert werden. Auch seine Körperhaltung ist besser: Weder hat er eine verkrümmte Wirbelsäule noch verkürzte Muskeln. Und auch mitteilen kann er sich. Aus etwa 30 Wörtern und deren Kombinationen spannt Georg seinen eigenen Kosmos auf: Mama, Papa, Auto, Schnecke, Haube, aua, heim.
Dass der Bub all das kann, ist ein großes Glück - und hart erkämpft: Mutter Anna, die wie alle Personen in dieser Geschichte eigentlich anders heißt, hat als ausgebildete Intensivkrankenschwester ihren Sohn von Anfang an gefördert; und Vater Wolfgang verdient immerhin so viel, dass er mit Hilfe von Krediten all das anschaffen und herrichten konnte, was eine siebenköpfige Familie mit speziellen Bedürfnissen braucht. Trotzdem ist die Großfamilie aus dem Bundesland Salzburg in den letzten acht Jahren oft an ihre Grenzen gelangt. Und nicht immer waren ihnen die Behörden eine Hilfe.
"Ich muss wissen, wie es weitergeht"
Es ist im Jahr 2010, als Georg geboren wird, das fünfte Kind, ein "Unfall", mit dem niemand mehr gerechnet hat. Eigentlich hat Anna schon wieder gearbeitet, doch die überraschende Schwangerschaft bringt alles durcheinander. In der 26. Woche hat sie einen Blasensprung, vier Wochen später kommt das Baby zur Welt, viel zu früh. Anna weiß, dass es in solchen Fällen zu Schädigungen kommen kann, deshalb drängt sie auf eine Kernspintomographie. "Wenn ich fünf Kinder habe, muss ich ja wissen, wie es weitergeht und wie wir uns organisieren müssen", erzählt sie. Gemeinsam mit einer Ärztin betrachtet die Mutter die Bilder des Gehirns - es sieht aus wie Emmentalerkäse. "Infantile Zerebralparese", lautet der Befund, eine frühkindliche Hirnschädigung, ausgelöst vermutlich durch einen pränatalen Infekt. Bei viel Glück sei es eine Paraparese, die nur die untere Körperhälfte betrifft, erklärt ihre Ärztin; bei weniger Glück handle es sich freilich um eine Tetraparese, die alle vier Gliedmaßen sowie den Rumpf umfasst.
Anna weiß, was das in der Praxis bedeutet: Spastiken, Sprechprobleme, Schluckprobleme und vieles mehr. Sie ist im Schockzustand, psychologisch aufgefangen wird sie nicht. Daheim spricht sie mit ihrem Mann, später erzählt man es den Eltern und Schwiegereltern. Sie solle nicht so schwarzmalen, heißt es dort, am Kind sei doch nichts Auffälliges zu sehen. Ein Spitalsarzt versucht sie später mit einem Beispiel zu trösten: "Wir haben Kinder gehabt, denen hat das halbe Hirn gefehlt, und nach vier Jahren sind sie fröhlich bei uns hereinspaziert."
Doch bei Georg scheint es anders zu kommen. Das fürchtet auch die private Zusatzversicherung der Familie. Während bei allen anderen Kindern binnen sechs Wochen eine private Unfallversicherung gewährt wird, lehnt man dies bei Georg ab. Für Anna eine Diskriminierung - und ein Beleg dafür, dass intern medizinische Daten weitergegeben wurden. Bald verdichtet sich auch der Verdacht einer Tetraparese. Als Georg sechs Monate alt ist, treten die ersten Muskelverkrampfungen auf. Eine Physiotherapeutin am LKH Salzburg rät Anna zur Vojta-Therapie, einer vom tschechischen Neurologen Václav Vojta in den 1960er-Jahren entwickelten Behandlungsmethode, bei der geschädigte Bereiche im Zentralnervensystem neu "gebahnt" werden sollen.
Gemeinsam mit einer Ärztin betrachtet Georgs Mutter die Bilder vom Gehirn ihres Sohnes – es sieht aus wie Emmentalerkäse. Sie ist im Schock, psychologisch aufgefangen wird sie nicht.
Die Krankenkasse zahlt die Therapie, doch die Behandlung ist herausfordernd, weil die Babys dabei oft herzzerreißend weinen. Anna fühlt sich dennoch stark genug, sie hat das Gefühl, endlich ein Werkzeug in der Hand zu haben, etwas tun zu können. In einer Spezialklinik in München lässt sie sich schulen, um ihren Sohn selbst fördern zu können, auch weil ihr als fünffache Mutter schlicht die Zeit für tägliche Therapiefahrten mit Georg fehlt. In München trifft sie erstmals auch andere Familien. "Wenn du diese Kinder siehst, fängst du wieder zu hoffen an: Vielleicht kann er irgendwann seine Hände benutzen. Du feilschst und haderst die ganze Zeit", sagt sie.
Vier Mal täglich machen Anna und ihr Sohn gemeinsam Therapie. Um es für alle erträglicher zu machen, beginnt sie dabei zu singen. Und tatsächlich geht die Muskelanspannung zurück. Auch die anderen Geschwister holt sie herein in dieses Ritual und sie beginnen, diese Zeit der Innigkeit zu genießen. "Ich habe den anderen Kindern von Anfang an gesagt, dass der Georg anders sein wird, dass sie einen besonderen Bruder haben", erzählt Anna. Manchmal berichten die Geschwister neugierigen Passanten voll Stolz, was er gerade eben gelernt hat, dann wieder erfüllt sie große Traurigkeit. Auch die Eltern durchleben trotz aller Stärke Phasen von Dunkelheit und Trauer. "Wir sind keine tiefreligiösen Menschen", sagt Anna, "aber wir hatten doch von Anfang an auch das Gefühl, der Georg gehört zu uns."
Als der Bub zwei Jahre alt ist, heiraten seine Eltern kirchlich. Während viele Beziehungen an der Belastung zerbrechen, die ein Kind mit Behinderung oder chronischer Erkrankung mit sich bringt, schweißt sie das Durchlebte noch mehr zusammen. "Es ist ein immenser Grenzgang", ist ihnen bewusst, "aber wir merken zum Glück, wenn es für den anderen brenzlig wird, und dann versuchen wir das zu kompensieren."
Austausch in Geschwistergruppen
Um die Eltern zu entlasten und auch Auszeiten mit anderen Geschwistern möglich zu machen, passt eine befreundete Krankenschwester stundenweise auf den Buben auf. Bezahlen muss das die Familie selbst, die Hauskrankenpflege ist keine Option, weil sie nur von 8 bis 18 Uhr angeboten wird und Georg eine fixe Bezugsperson braucht. Sein Gesundheitszustand spitzt sich freilich immer mehr zu: Er hat epileptische Anfälle; manche sind so hartnäckig, dass der Notarzt-Hubschrauber kommen muss. Die Familie und vor allem die Geschwister erleben das als traumatisch. Das Paar organisiert psychologische Beratung und schickt die Kinder in Geschwistergruppen. Dort sollen sie im Austausch mit ebenso Betroffenen nicht nur ihren gut verräumten Zorn auf den "besonderen" Bruder ausdrücken können, sondern auch auf ihre Eltern, die sie im Alltag tendenziell schonen.
So gut sich die Familie intern organisiert, so undurchschaubar werden draußen die Behörden. Es beginnt schon mit dem Pflegebedarf: Georg wird Pflegestufe 7 zugeschrieben, 1688,90 Euro Pflegegeld erhält er monatlich bis zum 17. Lebensjahr. Das ist erfreulich, doch warum müssen sich Familien mit ähnlichen Kindern alle zwei Jahre neu einstufen lassen? "Hier gibt es überhaupt kein einheitliches Schema", sagt Anna. "Es kommt oft nur darauf an, wie sich die Eltern gegenüber den Behörden verkaufen."
Reichlich verworren erscheint ihnen auch die Zuschuss-Politik zu Hilfsmitteln. Als sie für Georg einen Reha-Buggy um 5000 Euro brauchen, müssen sie zuerst bei der Krankenkasse einreichen; erst danach dürfen sie bei der Landes-Behindertenhilfe anfragen - und erst dann den dringend benötigten Buggy erwerben. Ein halbes Jahr vergeht, bis die Familie ihn zu Hause hat, die Hälfte der Kosten muss sie selber tragen. Die Behörde nennt das "Subsidiarität". "Diese Kostenbeitragsregelung ist nicht ganz so einfach zu verstehen", gesteht Renate Kinzl-Wallner, Leiterin des Referats für Behinderung und Inklusion des Landes Salzburg. "Aber weil es um öffentliche Mittel geht, müssen wir eben prüfen, was notwendig ist und was nicht."
"Player tricksen sich gegenseitig aus"
Auch Georgs Mutter schätzt Sparsamkeit. Sie hätte nichts dagegen, leihweise etwas Gebrauchtes aus dem Hilfsmittelpool zu erhalten, den die Gebietskrankenkasse mit den Sanitätshäusern eingerichtet hat. Doch bis heute hat sie daraus nie etwas bekommen, sondern nur neue Ware. Speziell Kinderrollstühle würden eben nie genau passen, meint dazu die Salzburger Gebietskrankenkasse.
"Die Player tricksen sich gegenseitig aus", glauben hingegen Georgs Eltern. Und auch sie selbst fühlen sich manchmal ausgetrickst - oder zumindest schlecht informiert: Als sie Georg in einen sonderpädagogischen Kindergarten mit Kleingruppen geben, wird ein Teil des Pflegegeldes abgezogen. Später, als er in einen integrativen Kindergarten wechselt, wo er für 18 Stunden pro Woche eine 1:1-Betreuung durch eine Pflegehelferin erhält, kostet es nichts. Hingewiesen darauf hat sie niemand.
Vollends vor den Kopf gestoßen sind Georgs Eltern, als teure Umbauarbeiten im Haus nötig werden: Das Bad muss vergrößert und alles mit einem Deckenlifter ausgestattet werden, weil der immer schwerere Körper irgendwann nicht mehr aus der Badewanne gehoben werden kann. Auch ein Autolifter muss her, und zudem ein Lift von der Garage hinauf zur Eingangstür. "Wir haben Adaptierungen vorgenommen, die auch dann noch passen, wenn Georg erwachsen ist", erklären seine Eltern. Weit über 50.000 Euro haben sie investiert und auch Kredite aufgenommen. Doch die Unterstützungsstelle für Kriegsopfer und Menschen mit Behinderungen des Landes Salzburg (vormals SALKOF), die Zuschüsse für behindertengerechte Adaptierungen von Wohnraum bietet, zahlt nur 2000 Euro. Für Vater Wolfgang ein Hohn. "Ich habe gebeten, dass einmal jemand kommt und sich die Gesamtsituation anschaut. Aber ohne Erfolg."
Ob Land oder private Initiativen: Oft habe es den Anschein, primäres oder einziges Entscheidungskriterium sei das Einkommen, klagt Wolfgang. Er dagegen würde sich eine ganzheitliche Herangehensweise wünschen, bei der - durch Ombudspersonen oder Case-Manager - der Therapiebedarf, die Hilfsmittel sowie die erforderlichen baulichen Maßnahmen mit den vorhandenen Finanzierungsmitteln abgewogen werden und ein mehrjähriger Stufenplan erstellt wird. "Das wäre für viele betroffene Familie hilfreicher", ist er überzeugt. "Einzelaktivitäten sind nicht immer ideal und in der Summe für die Förderstellen auch kostspieliger."
Er und seine Frau hätten ihre - zu einem Großteil selbst finanzierten - Anschaffungen jedenfalls sorgsam ausgewählt: die Therapieliege etwa, auf der Georg kreuzschonend umgezogen und gewickelt werden kann; den mitwachsenden Therapiestuhl für den Tisch, der langfristig billiger kommt als das unflexible Teil, das die Krankenkassa zahlt; und die speziellen Unterschenkelorthesen, die letztens notwendig wurden. Weil die verspannten Muskeln den Hüftkopf aus der -pfanne gezogen haben, musste Georg Ende Mai operiert werden - deutlich später als Kinder ohne Vojta-Therapie, aber am Ende doch. Zwei Wochen lag er mit abgespreizten Beinen im Spital, dann weitere vier Wochen daheim. Auch eine Reha folgte. Anfang Jänner ist die nächste Seite dran.
Selbstbestimmung als großes Ziel
Manche Eltern ersparen sich diese Operationen und lassen die Hüftluxation, wie sie ist: Das Kind würde ja doch nie stehen können. Doch für Anna und Wolfgang kommt das nicht in Frage. Sie haben ein großes Ziel für ihr besonderes Kind, das demnächst in die zweite Klasse der Körperbehindertenschule der Stadt Salzburg kommt und täglich mit dem Bus hin- und herchauffiert wird: Das Ziel heißt Selbstbestimmung. Wenn er mit 17 oder 18 Jahren die Schule verlässt, soll Georg selbst entscheiden können, wo er wohnt und wer ihn pflegt. Technische Innovationen wie computergestützte Kommunikation oder Robotechnik könnten seine Autonomie noch deutlich erhöhen, hofft seine Mutter. Vielleicht wird er dank eines Exoskeletts sogar einmal laufen können! Doch dazu brauche er eben Gelenke und Muskeln, die funktionieren.
Dass er noch vier Geschwister hat, beruhigt die Eltern einstweilen. "Sie werden ihn nicht pflegen, aber sie werden eine wichtige Stützfunktion für sein Leben haben", meint Georgs Mutter. Zur Not könnten sie ihn auch in einer privaten Einrichtung unterbringen, falls die staatlichen nicht funktionieren. Man hat ja seine Erfahrung mit den Behörden.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf mehr als 175.000 Artikel seit 1945 – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf mehr als 175.000 Artikel seit 1945 – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!





























































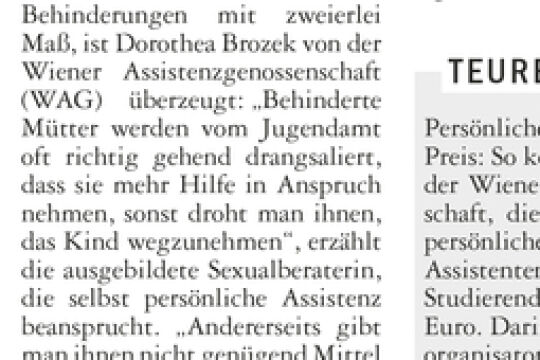

















.jpg)