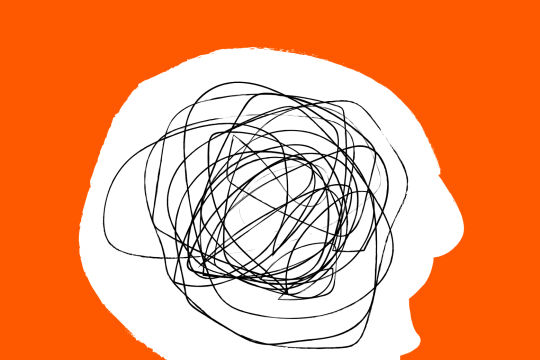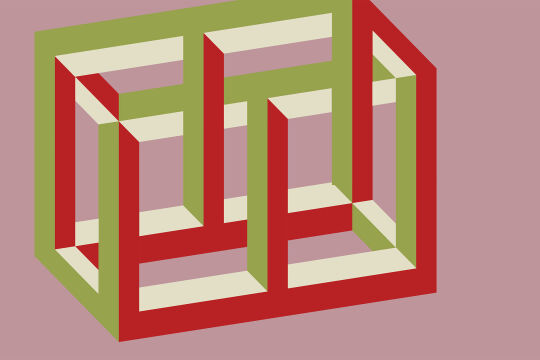Kinderpsyche und Corona: Vom Gefühl, eine Gefahr zu sein
Die Zahl psychisch erkrankter Kindern hat sich während der Pandemie vervielfacht. Längst werden nur noch Akutfälle stationär aufgenommen. Über einen medizinpolitischen Irrtum, der vor Corona seinen Lauf nahm.
Die Zahl psychisch erkrankter Kindern hat sich während der Pandemie vervielfacht. Längst werden nur noch Akutfälle stationär aufgenommen. Über einen medizinpolitischen Irrtum, der vor Corona seinen Lauf nahm.
"Ich bleibe jetzt zu Hause, damit ich meine Oma noch lange habe!“ Das ist jener Satz aus einer Corona-Schutzkampagne, den Katrin Skala, Kinder- und Jugendpsychiaterin im Wiener AKH, der Regierung bzw. dessen zuständigem PR-Management nie verzeihen wird. Diese Worte, so Skala, ließen tief blicken, wie es um das Empathievermögen oder – besser gesagt – Nicht-Vermögen der Entscheidungsträger im Land bestellt sei. Die Ärztin berichtet von Kindern, die sich für den Tod eines Großelternteils verantwortlich fühlen, weil sie diesen zuvor umarmt oder berührt hatten. Ganz gleich, ob nun jemand mit Corona infiziert war oder nicht.
„Kindern wurde das Gefühl vermittelt, ihre physische Präsenz allein könne über Leben und Sterben entscheiden.“ Es waren kollektive Unterstellungen wie diese, die viele Heranwachsende in den vergangenen zwei Jahren psychisch krank gemacht hätten. Die Liste der Diagnosen ist lang: Angefangen bei Angsterkrankungen, psychosomatischen Beschwerden über Depressionen bis hin zu Kindern, die nicht mehr aus dem Haus gehen wollen, um für andere keine Gefahr darzustellen. Ganz besonders hebt Skala den massiven Anstieg von Essstörungen hervor.
Personalmangel und lange Wartezeiten
Professor Paul Plener, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie, bezeichnet indes die in seiner Station vorstelligen Patientinnen und Patienten als „die Spitze des Eisbergs“. Betreut werden könnten de facto nur jene, die akute oder stationäre Versorgung brauchen, am schwersten betroffen sind – also allen voran Kinder, die sich das Leben nehmen wollen oder es bereits versucht haben und daher überwacht werden müssen. Hinzu kämen Patient(inn)en mit Bulimie oder Magersucht, die so stark abgemagert sind, dass sie ohne medizinische Versorgung keine Überlebenschance mehr haben.
„Das wahre Ausmaß an Erkrankungen sehen daher die Kollegen im niedergelassenen Bereich“, sagt Plener. Für sie gilt es, jene Erkrankten zu versorgen, die im Grunde ebenfalls eine stationäre Versorgung bräuchten, aber aufgrund des österreichweiten Engpasses kein Bett erhalten bzw. lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Die Situation könnte sich zumindest in Wien noch dramatischer gestalten: So hatten im Februar die Ärztinnen und Ärzte der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Klinik Hietzing eine sogenannte Gefährdungsanzeige abgesetzt. Aufgrund chronischen Personalmangels sehen die Mediziner die Versorgung der Jüngsten in Gefahr. Im Gespräch ist jetzt die Schließung der Station am Wochenende, was die Verlegung der jeweiligen Patienten in andere Häuser einschließt. Selbstredend, dass sich diese Regelung für die betroffenen Kinder kontraproduktiv auswirken würde.
Das Thema Personalmangel ist auch der Grund, warum in der Klinik Floridsdorf die 24 Betten, die für psychisch kranke Kinder- und Jugendliche vorgesehen sind, nicht belegt werden können.
Patienten mit Essstörungen sind so stark abgemagert, dass sie außerhalb des Spitals keine Überlebenschance hätten.
Bereits vor der Pandemie war es in der österreichischen Gesundheitsbranche ein offenes Geheimnis, dass der Bereich der Kinderund Jugendpsychiatrie chronisch unterfinanziert ist und es an ausreichend qualifiziertem Personal mangelt. Corona hat das Problem potenziert: Im April 2021 warnten Experten davor, dass das System kollabieren würde, da sich die Erkrankungen vervielfacht hatten. Als Ursache identifizierten sie die Corona-Begleitmaßnahmen, die sich mehr und mehr auf das Befinden von Heranwachsenden auswirkten. Schon damals zeigte man sich beunruhigt ob der Dimension der Symptomatiken. Immer mehr Fachärzte berichteten von Patienten, die von Anfang an medikamentöse Unterstützung gebraucht hatten und die, im Gegensatz zu Vor-Pandemiezeiten, mit einer alternativen Therapie (Gesprächstherapie, Maltherapie) allein keine Linderung erfahren konnten.
Gerade bei Jugendlichen dürfte die lange Isolation, das Wegfallen sozialer Kontakte oder das Schließen der Gastronomie die entscheidende Rolle gespielt haben. Nicht zuletzt wurde dadurch das natürlich Bedürfnis von Teenagern, sich von der Familie ein Stück weit zu distanzieren, sich in der gleichaltrigen Gruppe zu etablieren und neue Kontaktversuche zu starten, torpediert. Jüngere und Kleinkinder hätten wiederum auf offensichtliche Ungerechtigkeiten innerhalb der allgemeinen Maßnahmen reagiert.
Un-Gerechtigkeitssinn
„Die Kleinen haben ein Sensorium für Widersprüche, logische Brüche, Unehrlichkeit. Etwa die Tatsache, dass anfangs sämtliche Schulen geschlossen wurden und der Handel offen blieb – ein Kind spürt, wenn etwas nicht zusammenpasst. Oder die Maskenpflicht, die an Schulen als alternativlos verhandelt wurde bzw. wird, während für die Eltern am Arbeitsplatz oft weniger strenge Vorschriften galten – auch das ist eine Ungerechtigkeit, die einem Kind auffällt“, gibt Fachärztin Katrin Skala zu bedenken.
Die Alarmstimmung der Kinder- und Jugendpsychiater lässt sich längst durch Zahlen belegen: Die Tirol Kliniken verzeichnen seit Beginn der Pandemie einen 30-prozentigen Anstieg an Aufnahmen mit Selbstverletzung, Depression und Ängsten bei der Gruppe der Drei- bis Zwölfjährigen. Und eine Studie der Donau-Uni Krems und der Medizin-Uni Wien zeigte auf, dass mittlerweile 56 Prozent aller Schülerinnen und Schüler (3000 Befragte) eine depressive Symptomatik aufweisen. Rund die Hälfte gab zudem an, unter Angstattacken zu leiden. Die Häufigkeit dieser Beschwerden hat sich, wie auch jene von Schlafstörungen, laut der Forschergruppen verfünf- bis verzehnfacht. Dem nicht genug: Rund 16 Prozent der Befragten hatten angegeben, regelmäßig Selbstmordgedanken zu haben: Auch das ist ein deutlicher Anstieg.
Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, die prekäre Situation nur auf die Pandemie zurückzuführen. Der UN-Kinderrechtsausschuss zeigte sich in seinem jüngsten Staatenprüfprozess vom März 2020 – schon vor der Corona-Krise – besorgt über die Häufigkeit von psychischen Erkrankungen und Störungsbildern bei Kindern und Jugendlichen in Österreich.
Der UN-Kinderrechtsausschuss zeigte sich bereits vor der Pandemie besorgt über die Häufigkeit von psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Österreich.
Kinderpsychiater Paul Plener sieht etwa die Tatsache, dass sein Fachgebiet in Österreich erst seit 2007 eine eigene Disziplin ist, als eine der Ursachen für die Missstände. „Das hat zur Folge, dass nur eine überschaubare Gruppe an Personen die Fachexpertise hat. Die Ärzteausbildungsordnung sieht hierzulande einen 1:1-Schlüssel in der Assistenten-Ausbildung vor, – was einzigartig in Europa ist. Dementsprechend schwer ist es, zeitnah quantitativ und qualitativ ausreichend Personal auszubilden.“
Einer der letzten Beschlüsse von Ex-Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein könnte zumindest mittel- bis langfristig die Situation entschärfen. Mückstein hatte durchgesetzt, die Ausbildungsstellen zu erweitern, sodass ein Facharzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie bald zwei Assistenten ausbilden darf. An der gegenwärtigen Situation wird dies freilich kaum etwas ändern. Die Appelle der Ärzte haben auch die Gesundheitsräte der Länder auf den Plan gerufen. Diese werden nicht müde, auf ihre aktuellen Bemühungen hinzuweisen, mehr Kassenverträge für Kinder- und Jugendpsychiater zu implementieren. In der Tat ein wichtiger Ansatz, – aber er allein reicht nicht aus.
„Kassenstellen sind gut. Aber wenn das die Lösung ist, haben die Verantwortlichen das Problem nicht verstanden“, erklärte etwa der Fachgruppenobmann der Ärztekammer, Helmut Krönke, jüngst im Standard: „Es braucht einen Gesamtplan für die Zukunft der psychiatrischen Versorgung junger Menschen.“
Eine genaue Vorstellung, wie diese aussehen könnte, hat Paul Plener. Er setzt auf eine Idee aus Großbritannien: „Dort geht man mit einem multidisziplinären Team direkt in die Familien hinein, was eigentlich genauso wirksam ist wie eine stationäre Behandlung. Der Vorteil: Der Patient befindet sich bereits mitten im Alltag , muss den Sprung dorthin nicht mehr schaffen, was oft eine große Hürde nach einem stationären Aufenthalt ist. Und diese Methode ist auch ein Stück weit kostengünstiger.“
Mehr Psychologen für Schulen
Diese Adaption nach britischem Vorbild – „und das britische Versorgungssystem ist nicht gerade eines, das für seine Freigiebigkeit bekannt ist“ – könnte laut Plener bahnbrechend sein. „Dort wurde eine maximale Investition in die psychische Gesundheit der Bevölkerung – insbesondere der Kinder – verabschiedet mit dem Ziel, dass die körperliche und psychische Gesundheit gleiche finanzielle Mittel zur Verfügung bekommen. Eine Strategie, die es wirtschaftlich übrigens ganz nüchtern zu betrachten gilt: Laut UNICEF-Bericht entsteht weltweit ein wirtschaftlicher Schaden von 387 Milliarden US-Dollar im Jahr durch die nicht stattfindende Behandlung von psychischen Erkrankungen in der Altersgruppe der Null- bis 19-Jährigen“, sagt Plener.
Das würde etwa bedeuten, die von der Kasse finanzierten Therapieplätze massiv zu erhöhen. Auch fordert er mehr Schulärzte, Schulpsychologen und Sozialarbeiter an Schulen.
Paul Plener, Leiter der Kinder- und Jugendpsychatrie im AKH, setzt auf eine multidisziplinäre Methode aus Großbritannien.
Bis die österreichische (Gesundheits)-Politik nachzieht, geht die Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH in den Praxistest. „Wir haben in Wien begonnen, ein Kooperationsprojekt mit dem Psychosozialen Dienst zu initiieren“, sagt Plener. Seine Kollegin Katrin Skala appelliert indes an die Regierungsverantwortlichen, aus Fehlern zu lernen und achtsamer mit den Belangen von vulnerablen Gruppen, allen voran Kindern- und Jugendlichen, umzugehen: „In der Coronapandemie wurde die junge Generation maximal unter Druck gesetzt, ein Teil davon wurde krank, schwer krank. Vom Fußballtrainer über den Lehrer bis hin zum führenden Politiker – nicht wenige von ihnen haben die Ängste Heranwachsender schlichtweg ignoriert.“
Welche Lehren man aus der Pandemie zieht, sei nicht zuletzt ein gesellschaftspolitisches Thema. Das hätte Gustav Heinemann bereits in den 1960er Jahren nicht treffender sagen können: „Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt“.
Hilfe für Personen mit Selbstmordgedanken sowie deren Angehörige gibt es unter suizid-praevention.gv.at sowie bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 142 sowie bei Rat auf Draht unter 147. Auf bittelebe.at sind Hilfseinrichtungen speziell für Jugendliche und deren Angehörige zu finden.

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. ImFURCHE‐Navigatorfinden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Siehier zu Ihrem Abo– gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. ImFURCHE‐Navigatorfinden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Siehier zu Ihrem Abo– gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)