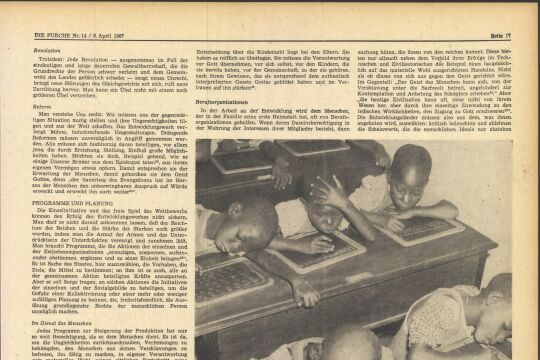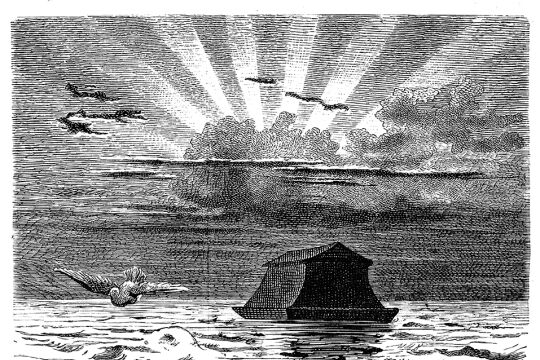Lebendigkeit
DISKURS
Lebendigkeit und Pandemie: Wie wir nun weiterkommen
Marianne Gronemeyer hat in der FURCHE kritisiert, dass in der Coronakrise die Lebendigkeit der Todesbekämpfung geopfert würde.Regina Polak hat darauf in der Vorwoche geantwortet. Hier nun eine Replik der Replik – samt Plädoyer für die Tugend der Unterscheidung.
Marianne Gronemeyer hat in der FURCHE kritisiert, dass in der Coronakrise die Lebendigkeit der Todesbekämpfung geopfert würde.Regina Polak hat darauf in der Vorwoche geantwortet. Hier nun eine Replik der Replik – samt Plädoyer für die Tugend der Unterscheidung.
„Weiterkommen, weiterkommen! Nur nicht mit aufgehobenen Armen stillestehen, angedrückt an eine Kistenwand“, heißt es in Franz Kafkas „Ein Bericht für eine Akademie“. Der Beitrag von Marianne Gronemeyer ist ein wichtiger Versuch, aus der Position des „Stillestehens, angedrückt an eine Kistenwand“ auszubrechen, eine Sprache zu finden, die einen Denkraum eröffnet, der ins Offene führt. Regina Polak findet in ihrer kritischen Replik dann auch, dass „Gronemeyers Gedanken – wie der christliche Glaube – gefährliche Fragen wecken“.
Worum geht es? Marianne Gronemeyer bezieht sich in ihren Überlegungen zur konvivialen Sicherheit und deren Gegenpol, der technogenen Sicherheit, auf Ivan Illich, den katholischen Priester und radikalen Kritiker der Verwestlichung der Welt. Ein durchgängiges Motiv in seinem Denken ist das Aufspüren gegensätzlicher Bereiche, deren Gleichgewicht durch die Vorherrschaft des einen oder des anderen Bereichs bedroht ist. In seinen kritischen Schriften zur Schule, zur Medizin, zur Technik, zum Verkehr oder zu Gender ist dieses Motiv in Verbindung mit Begriffen wie Komplementarität, Schwelle oder Grenze grundgelegt. Es ist gleichsam ein heuristisches Prinzip, ein möglicher Weg der Erkenntnis. Marianne Gronemeyer stellt nun in ihrem Beitrag die konviviale Sicherheit in unmissverständlicher Form und in nachvollziehbarer Klarheit der technogenen Sicherheit gegenüber, die nicht erst in der Corona-Pandemie zu einem immer dichteren Netz der wissenschaftlich-technischen Sicherung des Lebens geknüpft wurde. Die Pandemie brachte dies nur deutlicher zum Vorschein.
Hinweisen darauf, was verlorengeht
Ich sehe in dieser klaren Unterscheidung, in der Herausarbeitung der Besonderheiten dieser beiden Sphären das besondere Verdienst des Beitrags von Marianne Gronemeyer. Es geht dabei auch nicht um eine Schwarz-Weiß-Malerei, wie Regina Polak meint, sondern um die Frage, bis zu welcher Schwelle, bis zu welchem Ausmaß das „technogene Milieu“ weiterentwickelt werden kann, ohne das konviviale Moment in der Gesellschaft zum Verschwinden zu bringen. Es geht also um die Frage, was gut ist für das menschliche Zusammenleben. Derzeit wird diese Frage in den Hintergrund gedrängt durch die Fragen nach dem, was medizinisch-technisch möglich ist. Um hier Antworten zu finden, braucht es die Tugend der discretio, der Unterscheidung, die eine grundlegende Voraussetzung für die Suche nach dem rechten Maß ist. Kein vernünftiger Mensch wird in dieser Zeit der Pandemie das verfügbare medizinisch-technische „Werkzeug“ gering schätzen, aber es bleibt die Verpflichtung, auch auf das hinzuweisen, was verlorengeht, wenn das technogene Milieu allumfassend und total wird.
Durch die Pandemie brechen diese Fragen in bisher kaum gekannter Schärfe auf. Es hat frühe Warner gegeben, die die Gefährdung der conditio humana hellsichtig analysiert haben, neben Ivan Illich mit ihren jeweils unverwechselbaren Stimmen ein Günther Anders, ein Erich Fromm, ein Ernst Friedrich Schumacher, ein Romano Guardini oder auch ein Friedrich Heer. Im gegenwärtigen Diskurs ist es Giorgio Agamben, der sich mit kritischen Anmerkungen und Fragen im Zusammenhang mit der Pandemie immer wieder zu Wort meldet. In einem seiner letzten Blogeinträge auf der Seite des von ihm gegründeten Verlags Quodlibet (hier der Beitrag im italienischen Original) geht er tief in die griechische Mythologie zurück, um auf den untrennbaren Zusammenhang von Leben und Tod hinzuweisen. Gaia und Chthonia sind die beiden Namen der Erde, die einander entgegengesetzten Realitäten entsprechen. „Chthonia ist der formlose und verborgene Boden, den Gaia mit ihrer bunten Stickerei aus Hügeln, blühenden Landschaften, Dörfern, Wäldern und Herden bedeckt“, so Agamben. Mit dem Rückgriff auf den Mythos versucht Agamben zu beschreiben, welchen Bruch er in der Moderne wahrnimmt: „Was in der Moderne geschah, ist in der Tat, dass die Menschen ihre Beziehung zur chthonischen Sphäre vergaßen und beseitigten. Sie bewohnen nicht mehr Chthon, sondern nur noch Gaia. Doch je mehr sie die Sphäre des Todes aus ihrem Leben entfernten, desto unbewohnbarer wurde ihre Existenz [...]. Heilung gibt es nur für den, der sich daran erinnert, dass nur das Leben menschlich ist, in dem Gaia und Chthonia untrennbar und vereint bleiben.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!