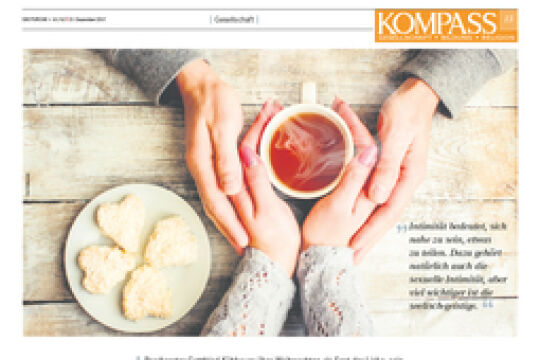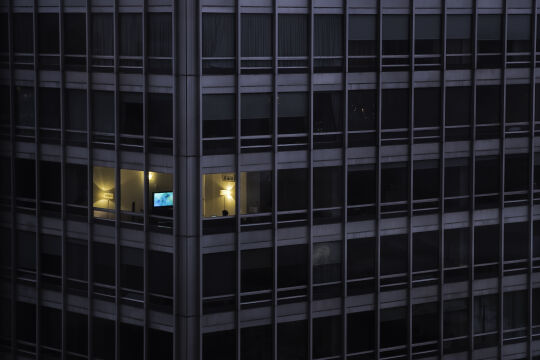Franz Kolland kennt die Lebenswelten alter Menschen wie kaum ein Zweiter in diesem Land. Seit Jahrzehnten beschäftigt sich der Wiener Soziologe mit der Frage, welche Kulturen und Lebensstile ältere Männer und Frauen entwickeln. Im FURCHE-Interview spricht er darüber, was Altwerden in Zeiten wie diesen bedeutet.
Die Furche: Herr Professor Kolland, Wohnformen wie "Pomali" wollen unter anderem der Einsamkeit im Alter entgegenwirken. Unter welchen Bedingungen kann so ein Zusammenleben von Alt und Jung gelingen?
Franz Kolland: Es funktioniert dann, wenn es ein gemeinsames Interesse gibt. Im angelsächsischen Bereich, aber auch in Skandinavien waren "Wohnen für Hilfe"-Projekte, wo hilfsbedürftige ältere Menschen mit Studenten wohnen, die für sie einkaufen gehen, sehr erfolgreich. In Graz ist so etwas Ähnliches jedoch gescheitert. Es reicht jedenfalls nicht, einfach nur alte und junge Menschen zusammenzubringen und zu sagen: Jetzt machen wir ein intergenerationales Projekt! Es braucht einen gemeinsamen Fokus, und man muss das moderieren. Außerdem ist das auch kein Programm für die breite Masse.
Die Furche: Allgemein orten Sie eher die Tendenz zur "Verinselung" von Altersgruppen: Hier Jungfamilien, dort Alte. Wobei das "Pflegeheim im Grünen" das Letzte sei, was sich alte Menschen wünschen würden
Kolland: Für besonders exklusive Formen möchte ich das nicht gelten lassen. Aber viele Menschen empfinden so ein abgesondertes Leben als falsch. Im Wiener Sophienspital etwa, das leider geschlossen wird, waren nicht jene Zimmer zuerst weg, die in den grünen Hof gehen, sondern jene in Richtung Gürtel. Dort ist der Teufel los -und die alten Leute hören eh meist schlecht. Doch im Hof herrscht Totenstille, das will niemand.
Die Furche: Wie überhaupt die wenigsten alt sein wollen, obwohl wir immer älter werden. Sie sprechen sogar von "Gerontophobie"
Kolland: Ja, viele versuchen, das eigene Alter mit allen Mitteln zu verdrängen und wegzuschieben. Und die Industrie tut alles, dass wir uns diesem Zwang zum Jungbleiben nicht entziehen können. Diese Verweigerung des Älterwerdens ist aber auch die Verweigerung, Alter als ein Element der Vielgestaltigkeit der Gesellschaft zu begreifen. Dazu kommt noch das Problem, dass "Jungbleiben" auch eine Frage des Wohlstands ist, und es immer mehr zur Spaltung kommt: hier jene, die sich Botox, Liftings oder gar Stimmenverjüngungen um 15.000 Euro leisten können -und dort jene, die sich das nicht leisten können und alt werden. Die Furche: Sie beforschen seit langem die "Kultur des Alters". Wie sieht die heute aus?
Kolland: Es gibt keine homogene Kultur. Wir sprechen eher von einer "Alterspolyphonie", weil wir eine starke Vervielfältigung unterschiedlicher Zugänge sehen. Wir haben die älteren Frauen, die nach dem Tod ihrer Männer als "Golden Girls" plötzlich studieren oder immer unterwegs sind; oder die "geocachenden alten Männer", die sich mittels GPS und geografischen Koordinaten auf Schnitzeljagd begeben. Neben diesen Novitäten gibt es aber auch Phänomene, die sich seit 40 Jahren nicht verändern, etwa die Senioren-oder Pensionistenclubs. Allein in Wien gibt es 150 davon. Und natürlich gibt es die älteren Männer, die im Internet nach Partnerinnen suchen. Die Furche: Müsste es nicht umgekehrt sein? In Österreich kommen derzeit auf 640.000 Männer über 65 Jahren 880.000 Frauen Kolland: Trotzdem gibt es bei Männern eine ständige Suche. Das zeigt schon ein Blick auf "Parship". Ich war im Dezember 2013 bei der Ö1-Sendung "Von Tag zu Tag" zum Thema "Alter als soziale Herausforderung" eingeladen. Da haben nur Männer angerufen -und sie haben nur über Sexualität gesprochen. Die Furche: Ist Sex für Frauen kein Thema?
Kolland: Doch, aber die Dysfunktionalität ist halt eher bei Männern gegeben. Das wird zwar tabuisiert, bewegt aber sehr viele.
Die Furche: Kommen wir zu einer anderen, wichtigen Frage, nämlich der, wie alte Menschen ihren Tag füllen. Sie haben erforscht, dass sich nur sechs bis zehn Prozent durch Kurse oder auch Vorträge weiterbilden
Kolland: Das ist ein erschreckend niedriger Prozensatz. Wobei es insgesamt eine hohe Kontinuität im Lebensverlauf gibt: Nur 20 Prozent tun plötzlich in der Pension etwas, was sie vorher noch nie getan haben. Die anderen 80 Prozent machen einfach das Gewohnte weiter -wobei es zu einer starken Streckung von persönlichen Aktivitäten kommt: Es wird doppelt so lange Hygiene berieben, gefrühstückt oder Zeitung gelesen. Bei den Über-75-Jährigen liegt der durchschnittliche, tägliche Fernsehkonsum bei 4,5 Stunden. Hier sind aber auch die gesundheitlichen Einschränkungen schon größer: Etwa zwei Drittel sind etwa inkontinent. Entsprechend toll sind Apps wie "Toiletten Finder", mit deren Hilfe man am Handy das nächste Klo suchen kann. Bei den 55-bis 75-Jährigen gibt es noch mehr Mobilität, etwa in Form von Ausflügen.
Die Furche: Sie sagen, dass auch das Ehrenamt eine große Rolle spielt, wobei Sie gerade bei ehrenamtlichen Tätigkeiten von Frauen eine ambivalente Haltung einnehmen
Kolland: Ja, denn das Ehrenamt der Männer hat meist eine hohe Wertschätzung und ist mit einer Funktion verknüpft, während die ehrenamtliche Tätigkeit von Frauen oft einfach eine soziale Tätigkeit ist, die von anderen -und auch von den Frauen selbst - als selbstverständlich angesehen wird. Ein gutes Beispiel ist das Kirchenputzen. Für mich geht es beim Älterwerden immer um Selbstbestimmung, und die kann ich nur erreichen, wenn ich das, was ich tue, auch tun möchte und darin Wertschätzung erfahre - und nicht, wenn ich es aus einer Pflicht heraus tue oder nur, weil es mir der Pfarrer aufgetragen hat. Die Furche: Wie geht Selbstbestimmung damit zusammen, dass viele ältere Frauen zur Enkelbetreuung eingeteilt werden?
Kolland: Dieses Phänomen, das übrigens meist eine matrilineare Angelegenheit ist, also über die Mutter der Mutter und nicht die Schwiegermutter läuft, wird von den meisten Omas gut angenommen. Auch die Beziehungen zwischen den Enkeln und den Großeltern sind relativ gut, auch deshalb, weil die Großeltern gelernt haben, sich in der Erziehung zurückzunehmen. Außerdem haben sie Geld und machen Geschenke. Eher gibt es heutzutage das Problem der Konkurrenz, weil es zu viele Omas und Opas und zu wenige Enkelkinder gibt.
Die Furche: Im Verhältnis der Generationen gibt es Ihnen zufolge einen Wandel von der "Pflichtethik" zum Verhandlungsmodus. Wie sieht es aber mit der Erwartung aus, von den eigenen Kindern gepflegt zu werden?
Kolland: Hier gibt es eine hohe Ambivalenz. Viele Eltern sagen: Wir erwarten nichts! Aber wenn wir genauer nachfragen, gibt es die "generational stake"-Hypothese, wonach die Eltern immer mehr erwarten, als die Jungen geben. Schließlich haben sie ja in sie investiert! 90 Prozent der Menschen erwarten nach wie vor, dass sich im Pflegefall irgendein Kind um sie kümmert.
Die Furche: In ein Pflegeheim zu kommen, bleibt also eine Kränkung?
Kolland: Ja sicher. Freiwillig geht fast niemand ins Heim. 93 Prozent sagen: Ich will lieber zuhause bleiben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!



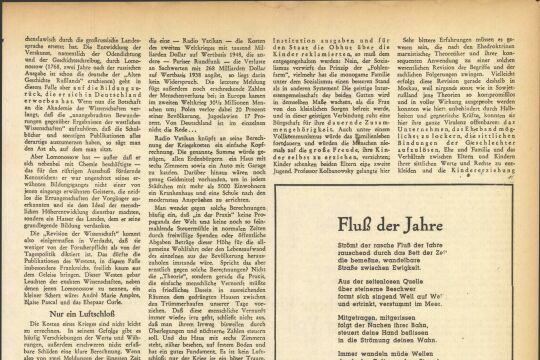
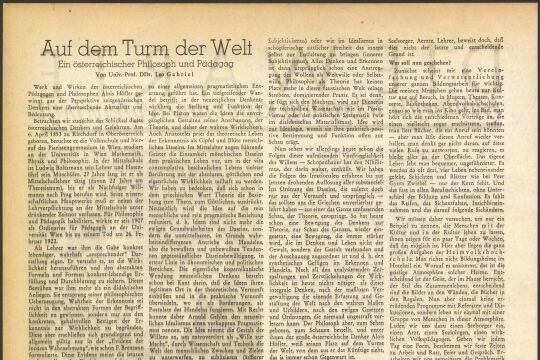


















































.png)
.jpg)