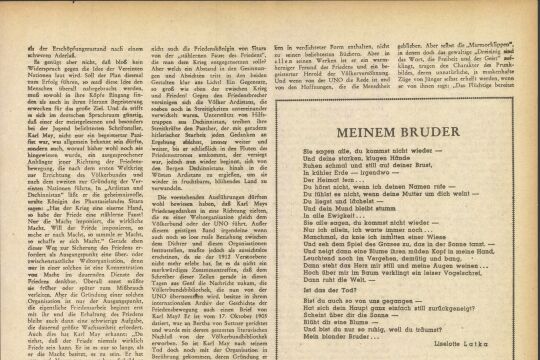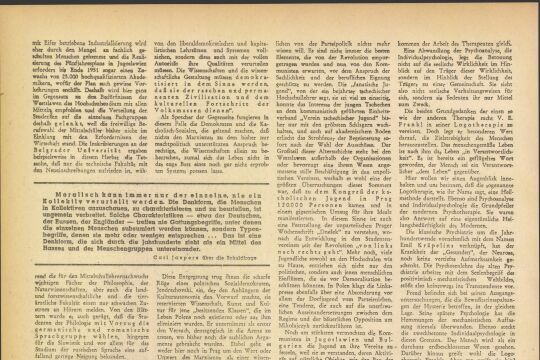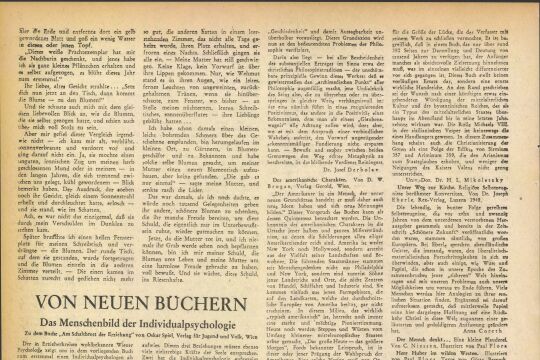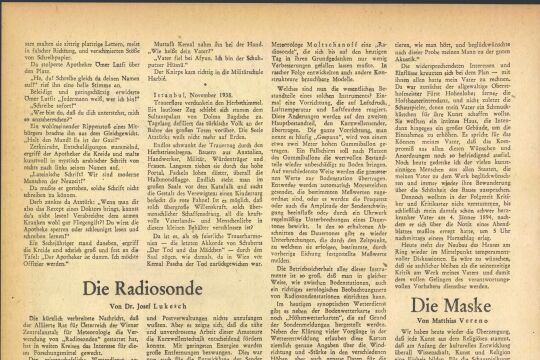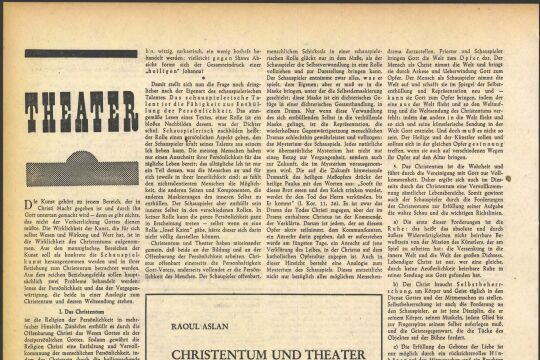Maskenfall
FOKUS
Maskenfall: Ceci n’est pas un masque
Ein berühmtes Zitat von Nietzsche lautet: „Alles, was tief ist, liebt die Maske“. Doch wie verhält es sich mit dem Selbst und seinen vielen Rollen? Spielen wir uns nur etwas vor oder ist der Mensch mehr als die Vielfalt seiner Masken? Eine philosophische Spurensuche.
Ein berühmtes Zitat von Nietzsche lautet: „Alles, was tief ist, liebt die Maske“. Doch wie verhält es sich mit dem Selbst und seinen vielen Rollen? Spielen wir uns nur etwas vor oder ist der Mensch mehr als die Vielfalt seiner Masken? Eine philosophische Spurensuche.
Es gibt von René Magritte ein Bild aus dem Jahre 1929, das eine Pfeife zeigt mit dem daruntergesetzten paradoxen Schriftzug: „Ceci n’est pas une pipe“. Dieses Bild hätte Friedrich Nietzsche vermutlich in seiner Ansicht bestärkt, dass alles, was tief sei, die Maske liebe. Denn – um das surreale Beispiel weiterzuspielen – Magrittes Pfeife scheint ein Geheimnis zu bergen, das vor gewöhnlichen Blicken bewahrt werden soll. Deshalb die paradoxe Verleugnung des Offensichtlichen: „Das ist keine Pfeife.“
In Nietzsches „Vorspiel einer Philosophie der Zukunft“, betitelt: Jenseits von Gut und Böse (1886), heißt es im § 40: „Ich könnte mir denken, dass ein Mensch, der etwas Kostbares und Verletzliches zu bergen hätte, grob und rund wie ein grünes altes schwerbeschlagenes Weinfass durch’s Leben rollte: Die Feinheit seiner Scham will es so.“ Nun, es gibt unter den Feingeistern unserer Kultur die Auffassung, gerade die zerbrechlichsten, zartesten Empfindungen, die der simple „Mann von der Straße“ nie und nimmer verstehen könne, bedürften des Schutzes vor Profanierung.
Und der beste Schutz sei es, „das Kostbare und Verletzliche“ unter einer Maske zu verbergen – einer Maske der Schlichtheit, des groben Gemüts oder gar der Verrücktheit. Über das zarte Herz von Don Quijote, dem Mann von la Mancha, der einer Bauersmagd den wohlklingenden Namen Dulcinea verleiht, weil er sie für ein edles Burgfräulein hält, als deren ritterlicher Held er auf seiner Klappermähre namens Rosinante gegen Windmühlenflügel kämpft: Über derlei schwärmerischen Wagemut weiß nur sein treuer Diener, Sancho Panza, Bescheid. Für alle anderen ist Don Quijote bloß „der Ritter von der traurigen Gestalt“, verrückt in seinem Tun und Lassen.
Die Lebensmaskerade
Dass gerade das zuinnerst Kostbare von denen, die es besitzen, durch eine Lebensmaskerade beschützt werden muss, um nicht dem Hohn und der Trivialisierungslust der Masse anheimzufallen, ist ein gängiges Motiv des Geistes- und Gefühlsadels. Dessen elitäre Anmaßung (wenn es denn eine ist) besteht allerdings darin, sich über den angeblich dumpfen Durchschnitt und dessen Grobschlächtigkeit erhaben zu fühlen. In diesem Kontext der „feinen Leute“ mit ihren Oberschichtallüren gründet eine der modernen Formen des Maskierens: Dem Pöbel gegenüber tritt man jovial auf, man ist ja auch nur ein Mensch, nicht wahr?
Wir haben es hier mit der pseudodemokratischen Umdeutung des wohl ursprünglichsten Antriebs zu tun, warum überhaupt Masken getragen werden. Dieser Antrieb ist kultischer und religiöser Natur. In Kulturen, die einst „primitiv“ genannt wurden, stellen die Maskentragenden im Rahmen von heiligen Zeremonien übernatürliche, mächtige Wesen dar, sei es in Tier- oder Menschengestalt. Man bittet um den günstigen Ausgang einer bevorstehenden Jagd oder einer Kriegshandlung. Es wird versucht, die Götter gütig zu stimmen, nicht bloß, indem man ihnen opfert, sondern auch, indem man sich ihnen angleicht. Darin gründet die Hoffnung – gemäß einem uralten Prinzip des magischen Denkens – etwas von den Naturenergien auf sich selbst überzuleiten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!