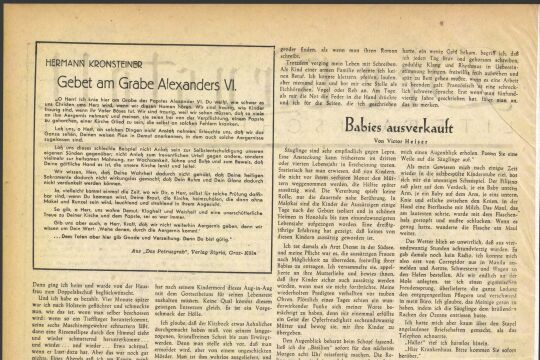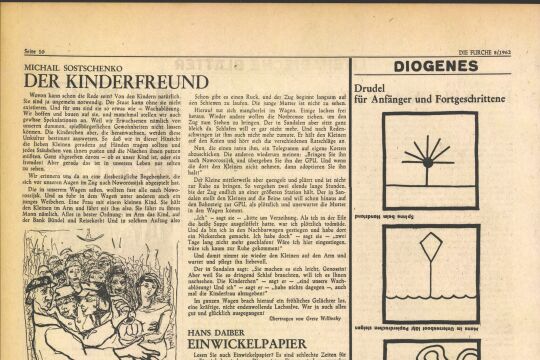"Natürlich hast du am Anfang nach dem Unfall das Gefühl: Das ist unfair. Du bist nur einen Meter neben dem Freund gesessen -und der hat nichts und du sitzt da."
Vielleicht wird er später noch eine Ausfahrt machen. Vielleicht wird er mit der Fernbedienung seine Wohnungs- und Haustür öffnen, über die barrierefreie Schwelle gleiten und übers flache Land jagen -so schnell, dass nur die Aufmerksamsten das Schild "Eat my dust" auf der Rückseite seines Rollstuhls erspähen. Bis nach Tulln treibt es ihn, wenn es warm und schön ist draußen. Aber noch sitzt Gerhard Tockner im Wintergarten seiner Wohnung im niederösterreichischen Sieghartskirchen und erzählt geduldig seine Geschichte. "Zeitdruck habe ich ja keinen", sagt er im fetzigen Pink-Floyd-Sweater und nimmt mit dem Strohhalm einen Schluck Blasentee.
Michaela Kahri-Samwald kennt Tockners Geschichte - wie so ziemlich alles, was ihn betrifft. Die ausgebildete Gesundheitsund Krankenschwester leitet den zuständigen Regionsstützpunkt des niederösterreichischen Hilfswerks und ist seine "Pflegemanagerin". Rund drei Mal jährlich kommt sie vorbei, um mit dem 48-Jährigen das aktuelle Betreuungs-Setting zu besprechen. Gerhard Tockner ist einer ihrer langjährigsten, intensivsten, aber auch atypischsten Kunden, erzählt Kahri-Samwald. Schließlich hat ihn nicht das Alter, sondern ein kurzer Moment vor vielen Jahren in seine Situation gebracht.
Es ist der 31. Oktober 2001,21 Uhr abends. Gerhard Tockner, damals gerade 32 Jahre alt, sitzt am Beifahrersitz, als sein Freund die Kontrolle über seinen Wagen verliert. Das Auto fliegt aus der Kurve, stürzt eine Böschung hinab, überschlägt sich und bleibt auf einem Acker liegen. Im Schock kann sich Tockner noch 20 Schritte dahinschleppen, dann stürzt er zu Boden. Sein zweiter, dritter und vierter Halswirbel sind gebrochen, der Freund am Volant kommt mit Prellungen und einer Platzwunde am Kopf davon.
Ein Mann und zwölf Frauen
"Natürlich hast du am Anfang das Gefühl: Das ist unfair", sagt Gerhard Tockner heute. "Du bist nur einen Meter daneben gesessen - und er hat nichts und du sitzt da." Monatelang lang ist er im Krankenhaus und auf Rehabilitation, um sich in einem Leben zurechtzufinden, in dem fast nichts mehr so ist wie zuvor. Der ehemalige Bauarbeiter kann nicht mehr gehen, seine Arme kaum bewegen und wegen der stützenden Titanplatte in der Halswirbelsäule auch den Kopf nicht mehr drehen. Im September 2002, elf Monate nach dem Unfall, kommt er endlich nach Hause, seine Lebensgefährtin hat in der Zwischenzeit eine neue Wohnung gesucht und sie mit Hilfe einer Reha-Beratungsfirma barrierefrei gemacht: Türen sind verbreitert, die Badewanne herausgerissen und durch einen freien Duschplatz mit Duschsessel ersetzt worden.
Einmal täglich kommt anfangs das Hilfswerk vorbei, um Tockners Lebensgefährtin bei der Pflege und Betreuung ihres Partners zu unterstützen. Auch seine Schwester übernimmt manche Abend- und Wochenenddienste. Doch nach und nach bricht rund um ihn alles weg: Seine Partnerin stirbt, und auch seine Schwester erliegt vor zwei Jahren dem Krebs. Seitdem hat das Hilfswerk die vollständige Betreuung übernommen. Bis zu zwölf verschiedene Mitarbeiterinnen kommen drei Mal täglich bei Gerhard Tockner vorbei: Morgens zwischen sechs und halb sieben Uhr lagern sie ihn um und richten ihm das Frühstück und die Medikamente; um halb neun Uhr gibt es große Morgentoilette, Durchbewegen der Gelenke und "Herausmobilisieren" in den Elektro-Rollstuhl, wie es in der Pflegesprache heißt; auch das Mittagessen wird gewärmt bzw. vorgeschnitten. Und abends um 18 Uhr 30 wird Tockner für die Nacht fertig gemacht: Normalerweise dauert das Prozedere eine halbe Stunde, jeden zweiten Tag freilich deutlich länger: Schon am morgen solcher "Stuhltage" muss er ein Abführmittel nehmen, abends bekommt er zwei Zäpfchen. Ein Katheter bleibt ihm hingegen erspart, weil er spontan urinieren kann. Nur ein "Urinalkondom" muss er verwenden, das den Harn in einen Beutel leitet.
Es sind diese scheinbar kleinsten, intimsten Bereiche geretteter Selbstbestimmung, die im Alltag unendlich wichtig werden: kurz das eigene Körpergewicht halten können, um über "Stehtransfer" vom Bett in den Rolli und retour zu gelangen; mit der rechten Hand noch ein wenig greifen können, um dank einer festgekletteten Maus mit Scroll-Ball im Internet zu surfen; oder noch Berührungen spüren. Als "inkompletter Querschnitt", bei dem nicht alle Nerven durchtrennt wurden, hat Tockner eine gewisse Oberflächensensibilität. In der linken Körperhälfte geht sie sogar tiefer, hier spüre er sogar noch Schmerzen, erzählt Tockner: "Wenn ich eine Spritze bekomme, sage ich deshalb bis heute: Bitte rechts!"
Ins Heim? Gar nicht daran denken!
Autonom bleiben, selbstbestimmt bleiben, sagen können, was man will und was nicht: Das ist dem 48-Jährigen unendlich wichtig -und dank mobiler Dienste auch möglich. Rund 1800 Euro monatlich bezahlt er dem Hilfswerk für dieses große Stück Freiheit; mit den rund 2300 Euro, die seine Pension und das Pflegegeld der Stufe sechs ausmachen, geht sich das gut aus. Dass er irgendwann womöglich in ein Heim muss, weil er es zuhause nicht mehr schaffen könnte, daran denkt Gerhard Tockner derzeit noch nicht.
"Die meisten unserer Kunden wollen zuhause bleiben und am Ende auch daheim sterben", erzählt Michaela Kahri-Samwald. Auch sie selbst schätzt die mobile Hauskrankenpflege im Vergleich zum stationären Heim: "Hier ist man viel flexibler, man kann mehr auf die Kunden eingehen und hat auch mehr Zeit", sagt sie. Außerdem sei ein stationärer Platz auch deutlich teurer. Dass durch den Wegfall des Pflegeregresses nun der große Run auf die Heime stattfinde, entspreche folglich weder den Wünschen der Betroffenen noch der ökonomischen Logik.
Ich bin eben ein positiver Mensch. Außerdem glaubt man gar nicht, woran sich der Mensch alles gewöhnen kann. (Gerhard Tockner)
Kontraproduktive Anreize
Sie selbst merkt aber ohnehin nicht viel von diesem Trend, denn der Andrang auf die mobilen Dienste bleibe ebenso groß wie der Mangel an Fachkräften. Den Grund dafür orten private Träger wie Hilfswerk oder Caritas in der ungleichen Bezahlung: So sei etwa in Niederösterreich das Einstiegsgehalt einer diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegekraft im mobilen Bereich um 350 Euro niedriger als im Heim.
Über all das könnte man klagen. Und auch Gerhard Tockner hätte guten Grund, Trübsal zu blasen. "Aber ich bin eben ein positiver Mensch", sagt er. "Außerdem ist der Mensch ein Gewohnheitstier." Nur der starre Hals stört ihn bis heute nachhaltig. Ansonsten habe er aber keine Probleme und jede Menge Freiheit: Er könne stundenlang Bluesrock hören; oder sich mit Freunden treffen; oder abends Heimkino machen. Um die lange Zeit im Bett von 19 Uhr abends bis Mitternacht angenehmer zu gestalten, hat sich Tockner einen riesigen Fernseher gekauft und schaut dort gerne Motorsport. Irgendwann wird er nicht mehr nur nach Tulln rollen, sondern mit seinem Freund nach Amerika fliegen und dort ein "Nescar"-Rennen besuchen. Die Modelle der Autos stapeln sich schon jetzt in seiner Wohnung.
Einfach wird das natürlich nicht, erklärt er beim Abschied. "Ich muss erste Klasse fliegen, damit ich auch liegen kann. Und aus den Rollstuhl-Reifen muss man die Luft auslassen, damit sie beim Fliegen nicht zerplatzen." Aber irgendwie werde es schon gehen, sagt Tockner und öffnet mit der Fernbedienung die Wohnungstür: "Mit Hilfsmitteln geht alles."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!