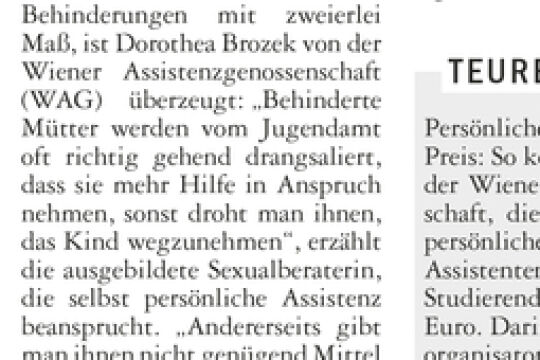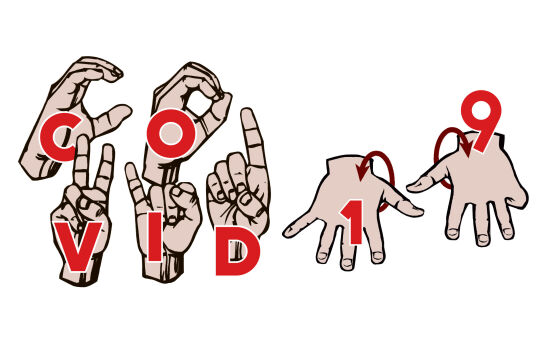Persönliche Assistenz: Wer geht mir an die Haut?
Vom Pflegenotstand sind nicht nur alte, sondern auch behinderte Menschen jedes Alters betroffen. Sie haben bevormundende "Betreuung" satt - und wünschen sich "persönliche Assistenz".
Vom Pflegenotstand sind nicht nur alte, sondern auch behinderte Menschen jedes Alters betroffen. Sie haben bevormundende "Betreuung" satt - und wünschen sich "persönliche Assistenz".
Dorothea Brozek sitzt im Rollstuhl und kann kein Glas allein vom Tisch heben. Und trotzdem hat sie ihr Leben fest im Griff. Sie ist keine hilflose Behinderte, die von Pflegerinnen "betreut" wird - solche Begriffe sind ihr zu bevormundend. Allerhöchstens unterstützt will sie werden. Und zwar nicht von Heimdiensten, die ihr nach rigidem Stundenplan "Schwestern" nach Haus schicken, die sie womöglich unsanft umdrehen, waschen oder "zu Erledigungen außer Haus nicht befugt sind". Sie will sich die Menschen, die ihr an die Haut und an die Hand gehen, selbst aussuchen. Auch fachlich unkundige Studenten können es sein, wichtiger sind ihr Einfühlungsvermögen und Flexibilität. Zeitpläne und Stundenlohn möchte sie selbständig regeln, das Geld dafür soll ihr der Fonds Soziales Wien direkt geben, anstatt es wie bisher an Pflegeeinrichtungen auszuzahlen.
Individualität statt Heim
Das, worum es hier geht, heißt "persönliche Assistenz". Sie bedeutet Umverteilung der Macht von den Institutionen zu den Betroffenen. Die Idee hat sich aus der amerikanischen "Selbstbestimmt Leben"-Bürgerrechtsbewegung der sechziger Jahre entwickelt. Mit Leitsprüchen wie "Reißt die Mauern nieder", "Schließt die Institutionen" suchten behinderte Menschen nach privat organisierten Unterstützungsmodellen, die ihnen ein selbstbestimmtes Leben daheim ermöglichen sollten. "Ich brauche flexible Hilfskräfte, die wochentags um acht und sonntags erst um zehn Uhr kommen," erklärt Dorothea Brozek ihre individuellen Bedürfnisse, die institutionelle Pflegedienste überfordern. Ursprünglich war die an progressiver Muskelschwäche Leidende von ihrer allein erziehenden, voll berufstätigen Mutter unterstützt worden - 85 Prozent aller behinderten Menschen werden von der Mutter betreut. Während des Studiums begann Brozek, sich ihre Hilfen alleine zu organisieren: Universitätsinstitute per Rollstuhl treppauf, treppab, teilweise ohne Fahrstuhl, durchs Studium getragen von hilfsbereiten Kollegen: "Wenn ich heute daran zurückdenke, weiß ich nicht mehr, wie ich das alles managen konnte." Bald war ihr jedoch klar, dass sie diesen emanzipatorischen Weg weiter gehen musste, denn zusehends manifestierten sich bei ihrer Mutter körperliche und psychische Erschöpfungsanzeichen: "Ich hab gewusst, wenn ich mich nicht um anderwärtige Unterstützung kümmere, muss ich ins Heim."
Kampf statt Verständnis
Was ihr von der Stadt Wien angeboten wurde, waren betreute Wohngemeinschaften - für Dorothea Brozek indiskutabel: "Kleinheime" sind das für sie, wo man sich nicht selber aussuchen kann, mit wem man zusammenlebt und wer einen betreut, wo der Lebensrhythmus kollektiv vorgegeben wird. Da hörte sie von der Idee der "Persönlichen Assistenz" - und hatte fortan ein neues Ziel: Dieses Modell Realität werden zu lassen - was zu einem zermürbenden Kampf mit der Stadt Wien ausartete: Der Fonds Soziales Wien konnte nicht nachvollziehen, wieso Brozek das existierende mobile und stationäre Betreuungsangebot inakzeptabel fand. Nach fünf Jahren war die Behörde schließlich weich geklopft: Dorothea Brozek engagierte junge Studentinnen und Sozialarbeiterinnen nach eigenem Gutdünken und schickte dem Amt die Rechnungen.
Eine solche Assistentin war über mehrere Jahre die aus Innsbruck stammende Sozialarbeiterin Daniela Falkner. Als "verlängerter Arm" der Betroffenen sah sie sich. Sie erledigte Einkäufe, Hausarbeiten und Körperpflege. Wichtig sei, Sensibilität für die jeweilige Tagesverfassung des behinderten Menschen zu entwickeln, denn "wir waschen uns ja auch nicht täglich gleich schnell". Den anderen nicht zu überfahren, das Zimmer nur dann aufzuräumen, wenn der Betreffende es auch wirklich will, Eingespieltes ständig neu zu überprüfen - darin liegen die schwierigen Anforderungen an eine Assistentin. Heute organisiert Daniela Falkner bei der Wiener Behindertenberatung "Zentrum für Kompetenzen" Peer group-Gespräche, wo Assistenten ihre Arbeit gemeinsam reflektieren können.
Es geht auch um Arbeitsrechtliches: Nur ein kleiner Prozentsatz der in Österreich arbeitenden Assistenten kommt in den Genuss eines Anstellungsverhältnisses, weil ihre behinderten Arbeitgeber vom Staat zuwenig Finanzmittel erhalten. Die meisten Assistenten müssen als freie Dienstnehmer arbeiten, oft sind es deswegen Studenten, die sich ein Zubrot verdienen. Dadurch ist die Fluktuation groß und die behinderten Menschen müssen ständig neue Assistenten anlernen.
Die staatliche Bezahlung von "Persönlicher Assistenz" variiert je nach Bundesland. Die Behinderten erhalten dafür über das Pflegegeld hinaus eine bestimmte Summe von der Behörde, das Geld reicht jedoch in keinem Bundesland aus, um eine mitunter benötigte Rund-um-die-Uhr-Betreuung zu finanzieren. Viele Betroffene müssen deswegen in Heimen leben. Der Netto-Stundenlohn, den sich ein Assistent erwarten kann, liegt zwischen sechs und zehn Euro. Nur Arbeitsassistenz - also Unterstützung am Arbeitsplatz und bei der Ausbildung - ist derzeit bundesweit auf zufrieden stellende Weise geregelt und finanziert (die Initiative dafür kam vom VP-Nationalratsabgeordneten Franz-Joseph Huainigg, siehe Bild). Für den privaten Bereich gibt es hingegen noch keine gesetzlichen Richtlinien, was zu einem Wildwuchs an Zwischenlösungen führt, die mitunter ebenso provisorisch sind wie im Falle der zuletzt heftig diskutierten illegalen Altenpflegerinnen aus dem Osten.
In manchen Bundesländern organisieren derzeit Behindertenvereinigungen die "Persönliche Assistenz": In Wien übernimmt die Betroffenenvereinigung Wiener Assistenzgenossenschaft (WAG) unter der Leitung von Vorkämpferin Dorothea Brozek auf Wunsch den gesamten administrativen Teil, stellt die Assistenten an und berät die Betroffenen bei allen Anliegen. In Innsbruck tut dies die "Selbstbestimmt Leben"-Anlaufstelle (SLI). Mit rund 180 Assistierten ist sie der österreichweit größte Anbieter. Die Anzahl der finanzierten Stunden ist jedoch begrenzt. Denn anstatt dieses neue Modell zu fördern, finanzierte die Politik in den letzten Jahre die aufwändige Renovierung mehrerer Tiroler Behindertenheime: "Dafür ist Geld da", kritisiert Gerhard Walter von SLI. Emanzipationsmodelle wie die "Persönliche Assistenz" werden zwar von der Mehrzahl der Betroffenen gewünscht - sogar mehrfach behinderte, schwer hospitalisierte Menschen konnten sich mithilfe der von SLI organisierten persönlichen Assistenz ein Leben in Freiheit erobern -, doch die Stimme der Betroffenen zählt bei der Behörde anscheinend weniger als die der Institutionen.
Recht statt Almosen
Während "Persönliche Assistenz" in skandinavischen Ländern bereits gesetzlich verankert ist, steckt sie in Österreich noch in den Kinderschuhen. Doch langsam bewegt sich auch die Politik: In Wien hat man sich nun zu einem couragierten Modellversuch durchgerungen: Über einen Zeitraum von zwei Jahren bekommen zwanzig behinderte Menschen vom Fonds Soziales Wien Direktzahlungen, die ihnen die Finanzierung von "Persönlicher Assistenz" je nach Bedarf auch rund um die Uhr ermöglichen soll. Danach soll das Projekt evaluiert und über eine Ausweitung auf das gesamte Bundesland nachgedacht werden. Auf Grund des relativ niedrig veranschlagten Stundenlohnes von 13,72 Euro gehen sich jedoch wieder nur wenige reguläre Anstellungsverhältnisse aus. Die Betroffenen richten nun ihre Hoffnungen auf den Regierungswechsel. Sie fordern ein bundesweites Gesetz; auch die Finanzierung von "Persönlicher Assistenz" soll in ganz Österreich möglich werden, damit jeder behinderte Mensch die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben hat und auch nicht die Familien als Selbstausbeuter herhalten müssen "Es geht nicht um Almosen, sondern um Rechte. Es geht um gesellschaftliche Partizipation", so die Betroffenenbewegungen. Sie wollen als Experten in die politische Gesetzwerdung einbezogen werden. "Behinderte Menschen wollen nicht wegsperrt werden", fordert Dorothea Brozek, "sondern sie sollen endlich sichtbar sein."
Die Autorin ist freie Journalistin und Sendungsgestalterin bei Ö1.