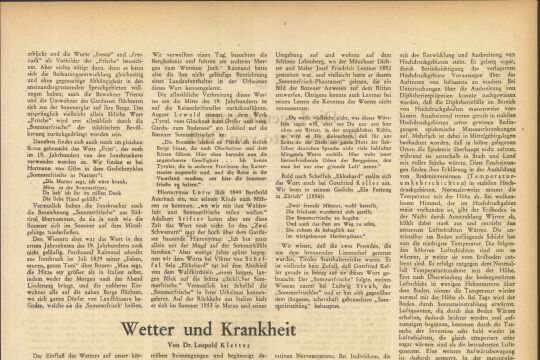"Raus aus dem Bett!"
Der Freiburger Psychologe Dieter Riemann hat europaweite Richtlinien zur Behandlung von Schlaflosigkeit entwickelt. Wann nächtliche Wachheit pathologisch wird. Und was dann hilft.
Der Freiburger Psychologe Dieter Riemann hat europaweite Richtlinien zur Behandlung von Schlaflosigkeit entwickelt. Wann nächtliche Wachheit pathologisch wird. Und was dann hilft.
Im Dunkeln an die Decke starren - oder noch schlimmer auf den gnadenlos vor sich hin tickenden Wecker: Das gilt vielen als Inbegriff der Qual. Doch nimmt Schlaflosigkeit tatsächlich zu? Ab wann spricht man überhaupt von "Schlafstörung"? Und was hilft in diesem Fall? Der Freiburger Psychologe Dieter Riemann hat sich seit Jahren damit beschäftigt -und 2017 mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa eine "Europäische Leitlinie für die Diagnose und Behandlung von Schlaflosigkeit" veröffentlicht. Ein Gespräch über schlaflose Frauen und Städter, den Umgang mit Schlafmitteln und die erstaunlich schlaffördernde Wirkung der kognitiven Verhaltenstherapie.
DIE FURCHE: Herr Professor Riemann, kann man sagen, dass Europa heute schlechter schläft als früher?
Dieter Riemann: Auf den ersten Blick scheint es so, weil wir in Medizin, Forschung und Medien dem Schlaf viel mehr Aufmerksamkeit widmen. Es gibt aber keine Studien darüber, wie weit verbreitet Schlaflosigkeit vor 100 oder 50 Jahren war, die meisten Untersuchungen stammen aus den letzten 30 Jahren -und hier gibt es tatsächlich einige, die zeigen, dass uns die 24/7-Society und die Medien den Schlaf rauben. Andererseits sind die Arbeitszeiten und -belastungen in Europa in den letzten 100 bis 50 Jahren weitaus besser geworden, und es gibt eine klare Korrelation zwischen der Schlafqualität und Unsicherheit bzw. Belastung am Arbeitsplatz. Bei ökonomischen Umbrüchen oder erhöhter Arbeitslosigkeit steigt auch die Zahl der Menschen, die schlecht schlafen.
DIE FURCHE: Viele Menschen haben "schlechte Nächte". Aber ab wann wird Schlaflosigkeit zur "Schlafstörung"? Und wer ist besonders davon betroffen?
Riemann: Wir sprechen von einer relevanten Schlafstörung, wenn jemand mehr als drei Monate lang unter Ein-oder Durchschlafschwierigkeiten oder frühmorgendlichem Erwachen leidet - sowie damit verbundenen Einschränkungen der Tagesbefindlichkeit wie Konzentrations-und Leistungsstörungen. Umso älter wir werden, umso störanfälliger wird dann unser Schlaf. Und: Frauen ab Mitte 40, Anfang 50 leiden auch häufiger unter Schlafstörungen als Männer. Ein möglicher Grund sind hormonelle Veränderungen mit Beginn der Menopause, dazu sind Frauen in diesem Alter oft damit konfrontiert, dass die Kinder ausziehen, was für sie beim traditionellen Rollenbild womöglich eine besondere emotionale Belastung darstellt. Auch zwischen Stadt und Land gibt es deutliche Unterschiede: In Ballungsgebieten leiden mehr Menschen an Schlafstörungen als in ländlichen Gebieten, wo vielleicht der Druck und das tägliche Zusammentreffen mit Menschen nicht so geballt ist wie in der Großstadt. Dort kommt auch die Lärmkulisse und nächtliche Helligkeit dazu.
DIE FURCHE: Sie kennen als Mitglied der "European Sleep Research Society" Studien aus ganz Europa. Gibt es punkto Schlafstörungen nationale Unterschiede?
Riemann: Interessanterweise nicht. Man könnte sich ja tatsächlich vorstellen, dass die Menschen am Nordkap schlechter schlafen, weil sie ein halbes Jahr im Dunkeln und dann wieder im Hellen sitzen, aber das ist nicht der Fall. Interessant ist aber, dass die Deutschen bei den relevanten Schlafstörungen mit sechs Prozent relativ gut wegkommen, während in Frankreich 20 Prozent darunter leiden. Hier gibt es also definitiv nationale Unterschiede -aber das kann auch daran liegen, dass es unterschiedliche Kulturen gibt, wie auf Schlafstörungen eingegangen wird. In Deutschland und Österreich geht man mittlerweile sehr vorsichtig mit Schlafmitteln um, weil Klassiker wie Benzodiazepine ein hohes Abhängigkeitspotenzial haben. In Frankreich hingegen werden Schlafmittel noch relativ unkritisch verschrieben. Klar ist auch, dass Schlafstörungen zwar in den westlichen europäischen Industrienationen ein große Thema sind, aber im Kosovo wird man beim Arzt keinen großen Eindruck schinden, wenn man über Einschlafprobleme klagt.
DIE FURCHE: In südlichen Ländern wie Spanien und Italien gibt es noch eine "Siesta-Kultur". Welche Folgen hat das?
Riemann: Eine lange Mittagspause, in der man auch kurz schläft, führt natürlich zu einem kürzeren Nachtschlaf. Durch die zunehmend klimatisierten Büros findet aber gerade ein Umbruch statt. Viele Arbeitnehmer sind auch sehr unzufrieden mit der langen Mittagspause, weil sie dadurch abends deutlich länger arbeiten müssen. Klar ist jedenfalls, dass höhere Temperaturen den Schlaf stören. Das hat man auch in Mitteleuropa gemerkt, wo es in den letzten Sommern häufig Tropennächte von über 20 Grad gegeben hat.
DIE FURCHE: Kommen wir zu Ihrer Europäischen Leitlinie, die sich neben der Diagnostik von Schlafstörungen vor allem ihrer Therapie widmet. Die "Cognitive Behavioral Therapy"(CBT) ist demnach die Behandlung der Wahl. Können Sie beschreiben, wie sie abläuft?
Riemann: Diese Behandlungsmethode hat sich schon in den letzten 50 Jahren entwickelt und besteht aus mehreren Bausteinen. Den Anfang macht eine vernünftige Diagnostik, die eben nicht so abläuft, dass man nach der Aussage "Ich schlafe schlecht" sofort Schlafmittel verschreibt, sondern dass man sich genau anschaut, wie der Schlaf aussieht: Etwa mit Hilfe eines Schlaftagebuchs, bei dem der Betroffene Protokoll führt. Dann geht es um eine vernünftige Schlafhygiene: Ein Beispiel dafür wäre, Schlaflosigkeit nicht mit Alkohol zu bekämpfen. Es ist nicht selten, dass Leute sagen: Dann trinke ich halt abends mehr, dann geht es schon. Alkohol entspannt zwar und macht schläfrig, aber er muss später auch abgebaut und die Flüssigkeit ausgeschieden werden. Und weil man dann nicht mehr so leicht einschläft, wird es am Ende immer schlimmer.
DIE FURCHE: Ein weiterer Aspekt der Schlafhygiene ist der richtige Umgang mit digitalen Geräten im Schlafzimmer. Wie sollte er aussehen?
Riemann: Man sollte natürlich nicht mit dem PC oder dem Smartphone ins Bett gehen oder sie im Standby-Modus am Nachtkästchen liegen haben. Abgesehen vom blauen Licht, das schlafhinderlich ist, sollte das Schlafzimmer ja Ruhe ausstrahlen und einen nicht ständig daran erinnern, was noch alles zu tun ist. Kurz gesagt: Das Bett ist zum Schlafen da. Und wenn man nicht schlafen kann -dann raus aus dem Bett! Das Ziel dieser verhaltenstherapeutischen Technik ist, dass das Bett nicht mehr mit Schlaflosigkeit, sondern nur noch mit Schlaf assoziiert wird. Es geht um eine Stimuluskontrolle
DIE FURCHE: Rückfrage: Wie lange darf man schlaflos im Bett bleiben?
Riemann: Hier eine genaue Dauer anzugeben, wäre kontraproduktiv, weil man ja gerade nicht ständig in Panik auf die Uhr schauen soll. Aber wenn man das Gefühl hat, dass die Schlaflosigkeit schon zu lange dauert, dann soll man aufstehen, in ein anderes Zimmer gehen und etwas Entspannendes machen. Ins Bett zurück soll man erst dann wieder, wenn man müde ist.
DIE FURCHE: Ein zentraler Teil der kognitiven Verhaltenstherapie ist auch die Schlafrestriktion. Wie geht man hier vor? Riemann: Es geht hier darum, die Zeit im Bett zu reduzieren, um dadurch den natürlichen Schlafdruck wieder zu erhöhen. Viele Menschen -vor allem ältere Personen -reagieren ja so auf ihre Schlaflosigkeit, dass sie einfach früher ins Bett gehen, um die Chance auf Schlaf zu erhöhen.
DIE FURCHE: Wobei viele es auch müssen, wenn etwa in einem Pflegeheim die Schlafenszeit schon am späten Nachmittag oder frühen Abend beginnt. Riemann: Das ist leider richtig. Wenn man stundenlang im Bett liegt und nur sieben Stunden Schlaf braucht, führt das aber quasi vorprogrammiert zu Schlaflosigkeit. In der kognitiven Verhaltenstherapie geht man den umgekehrten Weg und macht das Fenster für den Schlaf erst einmal deutlich kleiner, fünf oder sechs Stunden lang. Das hat den Effekt, dass man tagsüber sehr viel müder ist und dann am nächsten Abend schneller ein-und durchschläft. Diese Erfahrung ist für viele Patienten total überraschend und ein wirkliches Aha-Erlebnis. Sie denken sich anfangs: Das wird furchtbar werden, da bekomme ich erst recht keinen Schlaf, aber tatsächlich wird die normale Schlaffähigkeit dadurch wieder gefördert und man schläft auf einmal wieder zumindest fünf Stunden lang durch. Im Anschluss kann man diese Bettzeit dann wieder Woche für Woche um je eine halbe Stunde verlängern.
DIE FURCHE: Wie lange dauert es durchschnittlich, bis man eine Schlafstörung auf diese Art kurieren kann?
Riemann: Wenn man es bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin macht und einmal pro Woche eine Sitzung vornimmt, gehen wir von vier bis acht Wochen aus. Die meisten Betroffenen haben ja schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich, zum Teil zehn oder auch 20 Jahre. Da braucht der Körper schon ein wenig Zeit, um sich wieder umzustellen, aber aus meiner Sicht kommt der Effekt erstaunlich rasch.
DIE FURCHE: In Österreich muss man für eine kognitive Verhaltenstherapie bei Schlaflosigkeit meist selber zahlen, auch wird sie nicht flächendeckend angeboten. Ihre Taskforce "European Insomnia Guidelines" bzw. die "European Sleep Research Society" will europaweit das Bewusstsein für die Effizienz dieser Methode heben. Wie genau soll das gelingen?
Riemann: Die Leitlinien, die wir mit 20 bis 30 Expertinnen und Experten aus ganz Europa entwickelt haben, waren schon ein wichtiger Schritt. Und jede nationale Schlafgesellschaft versucht, das nun in ihrem eigenen Rahmen umzusetzen und im Gesundheitssystem zu lancieren. Außerdem starten wir gerade eine Initiative, bei der wir noch klarer definieren wollen, welche Qualifikationen die Therapeutinnen und Therapeuten haben müssen. Unser Ziel ist, in jedem europäischen Land Ausbildungszentren für Therapeuten zu definieren. Aktuell haben wir in Freiburg auch ein großes Forschungsprojekt bewilligt bekommen, bei dem die Versorgung von Menschen mit Schlafstörungen durch den Hausarzt europaweit erforscht und verbessert werden soll.
DIE FURCHE: Ein überzeugendes Argument für die Politik wäre wohl ein Hinweis auf die hohen Krankheitskosten in Folge chronischer Schlaflosigkeit. Was könnten Sie hier vorbringen?
Riemann: Es gibt sehr überzeugende Daten, dass Schlaflosigkeit sowohl für Herz-Kreislauf-Erk r a n k u n gen als auch für Übergewicht und Diabetes ein Risikofaktor ist. Das entwickelt sich nicht binnen weniger Wochen, aber doch innerhalb von Jahren. Das gesichertste Risiko ist aber jenes für psychische Erkrankungen: Wer lange schlaflos ist, hat ein deutlich erhöhtes Risiko, depressiv zu werden und eine Angsterkrankung oder Alkoholabhängigkeit zu entwickeln. Wir wissen auch - wie bereits erwähnt -, dass die Vergabe von Schlafmitteln zwar mittelfristig hilft, aber langfristig das Problem wahrscheinlich noch verstärkt. Die kognitive Verhaltenstherapie ist hingegen langfristig wirksam.
DIE FURCHE: Und wie wirksam sind aus Ihrer Sicht digitale Angebote wie Einschlafoder Entspannungs-Apps bzw. Schlaftracking-Tools (siehe rechts)?
Riemann: Angebote wie www.sleepio.com, die wie eine Art Schlaftagebuch aufgebaut sind, können durchaus sinnvoll sein. Viele Menschen denken ja nach ein oder zwei schlechten Nächten, es sei alles ganz furchtbar - aber wenn sie zwei Wochen lang ihren Schlaf protokollieren, relativiert sich manches. Es gibt auch Meditationsoder Entspannungs-Apps, die hilfreich sein können. Aber Schlaftracker, die man in der Uhr am Handgelenk trägt, messen im Grunde nicht den Schlaf, sondern nur die Bewegungen. Im Vergleich zu dem, was in einem Schlaflabor geschieht, ist das ein Witz. Aus meiner Sicht ist es auch ein Unsinn, weil man sich mit dieser Kontrolle eines eigentlich unkontrollierbaren, unwillkürlichen Zustands wirklich verrückt machen kann. Meine eigene Schwester hat sich vor fünf Jahren eine Google-Watch gekauft und das ausprobiert. Nach zwei Wochen hat sie mir gesagt: "Dieter, die Uhr sagt mir, ich schlafe so schlecht.""Und, schläfst du schlecht?", habe ich sie gefragt. Und sie sagt: "Nö." So what?
Stimuluskontrolle und Schlafrestriktion
Damit das Schlafzimmer nicht mehr mit Angst und Panik, sondern nur mit Schlaf assoziiert wird, sollen Patienten nach einer gewissen Zeit der Schlaflosigkeit den Raum verlassen. Kürzere Schlaffenster sollen zudem abends Müdigkeit und Schlafdruck erhöhen.