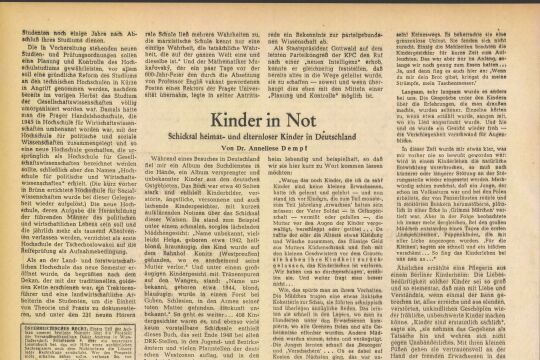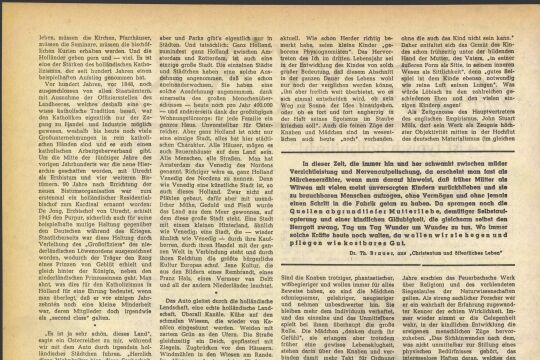Kaum ein Kinderfilm verzichtet darauf, die kleinen Helden und Heldinnen extrem belastenden Situationen in ihrem unmittelbaren Umfeld auszusetzen.
Anfang 2008 jährte sich der Todestag von Wilhelm Busch zum einhundertsten Mal. In zahlreichen Reportagen wurde Buschs Leben und Werk vorgestellt - natürlich gespickt mit Porträts und Zitaten der Figuren seiner Erzählungen. Was dabei vor dem heutigen gesellschaftlichen Hintergrund erstaunt, ist die seelische und physische Brutalität, die sich durch die Handlungen zieht. Martialische Maßnahmen, ja Grauslichkeiten bestimmen das Repertoire der Erziehung wie das zwischenmenschliche Zusammensein im Allgemeinen. Als Gute-Nacht-Lektüre den Kindern vorgelesen, sind die Busch'schen Geschichten bestens geeignet, Albträume auszulösen - jedes noch so strenge moderne Elternhaus nimmt sich dagegen als reinstes Kinderparadies aus.
Waisenschicksale
Diese Brutalität war sicher auch Teil von Wilhelm Buschs Erfolgsrezept (auch kaum ein Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm ist ob der Grausamkeiten gegen Kinder ohne kalten Rückenschauer lesbar) und somit auch ein Merkmal der Unterhaltungskultur des vorigen Jahrhunderts. In den Animationsfilmen der heutigen Zeit widerfahren den "Toms und Jerrys" zwar meist ebenso harte Bandagen - die Macht des Zeichentricks verleiht diesen Figuren jedoch Unverwundbarkeit und ewig sonniges Gemüt. Ein Sturz aus Schwindel erregender Höhe, eine heftige Explosion in unmittelbarer Nähe, ja selbst die auf den kindchenschemagerechten Kopf niedersausende Keule verursachen zwar ein kurzes, in der schmerzverzerrten Grimasse verharrendes Innehalten, doch sogleich durchströmen die Lebensgeister wieder die bedauernswerte Phantasiegestalt und beflügeln sie, die keinen sichtbaren Schaden genommen hat, zur nächsten Aktion.
Derartige Sequenzen haben ohne Zweifel ihren Anteil an der Verharmlosung und Verbreitung von Gewalt - viel subtiler jedoch wirkt ein Handlungselement zahlreicher Kinderfilmproduktionen, vornehmlich US-amerikanischer Provenienz, das schier unverzichtbar zu sein scheint: Die kleinen Helden haben Waisenschicksale zu erleiden. Ein Kniff, der schon den Zuschauern von Klassikern wie Bambi (Erscheinungsjahr 1942) die Tränen in die Augen schießen ließ, als die Kugel des Jägers die Mutter des süßen Rehkitzes tödlich trifft. Ein Schicksal, das bei Kindern wie Erwachsenen zugleich Mitleid und Anteilnahme auslöst und damit jedenfalls die emotionale Bindung an den Filmhelden stützt. So sind etwa auch Mogli, der Junge aus dem "Dschungelbuch", und selbst der mächtige Dschungelkönig Tarzan - Vollwaisen. Dieser Effekt wird noch verstärkt, wenn, wie bei Bambi, das Unglück des Elternverlustes selbst im Film gezeigt wird und die betroffenen Kinder möglichst klein sind. Das putzige Bärenkind in "Bärenbrüder" wird sogar Augenzeuge vom dramatischen Kampf seiner Mutter mit einem jungen Inuk, bei dem die Kontrahenten vom Felsvorsprung in die Tiefe stürzen. In gewissem Sinne Rekordhalter, was die Jugend des Kindes zum Zeitpunkt des Verlustes betrifft, ist dabei der Streifen "Findet Nemo". Der wilden, gierigen Attacke des Raubfisches auf das allerliebste orange-weiße Clownfischpärchen, das gerade das Gelege umsorgt, fällt nicht nur die Brut (eben bis auf Nemo im Larvalstadium), sondern auch Nemos Mama zum Opfer. Ein alleinerziehender Vater bleibt zurück.
Zwischen Identifikation …
Die Großpackung an Papiertaschentüchern ist mittlerweile zum unverzichtbaren Begleiter beim Kinobesuch geworden, steht ein "Kinderfilm" auf dem Programm, denn vom Tod der Mama ist einmal auszugehen. Auch Variationen und Verstärkungen dieser emotionalen Manipulation kommen häufig vor - etwa der Tod oder die Absenz des Vaters (so ist es das Los von Katzenmami Duchesse, ihre drei "Aristocats" als Alleinerzieherin durchzubringen); mitunter wird auch ein mutmaßliches Mitverschulden des Titelhelden am Tod eines Elternteils konstruiert - so etwa in "König der Löwen", wo erst im späteren Verlauf des Films klar wird, dass nicht Löwenkind Simba, sondern sein böser Onkel am Todessturz des Vaters Schuld trägt.
Die Einbettung einer ansonsten durchaus kurzweiligen, spannenden Handlung in eine belastete familiäre Situation ist ja mittlerweile geradezu klassisch - man denke nur an die elternlose, mit schmerzvollen Unterbrechungen bei ihrem Großvater aufwachsende Heidi oder an die in ihrer Villa Kunterbunt völlig auf sich allein gestellte Pippi Langstrumpf oder auch an die Konstellation vom ewig ärmlichen Donald Duck mit seinen drei Neffen und dieser seltsam losen Beziehung zu Daisy. Manchmal wird das bis ins Absurde übersteigert - in "Stuart Little" wird ja tatsächlich eine Maus als Adoptivkind in eine Menschenfamilie aufgenommen -, der Elterntod ist jedoch, so scheint es, ein absoluter Erfolgsgarant.
Was mag in einem Kinderkopf beim Erleben derartiger Situationen vor sich gehen? Sicher dominieren Traurigkeit und Angst. Bei Kindern, denen Ähnliches widerfahren ist, wird vielleicht ein Solidaritätsempfinden ausgelöst, vielleicht aber auch bei manchen das bittersüße Gefühl, dass das eigene Leben zum Glück relativ intakt und unbelastet ist im Vergleich mit dem Schlamassel, das sich da auf der Leinwand präsentiert. Abhängig von der individuellen Erfahrung der Kinder keimt sicher auch die Spannung erzeugende Hoffnung auf einen günstigen Verlauf des Filmheldenschicksals auf. Alles in allem also eine emotionale Situation, die - das macht sie offenbar so interessant und auslösenswert - zugleich Identifikation und Distanz erzielt: Die Kinder sind betroffen und nehmen Anteil, das aber im Bewusstsein, selbst in einer anderen (besseren?) Situation zu sein.
Eine viel profanere Motivation der Drehbuchverfasser, Eltern ihrer kindlichen Hauptpersonen dahinscheiden zu lassen, könnte darin vermutet werden, dass sich dadurch die Möglichkeiten vervielfachen, ebendiese Figuren in gefährliche und damit für die Zuschauer spannende Umstände zu versetzen: Eltern - vor allem in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht - stören einfach. Ihre Präsenz würde es ja kaum zulassen, dass die kleinen Helden den Ungeheuern der Tiefsee, den reißenden Bestien des Dschungels oder den Schrecken des Eises und der Finsternis ausgesetzt werden. Und wenn man schon durch den Plot des Drehbuchs sich nicht beider Eltern entledigen kann, dann ist so ein hilflos und überfordert gezeichneter Vater ein geringeres Hindernis dafür, seinen Schützling in eine Handlung der Extremsituationen zu verwickeln, als eine kluge und umsichtige Mama oder ein ebensolcher Papa. Solche Elternteile hätten nämlich Pinocchio auf seinem Schulweg begleitet oder zumindest für Begleitung gesorgt. Nicht so der angegraut-tapsige Gepetto - und prompt gerät die kleine Holzpuppe in schlechte Gesellschaft und wird von zwielichtigen Gestalten auf Abwege geführt.
… und Distanz
Vergleichsweise selten sind Produkte aus den internationalen Filmwerkstätten, in denen es gelingt, eine unterhaltsame, spannende Geschichte zu erzählen, ohne diese in ein schwieriges soziales Umfeld zu betten. Die Erlebnisse von Lars dem Eisbären oder auch die Episoden aus "Lauras Stern" sind dabei wohltuende Ausnahmen, die aber auch zeigen, dass es einigen Fingerspitzengefühls und Aufwandes bedarf, um unter diesen Umständen einen für Kinder interessanten Film zu gestalten.
Meine achtjährige Tochter Lydia - und in ihrem Auftrag schreibe ich diese Zeilen - findet es jedenfalls "urgemein" und "total blöd", dass in so vielen Filmen die Mami stirbt. Soll ich ausrichten.
Der Autor ist Leiter der Abteilung Stoffbezogener Umweltschutz, Chemiepolitik, Risikobewertung und -management im Umweltministerium.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!