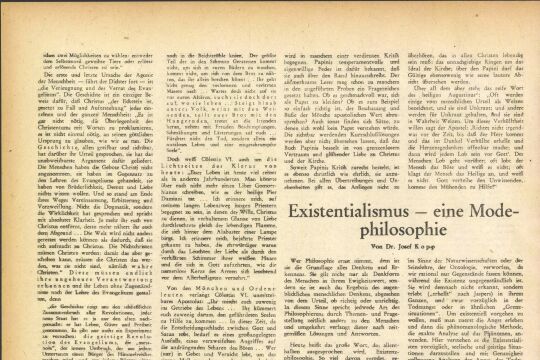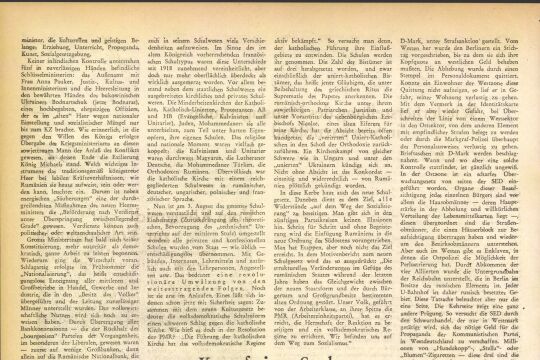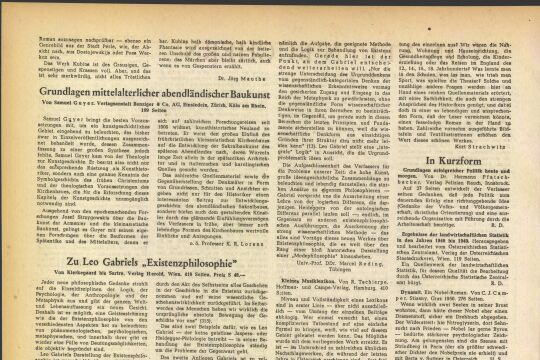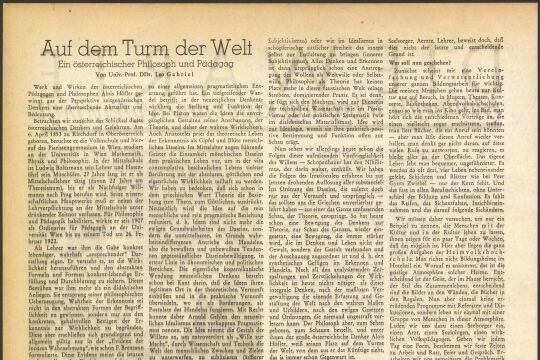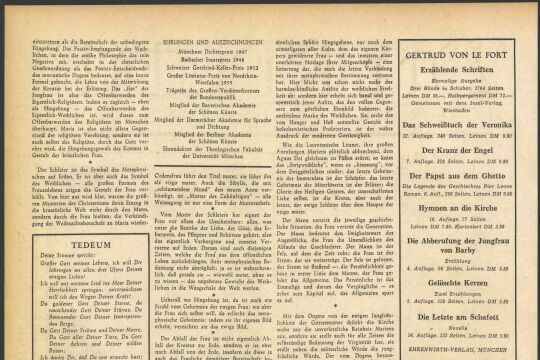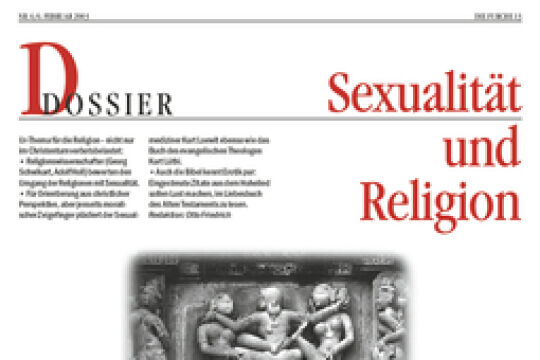Alle Menschen bis heute wurden geboren, aber nicht alle können gebären: Über den Versuch, einen angemessenen denkerischen Umgang mit unserer Anfänglichkeit zu finden. Freude, Ängste, Untersuchungen, Ideologien: Schwangerschaft und Geburt bieten eine Hochschaubahn der Gefühle. Statt neun Monaten "guter Hoffnung" sind nun regelmäßig Entscheidungen angesagt: für oder gegen pränatale Diagnostik, für oder gegen ein "sanftes" Geburtskrankenhaus, für oder gegen Kreuzstich oder Kaiserschnitt. Auch wenn das Geburtsrisiko insgesamt gesenkt werden konnte: Einfacher wurde Gebären sicher nicht. Sein Geheimnis hat dieses elementare Ereignis in jedem Fall bewahrt. redaktion: doris helmberger
Die meisten Denker haben vergessen darüber nachzudenken, dass sie selbst Geborene sind. Oder sie haben ihren Anfang hinter der Idee eines männlich vorgestellten Schöpfergottes verschwinden lassen (vgl. das Hannah-Arendt-Dossier in Furche Nr. 41/06, Seite 23). Dagegen hat man sich hinsichtlich der Gebärfähigkeit lange - mehr oder weniger ausdrücklich - dem antiken Gedanken von der physiologischen Minderwertigkeit des Weiblichen angeschlossen. In seinen naturphilosophischen Schriften bestimmt Aristoteles, der wohl einflussreichste antike Philosoph, das Männliche als das aktiv formende Prinzip, das Weibliche als Materie (von Mater/Mutter), die geformt wird. Schwangerschaft und Gebären sind folglich als passives "Austragen" des männlichen Samens definiert: analog zur Erde, die dem in sie gelegten Samen lediglich Nährstoffe, nicht aber eigene Gestaltungskraft hinzufügt.
Minderwertige Frau?
Zwar hat man diese Sichtweise der Entstehung menschlicher Neuankömmlinge bald als Verkennung der biologischen Tatsachen erkannt. Aber die mit ihr grundgelegte Theorie einer wesensmäßigen Wertdifferenz zwischen Mann und Frau erwies sich dennoch als erstaunlich beständig: Auch wer sich die Theorie vom nur empfangenden Mutterboden nicht ausdrücklich zu eigen macht, kann nämlich die Konsequenzen, die sie für die allgemeine Auffassung der Geschlechterverhältnisse und damit der conditio humana hat, übernehmen und weitergeben.
Schon Aristoteles selbst hat die angeblich in der Natur selbst begründete Lehre von der weiblichen Minderwertigkeit auf die Ordnung des Zusammenlebens übertragen: In seiner Politik bestimmt er das Männliche als "das Bessere und das, was regiert", entsprechend Weiblichkeit als "das Schlechtere und das Regierte". Vor allem die christliche Scholastik hat diese Werthierarchie ausgebaut zu einer zweigeteilten symbolischen Ordnung, derzufolge Weiblichkeit sich durch besondere Nähe zur "sündigen" körperlich-animalischen Seite des Menschseins auszeichnet. Das Ganze der Menschenwelt stellte man sich folglich zweigeteilt vor: Einer höheren, geistig-göttlich-rational-männlichen Sphäre ist eine niedrige weiblich-körperlich-kontrollbedürftige Sphäre untergeordnet. Heute weiß zwar jede Primarschülerin, dass Schwangersein und Gebären mehr und anderes bedeutet als das passive Wachsenlassen eines im männlichen Samen bereits vollständig ausgebildeten Keimes. Dennoch ist zum Beispiel die Vorstellung noch nicht verschwunden, "Gleichberechtigung" bedeute die möglichst perfekte Anpassung aller an herrschende Normen angeblich gelungener Männlichkeit.
Männlicher Gebärneid?
Es ist nicht erstaunlich, dass Frauenbewegungen der patriarchal verzerrten Sicht des Gebärens zunächst theoretische Entwürfe entgegenstellten, mit denen sie die Vorstellung vom minderwertigen gebärfähigen Geschlecht als Projektion entlarvten. Mehr noch: Oft kehrten sie die Geschlechterhierarchie um. In den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts war daher viel von mangelhafter Männlichkeit und überlegener Weiblichkeit die Rede. Tatsächlich lassen sich in der westlichen Geistesgeschichte durchaus Anhaltspunkte finden, die die These stützen, männliches Philosophieren sei über weite Strecken Kompensation der eigenen Gebärunfähigkeit, erwachse also letztlich einem "Gebärneid". In ihrem Buch Die symbolische Ordnung der Mutter fasst Luisa Muraro die erneuerte Sicht kritischer Denkerinnen auf die von Männern geprägte, nur vermeintlich allgemein maßgebliche Tradition zusammen: "Wie wir wissen, sind die Philosophen von der Figur und von dem Werk der Mutter inspiriert worden. Sie drehen jedoch die Reihenfolge um und stellen das Werk der Mutter als eine Kopie (und nicht selten als eine schlechte Kopie) des eigenen Werkes dar. Darin sind sie Komplizen des Patriarchats, das den Vater als den wahren Schöpfer des Lebens darstellt."
Dass dieser grundlegenden Einsicht zunächst Überhöhungen der weiblichen Gebärfähigkeit folgten, die in der Theologie zum Beispiel die Gestalt einer intensiven Beschäftigung mit weiblichen, insbesondere mütterlichen Gottheiten annahmen, ist nichts als logisch. Allerdings stellte sich bald heraus, dass ein Anknüpfen an die Tradition festgelegter "Geschlechtscharaktere" unter umgekehrtem Vorzeichen das Dilemma nur unzureichend löst. Zumal die Idee, beim Gebären handle es sich gewissermaßen um eine göttliche Fähigkeit, realen Frauen in ihrem Umgang mit Schwangerschaft, Gebär-und Nährarbeit nicht hilfreicher zu sein scheint als die herkömmlichen Abwertungen.
Wie lässt sich aber das Gebären so auf den Begriff bringen, dass es weder als Gottähnlichkeit noch als Minderwertigkeit erscheint, sondern - zumindest näherungsweise - als das, was es ist? Zunächst wäre wohl ausdrücklich anzuerkennen, dass die Menschheit, indem sie sich denkerisch allzu lange mit erwachsener Mannheit verwechselt hat, bis heute nur einen Bruchteil dessen gedacht hat, was begrifflich zu erfassen sie fähig und was zu denken lebensförderlich wäre.
Gebären neu denken
Es stimmt deshalb zuversichtlich, dass in jüngster Zeit auch einige Männer begonnen haben, Abstand zu nehmen von der Praxis, "das Männliche als das Allgemeine, das Weibliche aber als das Besondere zu statuieren" (vgl. den Sammelband Mannsbilder), dass sie sich stattdessen der - durchaus komplizierten - Aufgabe stellen, "die eigenen männlichen Perspektiven nicht mehr als universal gültige auszugeben, sondern sie als partikulare zu begreifen, sie dann aber - als partikulare - in doppeltem Wortsinn: zu behaupten", wie Jürgen Ebach in Mannsbilder meint. Erst wer den über Jahrhunderte festgehaltenen Allge-
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!