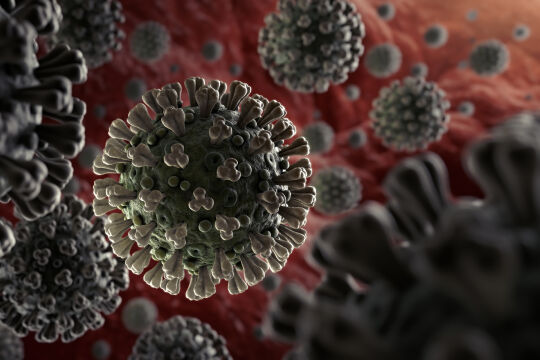"Stiefkinder der Medizin"
Der Behandlung von Schmerzen werde zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, was fatale Folgen haben kann, kritisierten Schmerzexperten bei einem Kongress in Graz.
Der Behandlung von Schmerzen werde zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, was fatale Folgen haben kann, kritisierten Schmerzexperten bei einem Kongress in Graz.
Der Schmerz ist ein starkes Warnsignal unseres Körpers, es ist unmöglich, Schmerzen zu ignorieren. Jeder Mensch kann zwar gewisse Bewältigungsstrategien gegen Schmerzen entwickeln, doch manchmal werden Schmerzen so übermächtig, dass ein Arzt aufgesucht werden muss. Der Schmerz ist das häufigste Symptom, weshalb ein Patient in die Ordination kommt. Es sei daher ein zentrales Anliegen der Medizin, Schmerzen adäquat zu behandeln. Das war die zentrale Aussage des Grazer Schmerzkongresses Ende April zum Thema "Neues aus der Welt des Schmerzes".
Mediziner unterscheiden prinzipiell zwischen akuten und chronischen Schmerzen. Der akute Schmerz ist ein wichtiger Hinweis auf eine Erkrankung. "Der akute Schmerz findet heute in den Spitälern deutlich mehr Aufmerksamkeit durch Ärzte als dies noch vor wenigen Jahren der Fall war. Trotzdem würde er noch mehr Augenmerk verdienen", betont Universitätsprofessor Werner List, Vorstand der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin des Landeskrankenhauses (LKH) Klagenfurt. In Schwerpunktkrankenhäusern wäre die Einführung eines Schmerzdienstes rund um die Uhr eine unabdingbare Notwendigkeit.
Akute Schmerzen, etwa nach Operationen, haben Ärzte heute durch innovative Medikamente gut im Griff. Hingegen stellt die Behandlung und Therapie von chronischen Schmerzen weiterhin ein Problem dar. Der chronische Schmerz kann selbst zur Erkrankung werden, wenn er über Monate anhält (siehe auch Kasten).
"Das fehlen einer organischen Schmerzursache führt zu Missverständnissen bei Arzt und Patient", so List über chronische Schmerzen. Auf der Suche nach einer körperlichen Erkrankung läuft der Patient von Arzt zu Arzt, er betreibe ein Doktor-shopping. "Gerade diese Patienten sind auf Grund der diagnostischen und therapeutischen Schwierigkeiten Stiefkinder der Medizin."
Schmerztherapie sei eine umfassende Herausforderung und sollte eine der vordringlichsten Aufgaben von Ärzten sein, meint auch Walter Ekhart, anästhesiologischer und medizinischer Leiter des allgemeinen öffentlichen Krankenhauses Güssing. "Aber bei allem medizinischen Fortschritt ist es heute noch ein Problem geblieben, von Schmerzen befreit zu werden." Da Schmerz ein subjektives Phänomen ist, sei entscheidend, was der Patient empfinde, und nicht, was der Helfer befindet.
Schmerzen können das Persönlichkeitsbild eines Menschen verändern, Angst, Depression und Unsicherheit auslösen. Diese wiederum wirken sich oft negativ auf das Schmerzerleben der Patienten aus. So führe etwa eine gesteigerte Angst vor Schmerzen nach der Operation zu einem weit erhöhten Verbrauch an Schmerzmittel, berichtet Martin Enge von der Universitätsklinik für medizinische Psychologie und Psychotherapie im LKH Graz. Wenig überraschend ist für den Psychologen, dass eine langfristige Schmerzbehandlung erfolgreicher ist, wenn die familiäre Unterstützung gegeben ist.
In 80 Prozent der Fälle ist es heute möglich, Schmerzen zumindest zu lindern. Rund 2,7 Millionen Packungen Schmerzmittel verordnen Österreichs niedergelassene Ärzte pro Jahr. An erster Stelle der Indikationen stehen dabei Rücken- und Kreuzschmerzen, gefolgt von Kopfschmerzen und Gelenksschmerzen. Eine häufige Folge davon sind Frühpensionierungen. "In den letzten Jahren ist die Zahl der Frühpensionierungen von 20 auf 40 Prozent gestiegen", so Ekhart. Daher sei die Wiedereingliederung von Menschen mit chronischen Schmerzen in den Arbeitsprozess ein übergeordnetes Ziel der Schmerztherapie. Man könne annehmen, so der Mediziner, dass durch eine verpasste Schmerztherapie alleine bei Patienten mit Rückenschmerzen ein volkswirtschaftlicher Verlust in Milliardenhöhe entstehe. Das sei aber auch ein ethisches und juristisches Problem, denn fehlende Schmerztherapie sei als Körperverletzung zu betrachten, beziehungsweise eine Unterlassung der Behandlungspflicht. "So ist etwa das viel geübte Ziehen aller Zähne bei Kopfschmerzen ein Zeichen einer Hilflosigkeit, Schmerzen zu bekämpfen und in dieser Form eigentlich abzulehnen."
Erst am Anfang Wie sieht es allerdings in der täglichen Krankenhauspraxis aus? Ist schmerzfreie Pflege überhaupt möglich? "Schmerzfreie Pflege kann möglich sein, wenn Kooperation und Kommunikation im Team gegeben sind," ist Ulrike Resch von der Intensivstation der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin des LKH Graz, überzeugt. Für die Krankenschwester ist die Integration des Patienten in eine ganzheitliche Betrachtung die wichtigste Voraussetzung für eine schmerzfreie Pflege.
Resch unterstreicht dabei die oft vernachlässigte Rolle des Pflegepersonals bei der Betreuung der Patienten. "Das Pflegepersonal kennt den Patienten besser. Wir haben einen viel direkteren Zugang. Der Kontakt und das Vertrauen, das zwischen uns und den Patienten aufgebaut wird, das ist beim Arzt nicht in dem Maße gegeben. Pflegepersonen sind das Sprachrohr der Patienten. Es geht um Fürsorge, Verantwortung, Respekt und Wissen."
Weitere wichtige Voraussetzung für eine schmerzfreie Pflege sind für Resch der individuelle und gezielte Einsatz von Medikamenten, die Beachtung von Nebenwirkungen, zusätzliche pflegerische und physiotherapeutische Maßnahmen und auch die Anwendung von Komplementärmedizin. "So vielfältig wie die Schmerzdiagnostik ist, sind auch die therapeutischen Maßnahmen", bestätigt Krankenhausleiter Walter Ekhart.
Hoffnung geben Adolf Rudorfer von der Schmerzambulanz der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin vom LKH Graz hebt die Notwendigkeit und Organisation einer Schmerzambulanz hervor: "Der chronische Schmerz beeinträchtigt die Vitalität eines Patienten, es kommt zur Hoffnungs- und Ratlosigkeit, wenn Ärzte nicht in adäquater Form helfen können, sowohl beim Arzt als auch bei den Patienten und deren Angehörigen" Die Zielsetzung einer interdisziplinären Schmerzambulanz sollte sein, genügend räumliche und personelle Voraussetzungen zu schaffen, damit diese "Pioniere in einem Klima des Wohlwollens" arbeiten können. Rudorfer: "Wir sind sicherlich erst am Anfang einer hoffentlich segensreichen Entwicklung. Wir haben eben erst gelernt, akute Schmerzen zu behandeln. Bei chronischen Schmerzen haben wir derzeit unser Werkzeug von den Neurologen und Psychiater ausgeliehen." Hier sei noch viel Entwicklungsarbeit notwendig.
Zwar wurden bereits in allen Landeshauptstädten Schmerzambulanzen eingerichtet, doch, kritisiert Rudorfer, gebe es derzeit viel zu wenig Personal, es fehle an allen Ecken und Enden an Ausstattung und Zeit um auf den großen Andrang auf Schmerzambulanzen adäquat reagieren zu können. Tausende Menschen erkranken jährlich an Krebs (Tumorschmerzen) und chronischen Schmerzen.
Daher sollte die Behandlung akuter, postoperativer Schmerzen nicht Angelegenheit einer Schmerzambulanz sein. Rudorfer: "Dafür ist einfach keine Zeit. Ein chronifizierter Schmerz braucht derart viel Zeit und Zuwendung, Diagnostik und Einfühlungsvermögen, dass nicht daneben noch die postoperative Schmerztherapie mitbetreut werden kann. Hier sollte ein eigener Akutschmerzdienst installiert werden, damit sich die Schmerzambulanz auf chronifizierte Schmerzbilder und auch auf die sehr aufwendige Krebsschmerztherapie konzentrieren kann." Da Schmerzbilder sehr differenziert und schwierig zu diagnostizieren sind, brauche es das Zusammenwirken vieler Fachdisziplinen, um es auf den Schmerzpatienten zu fokussieren.
Das primäre Ziel einer Schmerzambulanz ist für Rudorfer, den Menschen wieder Hoffnung zu geben. "Wir können den Patienten das Gefühl vermitteln, dass ein Mensch existiert, der versucht zu erfassen, in welch lebensbedrohlicher Situation er sich befindet. Wir haben unser Ziel erreicht, wenn es uns gelingt, den Patienten wieder in die Familie, Gesellschaft und das Berufsleben zu reintegrieren. Und hier beginnt sich auch der Kostenfaktor einer Schmerzambulanz zu rechnen", betont Rudorfer. Menschen, die in eine Schmerzambulanz kommen, suchen in erster Linie das Gespräch, jemand, der ihnen zuhört.
Sterben im Spital Renate Skledar, Patientenombudsfrau des Landes Steiermark wiederrum kritisiert, dass sie zunehmend den Eindruck bekomme, die Patienten werden mit ihren Schmerzen alleine gelassen. "Es wird ihnen beispielsweise nicht gesagt, wohin sie sich mit chronischen Schmerzen wenden und was sie machen können. Ich habe auch den Eindruck, dass nicht jene Schmerzen behandelt werden, die der Patient angibt, sonder jene, die der Arzt glaubt, dass sie vorherrschen. Nicht nur, dass man das ganze ignoriert, sondern es werden auch Schmerzwarnsignale nicht beachtet." Oft stehen Patienten und Angehörige den Schmerzwarnsignalen ohnmächtig gegenüber, da Schmerzen von Ärzten beispielsweise als Neurosen abgetan werden. "Es ist eine Demütigung des Patienten, wenn man ihn nicht ernst nimmt," so die Patientenombudsfrau.
Auf eine Million stationärer und ambulanter Patienten in der Steiermark kämen bereits immerhin 160 Anträge auf Schmerzensgeld pro Jahr. Die steigende Unzufriedenheit der Patienten könne auch nicht durch Spitzenleistungen der Medizin ausgeglichen werden. "Der Mensch will gesamtheitlich gesehen werden," so Skledar.
Ein wichtiges Thema der Zukunft für die Schmerztherapie sei das Sterben im Krankenhaus, meint Walter Ekhart vom Krankenhaus Güssing. Bereits 70 Prozent der Menschen sterben in den Spitälern, 20 Prozent in Alten- oder Pflegeheimen. "Viele Ärzte stehen dem Sterben aber hilflos gegenüber, da sie in der Ausbildung nie gelernt haben, damit umzugehen."
Das System erziele Superheiler, die das Problem des Sterbens lieber verdrängen, weil es nicht zur Hebung ihres Images beiträgt. "Wenn der Arzt merkt, dass er verloren hat, gibt er oft auf, zieht sich zurück und verlässt den Schauplatz, weil er denkt, dass es keine Therapie mehr gibt," so Ekhart. Das stimme aber so nicht, da mit einer angepassten Schmerztherapie die Lebensqualität der verbleibenden Zeit entscheidend verbessert werden könne. "Wir Ärzte müssen uns daher mehr denn je mit dem Sterben im Krankenhaus auseinandersetzen, denn das Sterben wurde zu einer medizinischen Angelegenheit und somit dem Arzt und der Krankenschwester übertragen. Der Sterbende hat vor allem das Recht auf Schmerzfreiheit und das soll der Arzt nicht als eine zu vernachlässigende sondern als hochqualifizierte Tätigkeit ansehen." Daher sollte auch der zukünftigen Entwicklung Rechnung getragen werden, in dem mehr Hospizbetten angeschafft werden - ein Gebot der Stunde, meint Ekhart.
Der Wunsch der Menschen, bis ins hohe Alter mobil und schmerzfrei zu sein, werde wohl auch in Zukunft ein Wunschtraum bleiben. Aber, so Ekhart, das Ziel sollte zumindest sein, Schmerzen zu lindern und somit die Lebensqualität zu heben. "Das sollte uns Ärzten auch in Zukunft ein vorrangiges, medizinisches, ethisches und moralisches Anliegen sein."
ZUM THEMA Schmerz verändert die Nervenzelle Akuter Schmerz kann chronisch werden. Dies berichtete der international anerkannte Schmerzexperte, Universitätsprofessor Walter Zieglgänsberger vom Max-Planck-Institut in München, in seinem Vortrag beim Grazer Schmerzkongress. Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass sich bei anhaltenden Schmerzimpulsen die Nervenzellen dauerhaft verändern. Der Schmerz wird sozusagen im Genom der Nervenzelle festgeschrieben. Sie bildet mehr Rezeptoren für die Schmerzwahrnehmung aus. Es kann dadurch Schmerz wahrgenommen werden, obwohl kein körperlicher Grund auszumachen ist, der Schmerz wird chronisch.
Daher, so Zieglgänsberger, muss Schmerz bei seinem Entstehen so früh wie möglich ausgeschaltet werden, und das gründlich. Dadurch wird verhindert, dass sich die Struktur der Nervenzelle ändert. Ist der Schmerz bereits chronisch, wird die Therapie weitaus langwieriger. Doch können Nervenzellen mit einer Schmerztherapie auch wieder in ihren Normalzustand gebracht werden.
Ein weiteres Ergebnis: Schmerzreize erfassen nicht nur lokale Systeme, sondern immer das gesamte Zentralnervensystem. Ein Extrembeispiel dafür sei, so Zieglgänsberger, der sogenannte Phantomschmerz: "Da konnten sich Mediziner früher überhaupt nicht vorstellen, was los war." Heute gibt es Erklärungsansätze. In der Schmerzmatrix laufen dynamische Umstrukturierungsvorgänge ab, die auch im Gehirn festgeschrieben werden.
"Meist ist es eine Bankrott-Erklärung von Ärzten zu sagen, Schmerzen wären psychisch überlagert. Es gibt sehr wohl Erklärungen, warum Patienten, die irgendwo eine Entzündung haben, an einer anderen Stelle Schmerzen empfinden können," so der Schmerzexperte. "Man muss hier sehr vorsichtig sein. Ich denke, es ist sehr viel weniger eingebildet als wir so üblicherweise annehmen." kun.


















































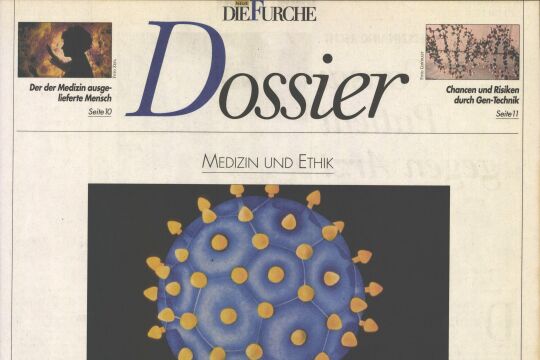




























.jpg)