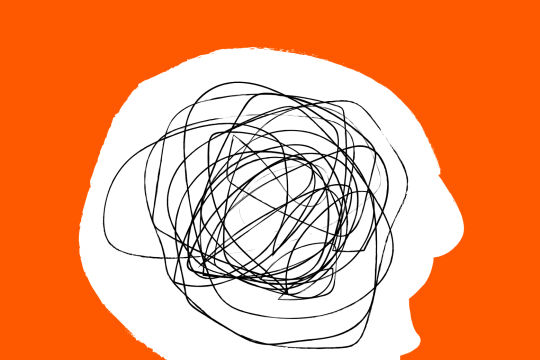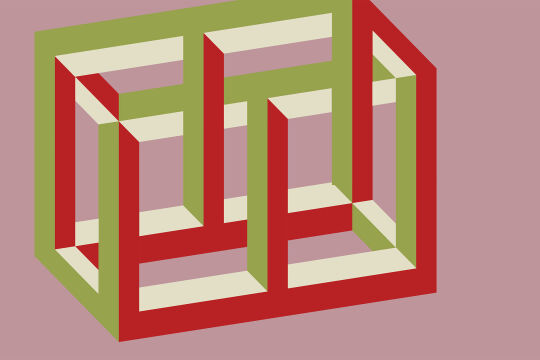Unterstützung bei Behinderung: "Warum schreit da niemand?"
Zehn Jahre lang war Klaus Vavrik Präsident der Liga für Kinder-und Jugendgesundheit. Nun leitet er ein Diagnose-und Therapiezentrum in Wien-Favoriten. Ein Gespräch über Wartelisten, fehlende Dolmetscher, ein wackelndes Autismuszentrum und Geldvernichtung durch Chaos.
Zehn Jahre lang war Klaus Vavrik Präsident der Liga für Kinder-und Jugendgesundheit. Nun leitet er ein Diagnose-und Therapiezentrum in Wien-Favoriten. Ein Gespräch über Wartelisten, fehlende Dolmetscher, ein wackelndes Autismuszentrum und Geldvernichtung durch Chaos.
Als Gründer und langjähriger Präsident der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit hat Klaus Vavrik oft auf gravierende Versorgungsmängel hingewiesen. Auch heute, als ärztlicher Leiter des Ambulatoriums Fernkorngasse in Wien-Favoriten, kämpft er mit fehlenden Ressourcen. Jährlich werden über 700 Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen oder Verhaltensauffälligkeiten in diesem "Zentrum für Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie" betreut - interdisziplinär und auf Kassen- sowie Landeskosten. Der Bedarf geht freilich weit darüber hinaus, erklärt der Kinderarzt sowie Kinder- und Jugendpsychiater im FURCHE-Gespräch.
DIE FURCHE: Herr Vavrik, das Angebot Ihres Zentrums reicht von fachärztlicher Diagnostik über psychologische Testung, Physio-, Psycho-und Ergotherapie bis zu Logopädie, Musiktherapie und computergestützter Kommunikation. Nimmt die Zahl Ihrer Patienten zu?
Klaus Vavrik: Sie kann nicht zunehmen, weil die Kapazität limitiert ist. Und genau das ist ein Problem: Jedes Jahr haben wir Verhandlungen mit unseren Geldgebern (Fonds Soziales Wien und Wiener Gebietskrankenkasse, Anm.), aber weil die Lohnsteigerungen nie komplett abgegolten werden, haben wir einen schleichenden Stundenverlust. De facto gibt es Wartezeiten von vier bis sechs Monaten auf einen Arzttermin und von bis zu einem Jahr auf Therapieplätze. In dieser Zeit sind wertvolle Entwicklungsfenster oft vorbei, Sprach- oder Gehstörungen sollen sofort behandelt werden. Wir bräuchten also deutlich mehr Kapazitäten statt weniger. Sogar das dringend nötige Autismuszentrum, das unser Träger-Verein "Verantwortung und Kompetenz für besondere Kinder und Jugendliche" seit zwei Jahren im Auftrag von Kasse und Fonds plant und vorbereitet, ist wieder in der Schwebe.
DIE FURCHE: Warum?
Vavrik: Weil die Finanzierungszusage des Fonds bis dato unsicher ist. Und selbst, wenn diese doch noch kommen sollte, kann die von der Regierung angekündigte Ausgabenbremse bei den Sozialversicherungen dazu führen, dass die aktuelle Zusage der Kasse dann wieder nicht hält. Das wäre ein Drama: Denn in der Großstadt Wien gibt es keine einzige Institution, die Kinder mit Autismus adäquat, also hochfrequent und nicht nur eine Stunde pro Woche, voll kassenfinanziert behandelt. Dabei nehmen die Fälle, mit denen wir konfrontiert werden, zu. (Anmerkung: 2020 - mitten während der Pandemie - konnte das Zentrum doch noch eröffnet werden. Es befindet sich im Ambulatorium Sonnwendviertel in Wien-Favoriten.)
DIE FURCHE: Welche Familien sind es insgesamt, die zu Ihnen kommen?
Vavrik: Es sind häufig sozial schwache Familien. Das liegt einerseits an unserem Standort im 10. Wiener Bezirk, aber auch daran, dass es generell im niedergelassenen Bereich lange Wartezeiten gibt - außer, man kann etwas privat mitfinanzieren. Aber viele Familien können sich einen Selbstbehalt von 40 bis 50 Euro pro Einheit für eine Ergo- oder Psychotherapie nicht leisten. Auch Familien mit Migrationshintergrund sind häufig, wobei der Dolmetschbedarf immer bunter wird und sehr professionell geleistet werden muss. Es darf jedenfalls nicht sein, dass etwa ein Kind der Familie übersetzt, wenn man dem Geschwisterkind eine tragische Diagnose mitteilen muss oder es zwischen Vater und Mutter schwere Konflikte gibt.
DIE FURCHE: Apropos Eltern: Was bräuchten diese angesichts eines schwerkranken Kindes besonders? Und was können Sie ihnen bieten?
Vavrik: Oft ist es für Eltern schwer, die Diagnose ihres Kindes anzunehmen. Wir behandeln etwa Kinder mit Muskelerkrankungen auch mit letztlich letaler Diagnose. Manche dieser Kinder werden knapp über 20 Jahre alt, andere sterben mit zwei, drei Jahren. Wenn Eltern das in ihrer Trauer nicht wahrhaben wollen, sind das sehr schwierige Prozesse. Hier wäre eine intensive Elternberatung sehr wichtig, aber der Geldgeber bezahlt offiziell nur jene Stunde, in der auch das Kind da ist - was hier aber gerade nicht der Fall sein sollte. Umso wichtiger wäre es, die Mitbetreuung der Familie in jeder Kinder-Therapie formal und umfassend zu inkludieren.
DIE FURCHE: Kommen wir zur psychischen Gesundheit - und weiten wir den Blick auf ganz Österreich: Laut einer Studie von Medizinuni Wien und Ludwig Boltzmann Gesellschaft haben ein Viertel aller Zehn- bis 18-Jährigen (also 170.000 junge Menschen) ernsthafte psychische Probleme, etwa 100.000 bräuchten fachärztliche Betreuung. Wie ist hier die Versorgung?
Vavrik: Sie hat sich schon etwas verbessert - auch auf Druck der Kinder-Liga: In Wien gibt es heute fünf Kassenstellen für Kinder- und Jugendpsychiatrie, ebenso in Niederösterreich. Auch im Bereich der Frühen Hilfen und der Kinder-Rehabilitation wurden erste Schritte gesetzt. Aber im internationalen Vergleich ist es noch lange nicht ausreichend.
DIE FURCHE: Und wie sieht es mit der Versorgung insgesamt aus?
Vavrik: Insgesamt fehlen in Österreich 70.000 bis 80.000 Therapieplätze. Die Krankenkassen, die das anfangs angezweifelt haben, kommen in einer internen Studie sogar auf 125.000. Ich finde es einen Skandal, dass Österreich für seine Kinder nicht ausreichend sorgt. Und genauso skandalös finde ich, dass immer mehr Kinder, derzeit über 400.000, unter Armutsbedingungen leben. Wir wissen längst, dass Armut krank macht -und dass umgekehrt Krankheit arm macht, weil Therapien teuer sind. Warum solche Zahlen nicht aufrütteln, verstehe ich nicht.
DIE FURCHE: Aufgerüttelt hat zuletzt der Fall eines zwölfjährigen steirischen Buben mit einer seltenen Muskelerkrankung (spinale Muskelatrophie), dem von der Spitalsholding KAGES ein teures Medikament ("Spinraza") verweigert wurde. Wie bewerten Sie den Fall?
Vavrik: Das ist ethisch eine sehr heikle Frage. Das erwähnte Medikament wirkt nicht bei allen Kindern gleich, aber im Alter dieses Buben deutlich weniger gut. Die Kosten sind mit circa 500.000 Euro Jahresbudget sehr hoch. Ich habe selbst bei einem Kind die Situation erlebt, dass zwar die 500.000 Euro für die Spritzen bezahlt werden, weil es über das Krankenhausbudget abgerechnet wird, aber die 40 Euro Selbstbehalt für die Physiotherapie zu Hause, die dabei dringend notwendig ist, nicht. Das kann nicht sein!
Es geht hier leider auch um die grundsätzliche Verteilungsfrage von Ressourcen in der Medizin, und die ist sehr heikel: Mit den oben genannten Summen könnte man für viele andere Kinder die Therapieplätze zahlen. Man soll das keinesfalls gegeneinander ausspielen, aber: Wo ist hier das größere Recht? Wir haben oft nicht einmal das Geld, einem Kind mit Sprachproblem eine Logopädie zu bezahlen. Warum schreit da niemand? Weil es keine medial gut verwertbaren Einzelfälle sind. Ich denke, die Basisversorgung muss primär einmal gesichert sein.
DIE FURCHE: Zur Basisversorgung gehört für viele auch ein Ende des Behördendschungels - in Form eines "One-Stop-Shop"-Prinzips, wie es auch im neuen Regierungsprogramm geplant ist.
Vavrik: Diese Idee steht schon seit zehn Jahren in vielen Strategiepapieren. Dass es das nicht schon längst gibt, ist ein gesundheitspolitisches Versäumnis. Für Menschen, die hohe Managementqualitäten und viel Zeit im Leben haben, ist es vielleicht machbar, sich die nötigen Hilfsmittel zu organisieren, aber für jene, die unter Druck stehen und ein krankes Kind haben, ist es oft nicht zu schaffen. Es bräuchte darüber hinaus ein wirkliches Case-und Care-Management im Sinn eines Gesamtbehandlungsplanes. Man muss ja auch klären, was Kindergarten und Schule mit dem Kind therapeutisch tun, was der Kinderarzt verschreibt und was das Spital für Befunde erhoben hat. Das Wichtigste ist, dass diese Kommunikations- und Koordinationsarbeit endlich eine Struktur bekommt und auch finanziert wird.
DIE FURCHE: Die Politik würde wohl kontern, dass man sich das derzeit leider nicht leisten könne.
Vavrik: Aber es würde im Gegenteil enorme Kosten sparen, wenn man die oft nicht abgestimmten Doppel- und Dreifachbetreuungen reduziert. Wir in unserem Zentrum haben deshalb etwa einen orthopädischen Nachmittag eingeführt, wo Orthopäde, Physiotherapeut, Schuhmacher und Orthotechniker gemeinsam mit der Familie die Therapie festlegen. Dieser eine Moment ist nicht billig, aber wenn man das unkoordiniert macht, wo dann oft auch das Ergebnis nicht passt, ist es noch viel teurer.













































































.jpg)