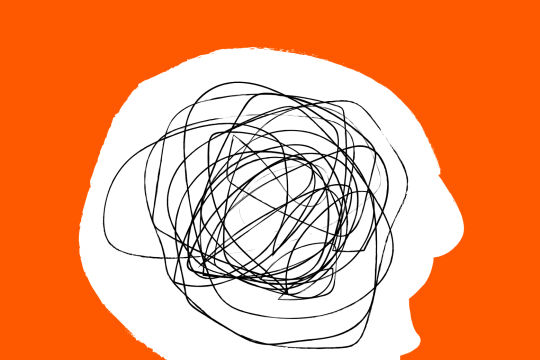Wirtschaftsminister Martin Bartenstein plant die Einführung einer "Sterbekarenz". Ob sich auch Einkommensschwache diese Auszeit leisten können sollen, wird gerade verhandelt.
Von einem "Meilenstein" war die Rede, mancherorts sogar von einem europäischen "Quantensprung": Nach langen und zähen Verhandlungen hatten die vier Parlamentsparteien am 6. Dezember in ungewohnter Einigkeit "Österreichs Antwort auf das Eu-thanasiegesetz in den Niederlanden" formuliert: Sterbebegleitung statt aktive Sterbehilfe wurde gefordert, bessere Palliativmedizin statt tödliche Pillen. Zugleich wurden Sozialminister Herbert Haupt (FPÖ) und Wirtschaftsminister Martin Bartenstein (ÖVP) aufgefordert, ein Freistellungs-Modell für die Begleitung sterbender Angehöriger zu erarbeiten - samt arbeits- und sozialrechtlicher Absicherung.
Und die beiden arbeiteten schnell: Zwei Wochen nach dem einstimmigen Entschließungsantrag im Parlament präsentierte Bartenstein den Gesetzesentwurf zur Einführung einer "Sterbekarenz". Alle Arbeitnehmer sollten demnach drei, im Bedarfsfall bis zu sechs Monate lang Rechtsanspruch auf eine Voll- oder Teilzeit-Karenz erhalten. Während dieser Zeit wären sie unkündbar; Kranken- und Pensionsversicherung würden aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung finanziert. Schließlich könnten nicht nur Ehegatten, Eltern, Kinder und Enkelkinder, sondern auch Lebensgefährten, Geschwister, Onkel, Tanten, Neffen, Nichten, Adoptiv- und Pflegekinder Anspruch auf diese Leistung erheben.
Existenzielle Lösung
Der sozialpolitische Quantensprung des Wirtschaftsministers gestaltete sich freilich weniger epochal als vielerorts erhofft: Bemängelt wurde vor allem die fehlende "existenzielle Absicherung" der Karenzierten. "Was Minister Bartenstein vorgelegt hat, ist ein gelungener erster Schritt", resümiert der Wiener Caritas-Direktor Michael Landau. "Die Karenz zur Sterbebegleitung darf aber nicht zum Privileg werden, das man sich leisten können muss." Ähnlich kritisch klingen die Anmerkungen des ÖGB: "Damit wird es wieder so sein, dass Frauen, die leider in vielen Bereichen noch immer weniger verdienen, zu Hause bleiben," befürchtet Frauenvorsitzende Renate Csörgits. Schon jetzt seien die Aufgaben höchst ungleich verteilt: "Wenn in einer Familie Bedarf entsteht, sind die Pflegenden zu 90 Prozent Frauen."
Für Verbesserungsvorschläge drängt jedenfalls die Zeit: Am 11. Februar endet die Begutachtungsfrist des Gesetzesentwurfs. Sind die Hürden Ministerrat und Parlament erst einmal genommen, könnte die neue Regelung nach den Vorstellungen Bartensteins bereits im Juli 2002 in Kraft treten.
Entsprechend hektisch wird um Lösungen in der Finanzierungsfrage gerungen: So kommt es dieser Tage zwischen Sozialminister Haupt und der Caritas zu einem weiteren Annäherungsversuch. Von Seiten des Ministeriums gibt man sich betont kooperativ: Denkbar sei entweder eine Fondslösung oder die Vergabe von zinsenfreien Krediten zur Überbrückung des Einkommensausfalls. Gerade das Kreditmodell führt aber nach Meinung von Caritas-Präsident Franz Küberl nicht zum Ziel. "Wir gehen davon aus, dass die meisten Leute nur Teilzeitkarenz - und damit ohnehin kein Karenzgeld beanspruchen. Nötig wäre es aber bei Leuten, die bei Teilzeitkarenz unter das Existenzminimum fallen. Doch die können einen Kredit erst recht nicht zurückzahlen." Von Seiten der Caritas wird vielmehr eine Finanzierung aus Mitteln der Pensionsversicherung, der Arbeitslosenversicherung, der Krankenversicherungsträger (vergleichbar dem Wochengeld) oder des Familienlastenausgleichsfonds angeregt. Nimmt ein Arbeitnehmer eine (seltene) Vollzeitkarenz in Anspruch, wäre für Küberl eine Zahlung bis zur Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes (630,92 Euro/8.681,65 Schilling) denkbar.
Die große Unbekannte bei sämtlichen Hochrechnungen ist und bleibt jedoch die Zahl der Leistungsbezieher. Werden österreichweit pro Jahr rund 85.000 Todesfälle verzeichnet, so rechnet man im Wirtschaftsmi-nisterium mit 15.000 Angehörigen, die von der neuen Möglichkeit zur Sterbebegleitung Gebrauch machen könnten. Nicht nur die Höhe der Zuzahlung, auch die Reaktionen des Umfelds werden die Bereitschaft beeinflussen, dieses Angebot anzunehmen oder nicht: "Es wird an der Körpersprache von Arbeitgebern und Kollegen, Verwandten und Freunden liegen, ob sich jemand dafür entscheidet," glaubt Caritas-Präsident Küberl. Herrscht über diesen Punkt Unklarheit, so ist der mehrheitliche Wunsch der Österreicher, die letzten Stunden in den eigenen vier Wänden zu erleben, unbestritten: 81 Prozent wollen zu Hause sterben. Tatsächlich verbringen zwei Drittel die letzte Etappe ihres Lebens im Spital oder Pflegeheim.
Missliebiger Begriff
Wo auch immer gestorben wird: Das Karenzmodell des Wirtschaftsmi- nisters soll es Angehörigen leichter machen, da zu sein. Keineswegs handle es sich dabei um eine Auszeit zur Pflege, betont die Caritas, sondern zur Begleitung. Deshalb und wegen der "nicht wirklich postiven Grundstimmung" des Begriffs "Sterbekarenz" würde man ihn allzu gern durch "Hospizkarenz" ersetzen.
Unsaubere Begrifflichkeiten sind das eine, handfeste Versorgungsmängel das ungleich größere Problem. Ein Blick auf den Bedarf und Status quo an Palliativbetten genügt: Rund 100 solcher Betten sind derzeit in ganz Österreich vorhanden. Waren im Krankenanstaltenplan bis 2005 zunächst 400 Betten vorgesehen, hat man die allzu hohe Hürde später auf 275 herabgesetzt.
Ähnlich prekär wie die stationäre Sitation gestaltet sich die mobile palliative Versorgung. "Von einer bundesweit flächendeckenden Palliativbetreuung kann absolut noch keine Rede sein", bilanziert Franz Zdrahal, Leiter des mobilen Hospizdienstes der Caritas Wien und Präsident der österreichischen Palliativgesellschaft. Zumindest in der Bundeshauptstadt leisten er und sein rund 50-köpfiges Team ganze Arbeit: Jeder zweite Hospizpatient wird mittlerweile von dieser Einrichtung der Caritas betreut. Weniger dicht ist das Betreuungsnetz in ländlichen Gegenden geknüpft: Hier mangelt es oft nicht nur an mobiler palliativer Unterstützung, sondern auch an Pflegekräften. Nicht selten legen Ärzte verzweifelten Angehörigen das halblegale Engagement von Krankenschwestern aus Osteuropa ans Herz. Derlei Praktiken sind weder im Wirtschaftsministerium noch bei der Caritas unbekannt.
Das größte Problem orten Experten jedoch im Fehlen eines österreichweiten Hospizplans samt klarem Finanzierungskonzept. "Vorarlberg und die Steiermark gehören hier vor den Vorhang, aber in Kärnten und im Burgenland liegt noch viel im Argen", meint Hildegard Teuschl vom Dachverband Hospiz Österreich. Ähnlich kritisch lautet der Befund von Sabine Pleschberger vom Institut für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (IFF) der Universitäten Klagenfurt, Wien, Innsbruck und Graz. Zwar gebe es bundesweit ein Konzept für die stationäre Versorgung Schwerkranker und Sterbender; noch fehle aber eines für den ambulanten Bereich, beklagt Pleschberger, Mitarbeiterin der Abteilung "Palliative Care und Organisationsethik" am IFF. Besonderes Engagement legt man zweifellos im Ländle an den Tag: Ziel ist die umfassende Betreuung aller Schwerstkranken und Sterbenden in Vorarlberg. Zu diesem Zweck wurde das interdisziplinäre Forschungsinstitut mit der Erstellung eines Gesamtkonzepts beauftragt.
Stationärer Nukleus
Herzstück der Versorgung sei eine Palliativstation mit acht bis zehn Betten - der so genannte "Nukleus", erklärt Katharina Heimerl vom IFF. Dieser soll zum einen als Ausbildungszentrum fungieren, aber auch die stationäre Behandlung von Pa- tienten mit schwerwiegenden Sym-ptomen sicherstellen. Die pflegerische Versorgung im ambulanten Bereich obliegt weiterhin der Hauskrankenpflege, die in Vorarlberg vergleichsweise gut aufgebaut ist. Zwar bleibt nach Vorstellung des IFF der Hausarzt für die medizinische Grundversorgung zuständig, doch soll ihn ein interdisziplinäres "Support-Team", bestehend aus Ärzten, Pflegepersonen, Psychotherapeuten, Psychologen und Seelsorgern, bei der optimalen Einstellung der Schmerztherapie und Symptomkontrolle beraten. Drei solcher interdisziplinärer Teams könnten den landesweiten Bedarf decken, weiß Heimerl.
Der politische Wille zur umfassenden Betreuung Sterbender ist in Vorarlberg jedenfalls gegeben. Diskutiert wird freilich noch die Finanzierung des ambitionierten Projekts: Wird mit dem Bund noch über die Einstufung der gewünschten Palliativ- station im Rahmen der leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) gefeilscht, so sollen die Gelder für die "Support-Teams" aus dem geplanten "Gesundheitsfonds Vorarlberg" fließen. "Gerade im Palliativbereich gibt es immer wieder Schnittstellen zwischen Spitals- und Pflegebereich", erklärt Peter Hämmerle von der Sozialabteilung der Vorarlberger Landesregierung. Durch den einheitlichen Topf, in den künftig Gemeinden, Land, Bund und Sozialversicherungen gemeinsam ihren Obulus entrichten, erwartet man sich gerade für den Palliativbereich "eine große Erleichterung."
Heute Vorarlberg, morgen ganz Österreich? Abwarten ist angesagt, denn noch ist allzu Drängendes umzusetzen: Die Schaffung eines Lehrstuhls für Palliativmedizin gehört ebenso dazu wie die verstärkte Aus-, Fort- und Weiterbildung aller beteiligten Berufsgruppen. Das Handwerkszeug für diese Tätigkeit können Ehrenamtliche schon jetzt in speziellen einsemestrigen Palliativkursen erlernen. "Diese Kurse sind ständig ausgebucht", freut sich Hildegard Teuschl. Nicht ganz so zufriedenstellend ist die Auslastungsquote bei den fünf einjährigen Palliativlehrgängen für Hauptberufliche: Zwar sei das Interesse bei Schwestern und Pflegern groß, jenes der Ärzte lasse jedoch zu wünschen übrig, so Teuschl. Gerade für Mediziner könnten sich jedoch durch den ganzheitlichen Ansatz von "Palliative Care" neue Perspektiven eröffnen: Ziel ist die Linderung körperlicher, aber auch psychischer, sozialer und spiritueller Schmerzen.
Innovatives Grätzel
Dass nicht nur österreichweites Engagement, sondern auch lokale Ambitionen Früchte tragen, beweist der Fall Kaisermühlen. Seit 14 Jahren plant dort Pfarrer Elmar Kahofer mit Hilfe des Salvatorianerordens den Bau eines Pflegehospiz. Zwar war das Vorhaben 1993 aus Geldmangel gescheitert, doch soll das Haus im Oktober endgültig seine Pforten öffnen. Zwei Drittel der rund 80 pflegebedürftigen Kaisermühlner will man hier an ihrem Lebensende betreuen. Bis zum Herbst kümmern sich weiterhin die Freiwilligen der "Kaisermühlner Nachbarschaftshilfe" um die meist alleinstehenden Klienten. "Wir können körperlichen und seelischen Schmerz nicht abschaffen", ist sich Kahofer bewusst. "Wir können ihm aber durch menschliche Nähe die Spitze nehmen."
Informationen unter
www.hospiz.at, zum Pflegehospiz Kaisermühlen unter (01) 263 35 67

















































































.jpg)