
Verrückte Arbeitswelt
Junge Menschen orientieren sich heute oft an einer optimalen Work-Life-Balance. Die berufliche Realität sieht aber noch anders aus.
Junge Menschen orientieren sich heute oft an einer optimalen Work-Life-Balance. Die berufliche Realität sieht aber noch anders aus.
Anna Bucher* liebt ihren Job. Mit Kindern auf dem Boden herumtollen, mithilfe von Handpuppen in Rollenspiele eintauchen oder konzentrierte Sprechübungen anleiten: Wenn sie von ihren Aufgaben erzählt, gerät die 29-jährige Logopädin ins Schwärmen: „Es ist ein sehr aktiver Beruf, bei dem man immer in Bewegung ist.“ Ihre wöchentliche Arbeitszeit beträgt 30 Stunden, 20 davon ist sie an einem Ambulatorium in Wien für Kinder mit besonderen Bedürfnissen angestellt, die restlichen zehn Stunden arbeitet sie freiberuflich. Freitags hat sie frei.
Bucher zieht mit ihrem fix eingeplanten freien Wochentag eine klare Trennlinie zwischen Arbeits- und Privatleben. Längere Dienstzeiten an anderen Wochentagen nimmt sie in Kauf. Das Wissen um den einen Tag für sich habe die Arbeitsmoral gesteigert. Sie lebt ein Modell, dessen Sinnhaftigkeit aktuell heiß diskutiert wird: die Vier-Tage-Woche. Das Verständnis von Arbeit und Tätigwerden wird damit neu gedacht.
„Unser einstmals christlichcalvinistisch geprägtes Arbeitsethos wird zunehmend verdrängt durch eine ästhetisierte Lebensführung, die den Gedanken der Berufspflicht hinter sich lässt“, lautet die Analyse des reformierten Theologen Ulrich H. J. Körtner. Die religiöse Begründung von Arbeit und Beruf sei aus der modernen Gesellschaft weitgehend verschwunden – und spätestens mit der 68er-Generation eine „Hinwendung zur artistischen Lebensführung“ geschehen. Allerdings sei das protestantisch geprägte Arbeitsethos als Grundlage für zeitgenössische Ästhetisierungsprozesse erhalten geblieben. Tätigsein wird dabei als Konsequenz einer Berufung aufgefasst, Berufstätigkeit von Erwerbstätigkeit entkoppelt und ein hohes Maß an Freiheit bei der Auswahl von Tätigkeiten eingesetzt. So gesehen sei „Arbeit bestenfalls das halbe Leben“, meint Körtner.
Eine Auffassung, die auch Anna Bucher teilt. Ihr persönliches Arbeitszeitmodell kann nach Ansicht des Arbeitssoziologen Jörg Flecker in zehn Jahren Normalität sein. Er spricht sich für eine allgemeine Verringerung der Arbeitszeit aus. Arbeit sei intensiver und anstrengender geworden, Arbeitszeiten von früher heute nicht mehr angemessen.
Mit der Vier-Tage- und 32-Stunden-Woche nähert sich die Gesellschaft in kleinen Schritten einer Vision an, die der britische Ökonom John Maynard Keynes schon 1930 hatte. Er ging davon aus, dass der technische Fortschritt es innerhalb von 100 Jahren – also bis 2030 – möglich machen müsste, dass die Menschen nur noch 15 Wochenstunden arbeiten müssen. Eine derartig radikale Arbeitszeitverkürzung ist für Flecker grundsätzlich eine realistische Perspektive.
Durch die voranschreitende Automatisierung und Digitalisierung werde langfristig immer weniger menschliche Arbeitszeit für die gleiche Menge an Gütern und Dienstleistungen erforderlich sein. Einher ginge eine solche Neuordnung des Arbeitsmarktes mit einer radikalen Umverteilung von Macht und Eigentum, sagt Flecker.
Der reale Arbeitsmarkt sieht anders aus. Konzerne werden immer mächtiger, Vermögensungleichheit nimmt zu, und in Österreich können laut AMS 300.000 Stellen wegen fehlender Fachkräfte nicht besetzt werden. Die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre sind in die Altersgruppe der 50- bis 60-Jährigen am Arbeitsmarkt vorgerückt. Nachfolgende Jahrgänge sind zudem geburtenschwächer, und jene, die nachrücken sollen, treten ob verbesserter Bildungschancen und längerer Ausbildungszeiten erst später als ihre Großeltern und Eltern ins Berufsleben ein.
Das zeigt eine Wifo-Studie von Julia Bock-Schappelwein. Die Arbeitsökonomin erklärt, dass es trotzdem eine große Heterogenität in der Alterszusammensetzung in österreichischen Betrieben gebe. Demnach sind 24 Prozent der Unternehmen in Österreich alterszentriert. Ein großer Teil der Belegschaft wird in näherer Zukunft in Pension gehen. 30 Prozent der Betriebe sind jugendzentriert. Weitere 31 Prozent haben keine ausgeprägte Altersstruktur.
Die Freiheit des Alters
In jugendzentrierten Betrieben, die vielfach im Tourismus zu finden sind, gibt es oft einen hohen Personalumschlag, während es in alterszentrierten Betrieben – zu finden in Branchen wie der öffentlichen Verwaltung, dem Finanzwesen oder auch dem Gesundheits- und Unterrichtswesen – kaum Personalwechsel gibt. Beide Phänomene kennt Maria Raidinger aus ihrem Berufsleben.
40 Jahre lang war die Burgenländerin bei Raiffeisen tätig, hatte einen sicheren Job mit wenig Fluktuation. Im Vorjahr ging sie in Pension. Jetzt hilft die 62-Jährige Vollzeit in der Kaffeehaus-Konditorei ihrer Schwester mit, weil es schwierig ist, junge motivierte Mitarbeiterinnen für die Vollzeitstelle zu gewinnen. Auch die Wochenendarbeit schreckt ab. Eine Tendenz, die schon vor der Pandemie deutlich geworden ist und sich nun verstärkt hat.
Raidinger hingegen stört sich nicht an den oft langen Diensten. Gäbe es die Konditorei nicht, würde sie sich im sozialen Bereich betätigen. „Ich kann nicht nichts tun“, sagt sie. Die 62-Jährige befindet sich in einer Lebensphase, die „Freitätigkeit“ genannt wird und die Zeit zwischen Pensionierung und endgültigem Ruhestand umfasst. Diese Lebensphase gab es eine Generation früher nicht. Interessant wird sie für Betriebe, die Menschen wie Maria Raidinger einstellen und im besten Fall damit auch Expertise im Betrieb sichern. Genau das ist das Anliegen der Organisation „Seniors for Success“, die sich auf die Vermittlung von eigentlich pensionierten Menschen mit Tatendrang spezialisiert hat.
Für die Senior(inn)en geht es laut der Organisation vielfach auch darum, etwas für sie Sinnerfüllendes und Herausforderndes zu tun. Damit teilen sie eine Ambition mit der jüngsten in den Arbeitsmarkt eintretenden Generation: das Streben nach sinnstiftender Arbeit. Dieses hat es laut Jörg Flecker immer schon gegeben, heute sei dieser Wunsch aber für viele Menschen tatsächlich erreichbar geworden, auch wenn die Frage nach der Leistbarkeit offen bleibt. Dessen ist sich auch Anna Bucher bewusst. Ihr Arbeitszeitmodell kam nicht auf Wunsch. Die 20 Wochenstunden waren vom Arbeitgeber vorgegeben. Die Sorge um die finanzielle Sicherheit war da. Dennoch hat sie sich bewusst dafür entschieden. Dass sie sich damit einmal ein Haus wird leisten können, ist für sie unrealistisch. Darauf hinzuarbeiten, findet sie aber auch nicht erstrebenswert. Im Gegenteil – sie hofft, dass die Gesellschaft „aus Burn-out-Generationen und Scharen von durch Panik gepeinigten Arbeiter(inne)n auch irgendwie etwas gelernt hat“.
*Name von der Redaktion geändert
Arbeit im Zeitraffer

Ca. 5000 v. Chr.: Die sesshaft gewordenen Menschen können sich selbst versorgen und beginnen mit ihren Überschüssen zu handeln. Arbeitskraft und Arbeitszeit können nun anders genutzt werden als nur auf dem Feld: der Beginn der Differenzierung verschiedener Berufe
1 von 8
Ca. 800 bis 30 v. Chr.: Die großen Denker des antiken Griechenlands von Homer über Aristoteles bis zu Xenophon blicken auf die Schufterei herab. Sie widmen sich der geistigen Schöpfung. Wer gezwungen ist zu arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu sichern, gilt ihnen als „unfrei“. Denker, die sich positiv gegenüber körperlicher Arbeit äußern, sind rar gesät.
2 von 8
600 bis 1500 n. Chr.: Im Verlauf des Mittelalters entwickeln sich in Europa agrikulturelle und handwerkliche Produktionsmethoden. Die in der Agrargesellschaft angelegte Ständeordnung trägt wesentlich dazu bei, dass zwischen niederer und höherwertiger Arbeit unterschieden wird. Dieses Begriffsverständnis hält sich bis in die Gegenwart.
3 von 8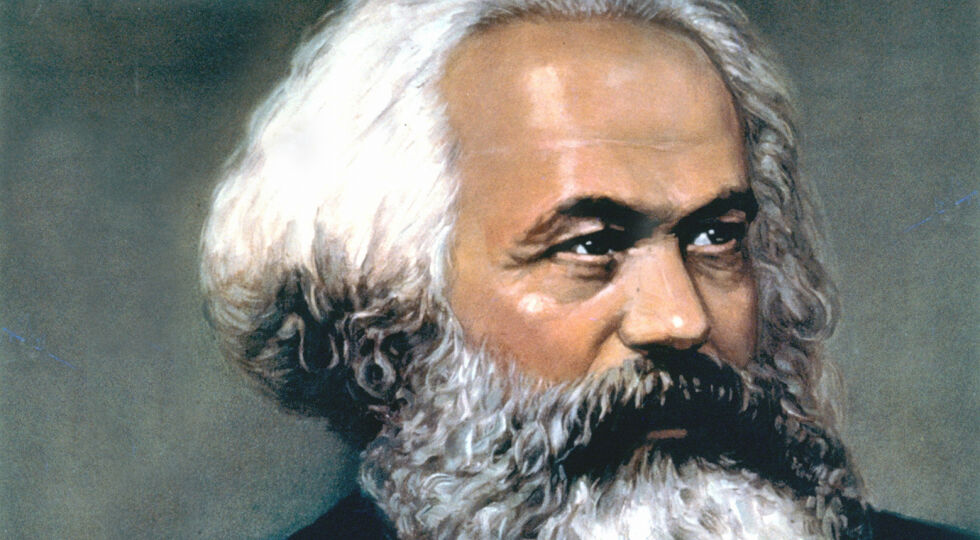
Mitte des 19. Jahrhunderts: Karl Marx definiert den Arbeitsbegriff als philosophische Kategorie. Er führt den Begriff „abstrakte Arbeit“ ein. Seiner materialistischen Weltsicht zufolge soll der Tauschwert einer Ware primär ein Äquivalent für die dazu aufgewendete Arbeit sein.
4 von 8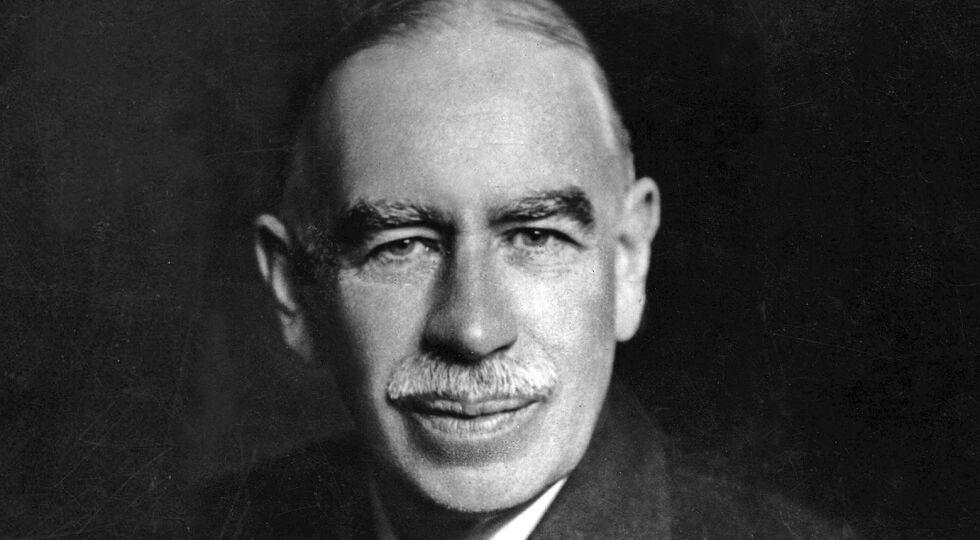
1930: Der Ökonom John Maynard Keynes meint, dass innerhalb von 100 Jahren alle wirtschaftlichen Probleme gelöst sein werden – und hält für seine Enkelgeneration eine 15-Stunden-Woche für möglich.
5 von 8
1939 - 1945: Das NS-Regime missbraucht den Begriff der Arbeitsmoral mit der Aufschrift „Arbeit macht frei“ über den Toren seiner Konzentrationslager.
6 von 8
1959: Der ÖGB und die Wirtschaftskammer Österreich unterzeichnen einen Generalkollektivvertrag. Im Laufe des Jahres tritt in allen Branchen die 45-Stunden-Arbeitswoche für gewerbliche Betriebe in Kraft. Ein erster Schritt zur Arbeitszeitverkürzung.
7 von 8
Gegenwart: In den vergangenen 30 Jahren hielt in Österreich die Debatte über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie Einzug in die Arbeitspolitik. Diskutiert, eingeführt und nachverhandelt wurden Elemente wie Elternteilzeit (2004) oder der Papamonat (2019). Aktuell herrscht ein Diskurs rund um die Vier-Tage-Woche vor – und um Homeoffice.
8 von 8Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

































































































