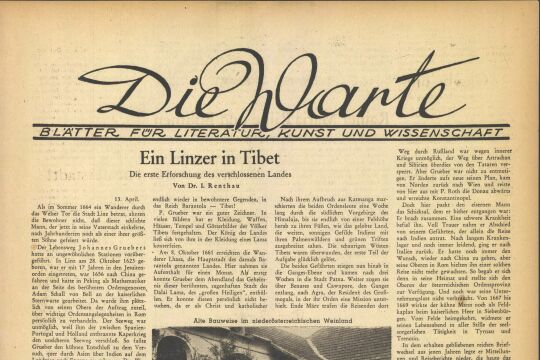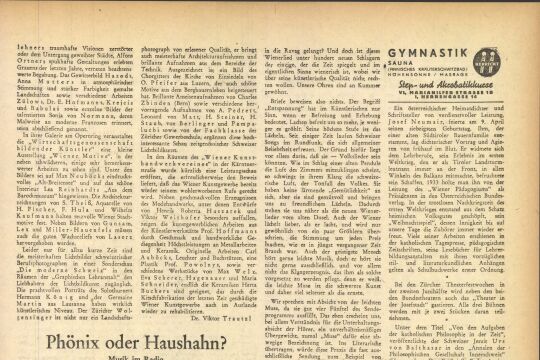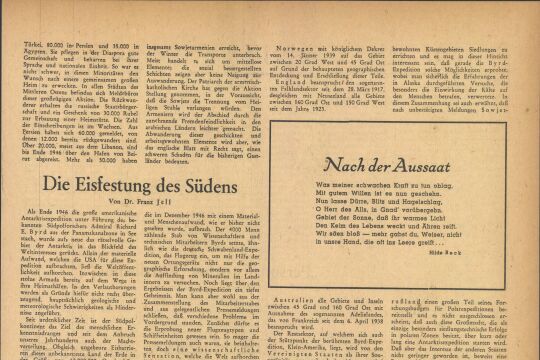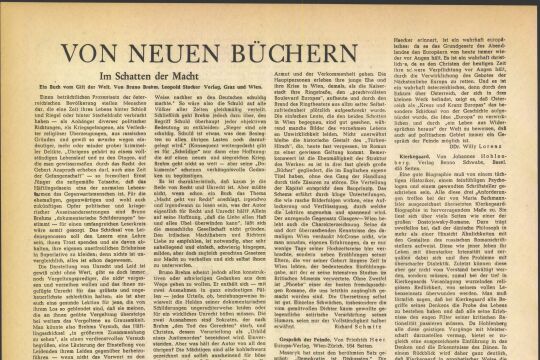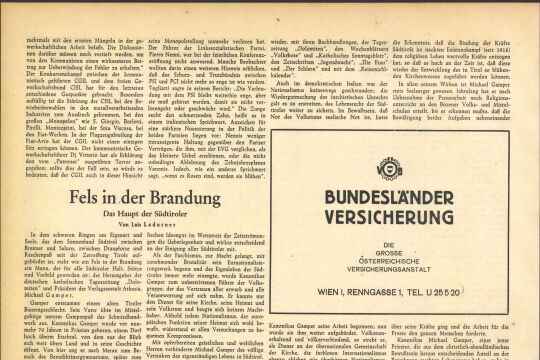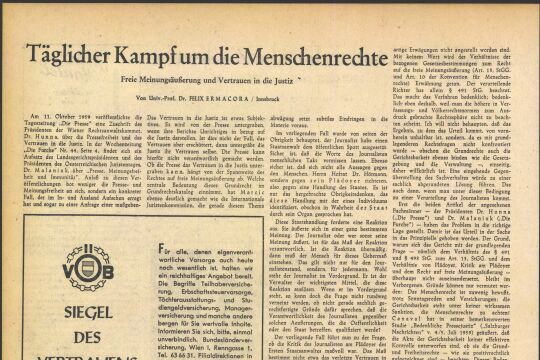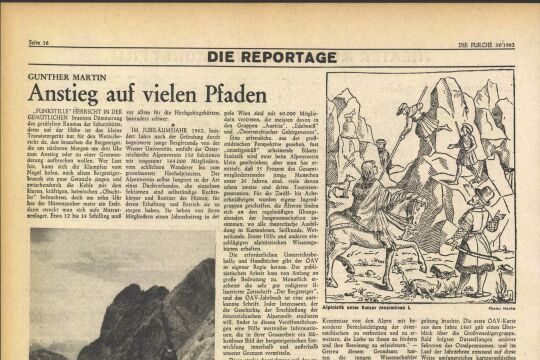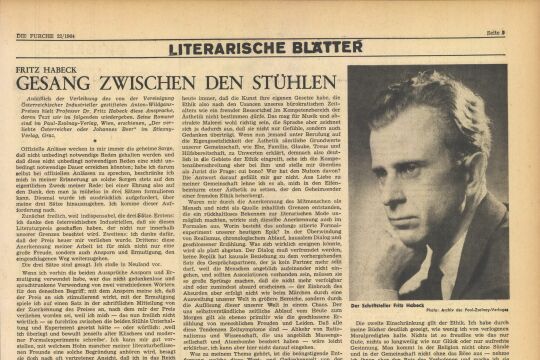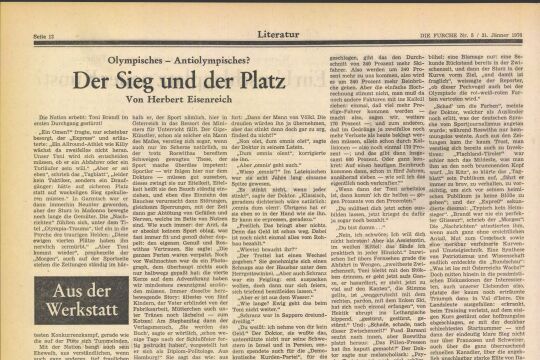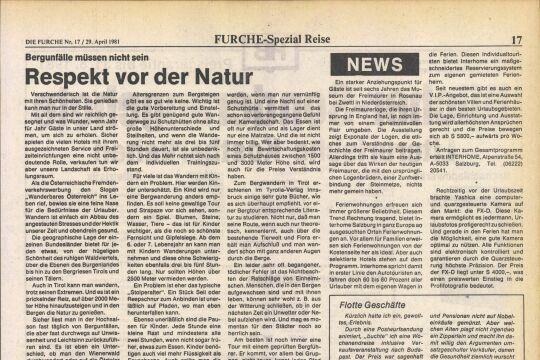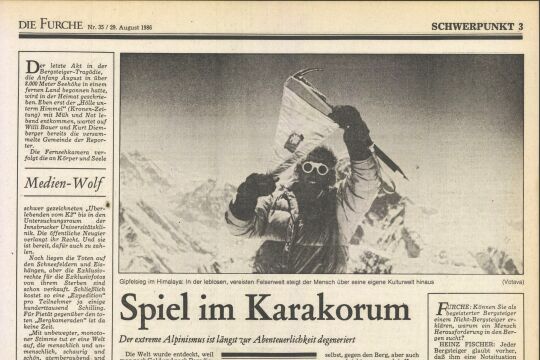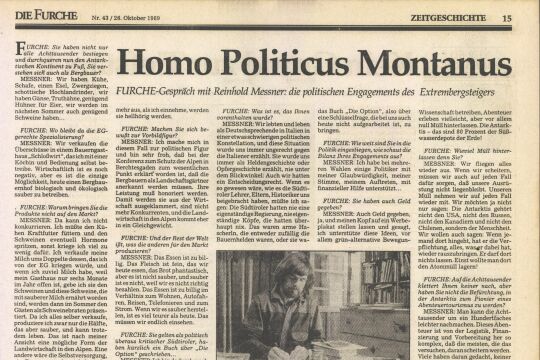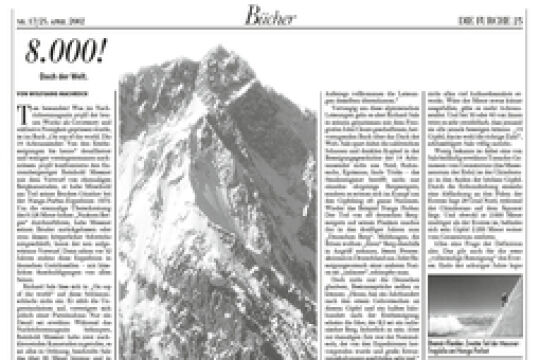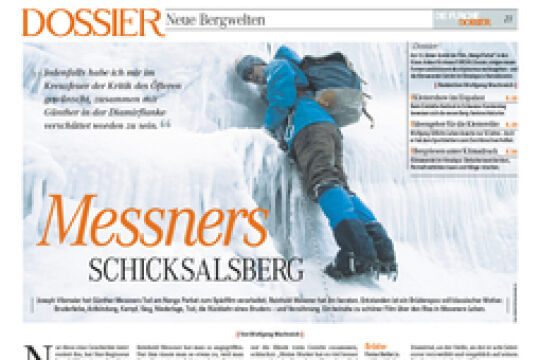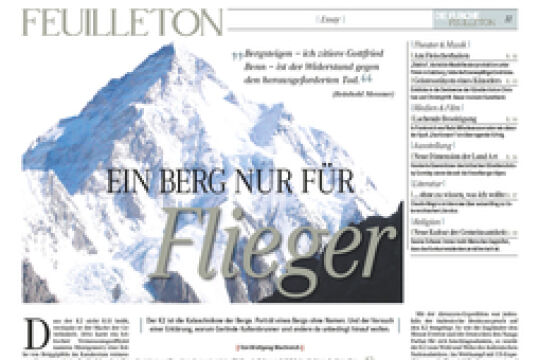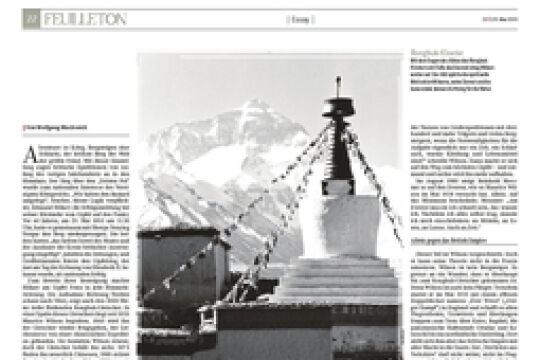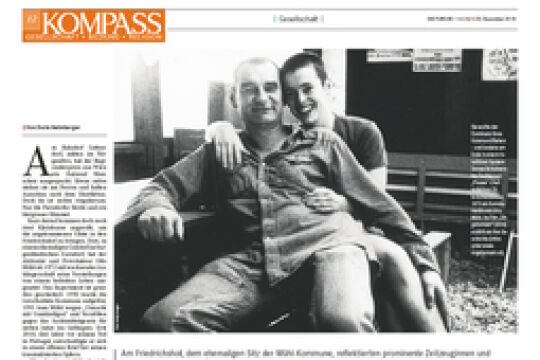Von Aufstieg und Abseits
Ganz oben sein: Dieses Ziel setzen sich die besten Bergsteigerinnen der Welt. Doch warum gibt es heute so wenige Frauen im Spitzenalpinismus? Eine Erkundung.
Ganz oben sein: Dieses Ziel setzen sich die besten Bergsteigerinnen der Welt. Doch warum gibt es heute so wenige Frauen im Spitzenalpinismus? Eine Erkundung.
Vor zehn Jahren erreichte das Rennen um den Titel „Erste Frau auf allen 14 Achttausendern“ seinen Höhepunkt. Bis dahin führte der Frauenalpinismus medial eher ein Schattendasein, mit Ausreißern durch Bergsteigerinnen in den 1970er und 1980er Jahren. Doch auf einmal berichteten internationale Medien ausführlich über Frauen am Berg. Dem National Geographic war etwa das erfolgreiche Ringen der österreichischen Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner um die Besteigung des K2 (8611 Meter) im Karakorum in Pakistan eine Titelgeschichte wert, in der in martialischer Sprache über die „Eroberung“ des Achttausenders berichtet wurde. In Spanien wurde mit der Alpinistin Edurne Pasaban mitgefiebert. In Südkorea war der Plan von Oh Eun-Sun, „erste Frau“ zu werden, ohnehin ein nationales Prestigeprojekt. Nur eine, die mit ihrem Können ebenfalls real die Chance gehabt hätte, nahm sich aus dem Spiel: die Italienerin Nives Meroi. Sie meinte, sie wolle bei diesem „Zirkus“ nicht mehr mitmachen. Tatsächlich ging der Titel „Erste Frau auf allen 14“ am 27. April 2010 an Oh Eun-Sun. Ob sie 2009 wirklich den Kangchendzönga bestiegen hat, ist allerdings mehr als umstritten. Kurze Zeit später folgte Edurne Pasaban. Der moralische Sieg ging deshalb am 23. August 2011 an Kaltenbrunner, die eindeutig darlegen konnte, dass sie alle Achttausender (anders als Oh Eun-Sun oder auch Edurne Pasaban) ohne Hilfe von zusätzlichem Sauerstoff bewältigt hatte.
Gesucht sind innovative Alpinistinnen
Seit damals ist es ruhiger geworden um die Alpinistinnen. Kaltenbrunner macht Yoga, hält Vorträge und unternimmt Bergtouren – für Servus TV erklomm sie etwa 2018 gemeinsam mit Peter Habeler den Damavand (5610 Meter) im Iran –, doch ihrem Können entsprechende Touren sind nicht mehr dabei. Pasaban, überzeugt davon, dass Höhenbergsteigen und Kinder nicht vereinbar seien, hat sich ihren „15. Achttausender“, die Mutterschaft, erfüllt. Aber auch sie profitiert nach wie vor von der Prominenz von „Mount Everst“ und Co. Es geht eben um alpinistische Ziele, die einem Massenpublikum gut erklärbar sind. Das bringt Aufmerksamkeit, Anerkennung und Sponsoren. Auch wenn Kaltenbrunner stets beteuert hat, dass es ihr nicht um den Titel „erste Frau“ gehe und dass dieses Rennen nur medial inszeniert gewesen sei, hat sie ihren Part gespielt und ist jedes Jahr wieder zu den Achttausendern gereist. Zugleich wird von Spitzenbergsteigerinnen erwartet, den Aspekt des Wettkampfs, des Rennens, der Konkurrenz weniger zu gewichten, meint die Sportwissenschaftlerin Rosa Diketmüller von der Universität Wien. „Wettkampf und Konkurrenz werden nicht als passend für Frauen angesehen“, betont sie. Auch heißt es, die Frauen hätten mit der Besteigung aller Achttausender im Grunde keine neue Leistung vollbracht, sondern nur nachvollzogen, was die Männer bereits in den Achtzigern erledigt hätten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!